Finanzkrise und Marktwirtschaft
Zu den Zielen des Restrukturierungsgesetzes
Finanzkrise und Marktwirtschaft
Zu den Zielen des Restrukturierungsgesetzes
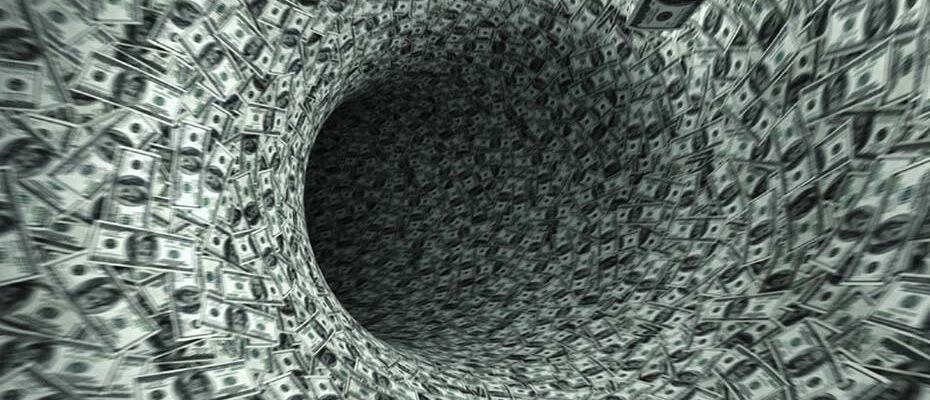
Die Bundesregierung hat Ende August den Entwurf eines Gesetzes zur Restrukturierung und geordneten Abwicklung von Kreditinstituten (Restrukturierungsgesetz) vorgelegt, das Lehren aus der Finanzkrise zieht. Es geht letztlich darum, inwieweit Grundprinzipien der Marktwirtschaft in Krisenfällen weiter Anwendung finden.
Für die Verantwortung in der Marktwirtschaft gibt es eine einfache Regel: Eigentümer eines Unternehmens tragen Chancen und Risiken gleichermaßen. Erzielt das Unternehmen Gewinne, stehen sie den Eigentümern zu. Geht es dem Unternehmen schlecht, müssen sie abwägen, ob sie investieren, um eine Wertminderung oder ein Abrutschen zu vermeiden. Im schlimmsten Fall droht bei normalen Marktverhältnissen die Insolvenz. Das kann wirtschaftlich den Totalverlust der Investition bedeuten, für Eigentümer wie für Gläubiger.
Dieses Gleichgewicht zwischen Chancen und Risiken ist der Kern der marktwirtschaftlichen Eigentümer- und Gläubigerverantwortung. Sie funktioniert, wenn nicht nur Chancen winken, sondern auch Risiken drohen. Chancen auf Gewinne und Risiko der Insolvenz sind die Waagschalen der Eigentümer- und Gläubigerverantwortung.
In der Finanzkrise galt dieser Grundsatz nicht mehr.
Kernerfahrung Finanzkrise: Too big to fail
Die Kernerfahrung der Finanzkrise war bitter: Banken waren zu groß, um in die Insolvenz zu gehen. Die Folgen einer Insolvenz wären für Finanzmarkt, Wirtschaft und Bevölkerung belastender gewesen als deren Abwendung durch staatliche Hilfe. Das Negativbeispiel von Lehman Brothers stand allen vor Augen. Das „too big to fail“ wurde zum Schlagwort für die Rechtfertigung umfangreicher staatlicher Garantien und Kapitalmaßnahmen. Die Insolvenz war keine Option mehr. Das Grundprinzip der freien Marktwirtschaft, das Gleichgewicht zwischen Gewinnchancen und (Insolvenz-)Risiken, geriet aus dem Lot.
Was aber kann man tun, wenn einerseits die systemrelevante Bank im Insolvenzfall nicht fallengelassen, andererseits die Verantwortung in der Marktwirtschaft gewahrt werden soll? Diese Frage stellte sich bereits dem Gesetzgeber des Finanzmarktstabilisierungsgesetzes Ende 2008/Anfang 2009. Und sie stellt sich erneut, aus etwas größerer Distanz, dem Gesetzgeber des Restrukturierungsgesetzes 2010. Darauf gibt es zwei Antworten:
Die erste Antwort besteht in der Einsicht, dass das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, wenn das Gesetz relevant wird. Das Restrukturierungsgesetz ist ein Reparaturkasten, der Unfall ist schon geschehen. Er besteht darin, dass von einem bestandsgefährdeten Kreditinstitut eine solche Gefährdung für andere Unternehmen des Finanzsektors, die Finanzmärkte oder das allgemeine Vertrauen der Einleger und Marktteilnehmer in die Funktionsfähigkeit des Finanzsystems ausgeht, dass der Staat, abweichend vom Normalfall, die Insolvenz nicht zulässt. Die erste und wichtigste Lehre der Finanzkrise besteht zwar darin, genau solche Situationen des „too big to fail“ für die Zukunft zu vermeiden. Das ist auch das Ziel der neuen regulatorischen Anforderungen, auf internationaler Ebene z.B. der erhöhten Eigenkapitalanforderungen von „Basel III“. Indes geht niemand davon aus, dass dieses Idealziel, die vollständige Vermeidung eines „too big to fail“, erreicht wird. Deshalb muss der Gesetzgeber für den Fall der Fälle vorsorgen und den Schaden eines „too big to fail“ für Steuerzahler und Marktwirtschaft so gering wie möglich halten, das ist die zweite Antwort – und das Ziel des Restrukturierungsgesetzes.
Der Staat hilft unter Bedingungen
Auf die unvermeidbare Frage, ob der Staat einem systemrelevanten Institut helfen soll, antwortet das Restrukturierungsgesetz mit einem „Ja, aber“: Er hilft. Aber die Belastungen für die Steuerzahler und den Wettbewerb müssen so gering wie möglich gehalten werden. Das war schon das Ziel der Finanzmarktstabilisierungsgesetze in 2008/2009 und ist auch jetzt das Ziel des Restrukturierungsgesetzes 2010.
Dabei geht der Gesetzgeber von dem Grundsatz aus: Die Stabilität des Finanzmarktes mag die Rettung eines systemrelevanten Kreditinstituts erfordern, aber nicht die Aufhebung der Eigentümer- und Gläubigerverantwortung.
Zwischen dem Institut einerseits, insbesondere seinen systemrelevanten Teilen, und den Eigentümern sowie Gläubigern andererseits muss also unterschieden werden –
jedenfalls als guideline:
Schon das erste Finanzmarktstabilisierungs-Paket von Oktober 2008 sah vor, dass während der Staatshilfe rechtlich nicht geschuldete Leistungen an Gesellschafter auch nicht erbracht werden. Schon damals wurde erkannt, dass sich Unternehmensrettung im Interesse des Gemeinwohls und Aufrechterhaltung der Eigentümerverantwortung nicht ausschließen.
Im Frühjahr 2009 wurde dieser Grundsatz weiter gedacht, im Ergänzungsgesetz zur Finanzmarkstabilisierung. Es war klar, dass die Waage der Eigentümerverantwortung, die durch die Gewissheit des rettenden Staates aus dem Gleichgewicht geraten war, erst dann wieder ins Lot kam, wenn die Eigentümer eine Situation befürchten mussten, die wirtschaftlich einer Insolvenz vergleichbar war. Das Ergänzungsgesetz zur Finanzmarkstabilisierung ermöglicht dem Bund im Interesse der Finanzmarkstabilität einen Einstieg auf Zeit, der bei umfassender Restrukturierung eines gefährdeten Unternehmens zwingend erforderlich ist, und zwar auch ohne oder gegen den Willen der bisherigen Eigentümer. Die Einstiegsinstrumente sind privat- und öffentlich-rechtlicher Art:
Wo bisher in einer Hauptversammlung 75 % der Stimmen für eine Kapitalherabsetzung oder ein Bezugsrechtsausschluss erforderlich waren, reicht nach dem Ergänzungsgesetz zur Finanzmarkstabilisierung für den Bund die einfache Mehrheit, wenn die Kapitalmaßnahme der Finanzmarkstabilisierung dient. Wo bisher bereits eine Anfechtungsklage gegen den Beschluss einer Hauptversammlung die Eintragung verzögerte, muss nunmehr unverzüglich eingetragen werden. Und die Schwelle für einen Squeeze-Out der Minderheitsaktionäre wurde von 95 % auf 90 % reduziert. Diese im Interesse der Finanzmarkstabilität erforderlichen Beschränkungen der Gesellschafterrechte wurden z.B. bei dem Einstieg des Bundes zur Rettung der Hypo Real Estate Gruppe (HRE) genutzt.
Als öffentlich-rechtliches Instrument erlaubte das Ergänzungsgesetz in Form des Rettungsübernahmegesetzes eine Enteignung des Kreditinstituts zum Zwecke der Finanzmarktstabilisierung.
Die noch von der Großen Koalition geschaffene Enteignungsoption war politisch hoch umstritten; sie wurde deshalb befristet bis Ende Juni 2009 – einem Zeitpunkt, bis zu dem klar war, ob der Bund im Falle der HRE mit Hilfe der verschärften gesellschaftsrechtlichen Instrumente das Alleineigentum wird erlangen können. Das war der Fall. Das Rettungsübernahmegesetz wurde nie angewandt, es blieb bei der Option – und der damit verbundenen (wirkungsvollen) Drohung.
Enteignungsoptionen gibt es künftig nicht mehr
Die Krisenbewältigung der Zukunft sieht dieses Instrument nicht mehr vor. Das Restrukturierungsgesetz enthält keine Enteignungsoption, allerdings durchaus weitgehende Eingriffsbefugnisse der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gegenüber schwankenden Kreditinstituten. Dazu gehört das Recht, die systemrelevanten Teile einer bestandsgefährdeten und das System gefährdenden Bank zwangsweise, d.h. durch Verwaltungsakt, auf eine neue Einheit auszugliedern, die entweder im Eigentum eines Dritten, des dem Bund zugehörigen Restrukturierungsfonds oder der Kernbank und von Dritten oder des Restrukturierungsfonds steht.
Indem der Bund lediglich eine Unterstützung der auszugliedernden systemrelevanten Teile im Restrukturierungsgesetz ermöglicht, nicht jedoch eine Unterstützung der Kernbank, versucht er, Belastungen der Steuerzahler durch eine Unterstützung schlechter Teile der Bank zu vermeiden. Da indes in der Praxis systemrelevante Teile eines Kreditinstituts nicht zwingend identisch mit den „guten“, also profitablen Teilen der Bank sind, ist es denkbar, dass der Restrukturierungsfonds auch „schlechte“ Teile unterstützen wird.
Bankenabgabe reicht möglicherweise nicht
Ein weiterer Baustein, mit dem das Restrukturierungsgesetz die Belastung der Steuerzahler so gering wie möglich halten möchte, ist die von allen Kreditinstituten erhobene Bankenabgabe.
Sie fließt in den Restrukturierungsfonds, aus dem künftige Unterstützungsmaßnahmen finanziert werden sollen. Da allerdings nicht zu erwarten ist, dass die Bankenabgabe ausreicht, um Hilfsmaßnahmen zu finanzieren, ermöglicht das Restrukturierungsgesetz für diesen Fall die Aufnahme staatlicher Kredite. Dann also werden weiterhin Kosten auf den Steuerzahler zukommen. Da außerdem der Bund für Leistungen des Restrukturierungsfonds von Gesetzes wegen garantiert, begründet das Gesetz eine implizite Staatsgarantie, was den Wettbewerb zugunsten dieser Banken verzerrt.
Dennoch geht das Restrukturierungsgesetz den richtigen Weg. Wenn nämlich ein „too big to fail“ nicht völlig auszuschließen ist, bleibt nichts anderes übrig, als die Frage, ob der Staat, unter Missachtung der Prinzipien der Marktwirtschaft, eine systemrelevante Bank vor der Insolvenz bewahren soll, mit einem „Ja, aber“ zu beantworten. Ja, er hilft im Interesse der Finanzmarktstabilität, aber nur unter Bedingungen, die, soweit wie irgend möglich, die Verantwortung von Eigentümern und Gläubigern der Bank auch in Krisensituationen aufrechterhalten.
Hinweis der Redaktion: PUBLICUS wird über die Auswirkungen der Finanzkrise – insbesondere für die Kommunen und die kommunalen Haushalte – unter dem Gesichtspunkt strategischer Lösungsansätze und anhand von Best-Practice-Beispielen in loser Folge berichten.



