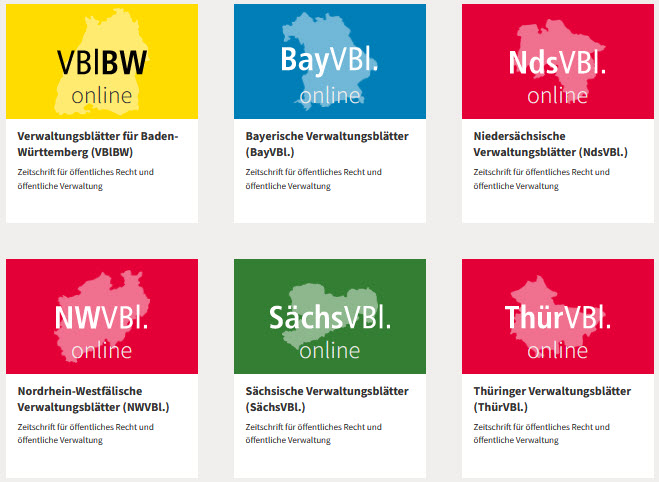Sanierungsanordnungen für Trinkwasserleitungen bei Bisphenol-A-Grenzwertüberschreitungen
Folge 1: Einleitung und Ermächtigungsgrundlage
Sanierungsanordnungen für Trinkwasserleitungen bei Bisphenol-A-Grenzwertüberschreitungen
Folge 1: Einleitung und Ermächtigungsgrundlage

Die neue Trinkwasserverordnung im Spannungsverhältnis zu Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG.[1]
I. Einleitung
„Rhein-Neckar-Kreis: Krebserregende Chemikalie in alten Wasserrohren“[2]
Diese eindrückliche Überschrift eines Artikels auf der Webseite des Südwestrundfunks (SWR), der sich auf einen Beitrag der Sendung im SWR 4 am Nachmittag vom 22.11.2023 um 14:00 Uhr bezieht, lenkt die Aufmerksamkeit des Lesers auf eine zunehmend auftretende Problematik von Bisphenol-A-(BPA)-Grenzwertüberschreitungen in Trinkwasserrohren von Wohnhäusern im Rhein-Neckar-Kreis.
Der vorliegende rechtswissenschaftliche Aufsatz beschäftigt sich in diesem Kontext in bündiger Form mit der Problematik der Anforderungen an die Rechtsgrundlage von Anordnungen der Gesundheitsämter, die an Wohnungseigentümergemeinschaften aufgrund festgestellter erhöhter Bisphenol-A-Werte in den Trinkwasserleitungen der Wohngebäude gerichtet werden können.[3]
Im Rahmen einer Sanierungsanordnung kann dabei der Austausch der Rohrleitungen mit neuen, epoxidfreien Leitungen verfügt werden, sodass sowohl in das Sondereigentum der einzelnen Eigentümer als auch in das Gemeinschaftseigentum der WEG als Ganzes eingegriffen werden könnte, sodass eine Verletzung in deren Grundrechtsposition aus Art. 14 Abs. 1 GG zumindest möglich erscheint.[4] Die Reichweite der Problematik ist dabei keinesfalls singulär auf einzelne Regionen beschränkt; so schätzt z. B. der Verband der Rohrinnensanierer, dass bei ca. 100.000 Wohnungen Epoxidharz im sog. Relining-Verfahren verwendet wurde und es infolgedessen zu einer Bisphenol-A-Belastung des Trinkwassers kommen kann.[5]
Im Rahmen dieses Aufsatzes wurden Landratsämter in Baden-Württemberg und Bayern angeschrieben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass viele Gemeinden etwaige Sachverhalte oder insbesondere auch Musterbescheide für Sanierungsanordnungen bisher nicht vorweisen können. Die grundlegenden Informationen zu den Sanierungsanordnungen der Verwaltung basieren auf der oben genannten Berichterstattung im Rhein-Neckar-Kreis und der Auskunft des Gesundheitsamtes der Stadt Freudenstadt.[6]
Mithin zeigt sich, dass die Bearbeitung der Sachverhalte bezüglich anzuordnender Sanierungen von Trinkwasserleitungen bei Bisphenol-A-Grenzwertüberschreitungen noch am Anfang steht, sodass dieser Aufsatz einen ersten Beitrag zur Erörterung rechtlicher Fragestellungen hinsichtlich der Verordnungsermächtigung und des Verordnungsinhaltes im Kontext des Verwaltungshandelns leisten kann.
1. Wissenschaftlicher Hintergrund
Zum wissenschaftlichen Forschungsstand bezüglich der Toxizität und Risikobewertung von Bisphenol A ist an dieser Stelle einleitend darauf hinzuweisen, dass der Grenzwert im Jahr 2023 für die täglich tolerierbare Aufnahme (TDI-Wert) von Bisphenol A beim Menschen von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) um den Faktor 20.000 zum Vergleich zum Wert aus dem Jahr 2015 gesenkt wurde, in concreto von 4 µg pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag auf 0,2 ng pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag.[7] Das Bundesamt für Risikobewertung (BfR) hat im Jahr 2023 jedoch eine abweichende Stellungnahme veröffentlicht, mit einer Empfehlung zur Absenkung um einen Faktorwert von „lediglich“ 20 auf einen neuen Wert von 200 ng (0,2 µg) pro Kilogramm Körpergewicht und Tag.[8]
Der Wert in der Trinkwasserverordnung (Novelle 2023) basiert hingegen auf der Trinkwasserrichtlinie 2020/2184 der EU, die sich auch auf Bewertungen der EFSA aus dem Jahr 2015 stützt und den Grenzwert für BPA auf 2,5 µg pro Liter festlegt.[9]
Bei der Analyse von Trinkwasserproben in Wohngebäuden mit durchgeführter Epoxidharzsanierung im Jahr 2022, die die Gesundheitsämter in Baden-Württemberg und das CVUA Stuttgart durchgeführt haben, wurden Konzentrationen im Warmwasser von maximal 211 µg pro Liter gefunden, wobei 87 % der Warmwasserproben den Grenzwert in der TrinkwV überschritten.[10] Bei den Kaltwasserproben wurden hingegen ausschließlich Grenzwerte unter 0,2 µg pro Liter festgestellt, sodass die gesamte Problematik aufgrund der unzureichenden Hitzebeständigkeit von Epoxidharzen ausschließlich beim Konsum von Warmwasser auftritt.[11]
2. Auswirkungen der wissenschaftlichen Erkenntnisse auf das Verwaltungshandeln
Insgesamt wird die Situation bezüglich epoxidbeschichteter Trinkwasserrohre von vielen Seiten als kritisch eingestuft, wobei der wissenschaftliche Konsens hinsichtlich der Grenzwerte und des Ausmaßes der Gesundheitsrisiken für den menschlichen Körper nicht unumstritten ist.[12] Für das Verwaltungshandeln bedeutet dieser Befund, dass ein abgestuftes Vorgehen von einem Verbot des Konsums von Warmwasser bis hin zu einer Sanierungsverfügung der Leitungen grundsätzlich denkbar ist.[13]
Jedoch verbleiben die Unsicherheiten bei der Bewertung der Bisphenol-A-Grenzwerte, sodass eine eindeutige und klare Regelung der Befugnisnormen der Gesundheitsämter gegenüber Betroffenen bei solch belastenden Maßnahmen wie der gegenständlichen Sanierungsanordnung umso wichtiger ist, um insbesondere dem Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung aus Art. 20 Abs. 3 GG und abgeleitet auch dem Prinzip vom Vorbehalt des Gesetzes zu entsprechen.
Inwieweit jedoch diese Anordnungen der Gesundheitsämter, die auf der Novellierung der Trinkwasserverordnung basieren, sich überhaupt auf eine wirksame und ausreichende Rechtsgrundlage stützen können, ist zuvörderst unter dem Gesichtspunkt der gemäß Art. 80 Abs. 1 Satz 3 GG am Anfang der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) zitierten Ermächtigungsgrundlagen zu erörtern. So finden sich zwar in der neuen Trinkwasserverordnung ab den §§ 61 ff. TrinkwV einige Befugnisnormen zur Gefahrenvorsorge und Gefahrenabwehr; und damit kommen auch für die Gesundheitsämter grundsätzlich potenzielle Verwaltungsaktbefugnisse zum Erlass der oben erwähnten Sanierungsanordnung der Trinkwasserleitungen in Betracht. Jedoch steht diese Möglichkeit einer Verwaltungsaktbefugnis unter der Prämisse, dass eine wirksame Ermächtigungsgrundlage existiert, um dem Verordnungsgeber eine derivative Kompetenz zum Erlass von Verordnungsrecht einzuräumen.[14]
3. Zentrale Fragestellung
Die zentrale Fragestellung dieses Aufsatzes lautet deshalb wie folgt:
Ist die einschlägige Ermächtigungsgrundlage im vorliegenden Sachverhalt gemäß Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG bestimmt genug, sodass die Verwaltungsaktbefugnis in der TrinkwV als eine rechtmäßige Rechtsgrundlage für das Verwaltungshandeln der Gesundheitsämter anzusehen ist?
II. Einschlägige Ermächtigungsgrundlage im vorliegenden Sachverhalt
In Betracht kommen dabei, gemäß den in der TrinkwV aufgrund des Art. 80 Abs. 1 Satz 3 GG zitierten Normen, Ermächtigungsgrundlagen aus dem Infektionsschutzgesetz, dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetz, dem Bundesgebührengesetz, dem Bundes-Immissionsschutzgesetz und dem Ordnungswidrigkeitengesetz.[15]
Bei der Subsumtion des gegenständlichen Sachverhaltes unter die in der Verordnung aufgeführten Normen zeigt sich, dass bei einer umwelt- bzw. gesundheitsbedingten Anordnung der Gesundheitsämter primär die Ermächtigungsgrundlage des § 38 Abs. 1 IfSG (i. V. m. § 55 IfSG) als die einschlägige Delegationsnorm angesehen werden könnte. Denn nur im Abschnitt 7 (§§ 37ff. IfSG) des Infektionsschutzgesetzes findet sich eine Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsverordnung, die den Gebrauch von Wasser für den menschlichen Bedarf näher regelt.[16]
Jedoch ist vor einer tiefergehenden Exegese des § 38 Abs. 1 IfSG und § 55 IfSG zunächst auf die allgemeinen Voraussetzungen des Bestimmtheitsgebotes in Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG einzugehen, im Lichte derer eine Aussage über die hinreichende Kongruenz von Verordnungsinhalt mit der Ermächtigungsgrundlage getroffen werden kann.
1. Der Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG als Konkretisierung der Wesentlichkeitsdoktrin
Der Art. 80 GG ermöglicht eine Entlastung des parlamentarischen Gesetzgebers in Form einer abgeleiteten Legitimation durch Übertragung der Rechtssetzungsbefugnis an die Exekutive, wobei durch dieses derivative Einsetzen der Exekutive als sachkenntlicher und sachnaher Normengesetzgeber eine Durchbrechung des Gewaltenteilungsgrundsatzes aus Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG stattfindet.[17] Aufgrund dieser Problematik ist es verfassungsrechtlich unabdingbar, dass der absolute Vorrang des Gesetzes im Verhältnis zur Rechtsverordnung gewahrt bleibt und es zu keiner Kompetenzverschiebung hin zum Verordnungsgeber kommt.[18] Dies ist eine Ausformung der Wesentlichkeitsrechtsprechung des BVerfG, nachdem alle wesentlichen Entscheidungen für die Gesellschaft, speziell hinsichtlich der Bestimmung der Schranken bei widerstreitenden Freiheitsgarantien, vom parlamentarischen Gesetzgeber in einem formellen Gesetz zu normieren sind.[19]
Im Wortlaut: Art. 80 Abs. 1 Grundgesetz
(1) Durch Gesetz können die Bundesregierung, ein Bundesminister oder die Landesregierungen ermächtigt werden, Rechtsverordnungen zu erlassen. Dabei müssen Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten Ermächtigung im Gesetze bestimmt werden. Die Rechtsgrundlage ist in der Verordnung anzugeben. Ist durch Gesetz vorgesehen, daß eine Ermächtigung weiter übertragen werden kann, so bedarf es zur Übertragung der Ermächtigung einer Rechtsverordnung.
So statuiert der Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG ein sogenanntes „modalitätenbezogenes Delegationsverbot“, bei dem sich die Sachmaterie und der Sachgegenstand (Inhalt), die Grenzen der Ermächtigung (Ausmaß) und das verfolgte Ziel der gesetzlichen Grundlage (Zweck) als Ausdruck des gesetzgeberischen Willens immer aus dem Gesetz selbst ergeben muss und nicht dem Verordnungsgeber überlassen werden darf.[20] Das BVerfG hingegen versteht unter Berücksichtigung des Telos des Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG das Bestimmtheitsgebot in seiner Rechtsprechungspraxis als einen einheitlichen Begriff, dessen Anforderungen sich nach dem konkreten Regelungsgegenstand, dem Adressatenkreis und der Intensität des Eingriffes in Abhängigkeit vom jeweiligen Grundrecht richten, sodass bei der Auslegung des Wortlautes: „Inhalt“, „Ausmaß“, „Zweck“ keine eindeutige Abgrenzung erfolgen kann.[21]
a) Der Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG und die Verordnungsermächtigung im formellen Gesetz
Das BVerfG stellt bei der Auslegung der in Betracht kommenden Ermächtigungsgrundlage nicht nur auf den Gesetzeswortlaut der spezifischen Norm ab, sondern nimmt Bezug auf die allgemeinen Auslegungsgrundsätze, die sich aus dem gesamten Gesetz ergeben können.[22] So sind auch Generalklauseln und unbestimmte Rechtsbegriffe als Instrumente zulässig, soweit durch Auslegung des gesamten Zwecks des Gesetzes das gesetzgeberische Programm ersichtlich ist.[23]
Die Grenze der Bestimmtheitsanforderungen ist jedoch im Ergebnis dann überschritten, wenn Inhalt, Ausmaß und Zweck nicht mehr prognostizierbar sind und der Regelungsinhalt der Rechtsverordnung nicht mehr anhand der Ermächtigungsgrundlage für den Bürger ersichtlich ist.[24] Die Ermächtigungsnorm selbst bedarf im Ergebnis somit einer Überschaubarkeit und einer prognostizierbaren Tendenzwirkung bezüglich etwaiger zu regelnder Anwendungsfälle in der Zukunft.[25]
So ist anhand der entwickelten Merkmale der Wesentlichkeitsrechtsprechung des BVerfG zu konstatieren, dass bei einem erheblichen Eingriff in die Rechtsstellung eines Adressaten durch eine behördliche Verfügung höhere Anforderungen an den Bestimmtheitsgrad der Ermächtigungsgrundlage zu stellen sind und somit in der Konsequenz eine hohe Steuerungsdichte durch das formelle Gesetz einzufordern ist.[26]
b) Besonderheiten beim Bestimmtheitsgebot bei der Umsetzung von Unionsrecht
Bei der Umsetzung von Unionsrecht, insbesondere von Richtlinien durch nationale Rechtsverordnungen, werden verschiedene Ansichten vertreten, inwiefern abgeschwächte Anforderungen an den Bestimmtheitsgrad der Ermächtigungsgrundlage zu stellen sind.[27] Das zentrale Beurteilungskriterium für den Umfang des Regelungsinhaltes der Verordnungsermächtigung ist jedoch nach einhelliger Ansicht in dem verbleibenden Gestaltungsspielraum für den nationalen Gesetzgeber zu sehen, sodass nur bei voll determiniertem Unionsrecht, wie z. B. oft im Umweltrecht in der Vergangenheit geschehen, abgeschwächte Anforderungen an den Wortlaut der Verordnungsermächtigung gerechtfertigt werden können.[28]
Eine generelle Lockerung der Maßstäbe beim Bestimmtheitsgebot wird in der Literatur bei der Umsetzung von europäischem Recht aber kritisch gesehen, sodass auch in diesem Kontext die oben genannten Grundsätze des Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG weiterhin ihre Gültigkeit besitzen.[29]
Im Ergebnis ändert sich deshalb im vorliegenden Fall auf den ersten Blick nichts an den Wertungen bezüglich der Verordnungsermächtigungen der §§ 38 Abs. 1 IfSG i. V. m. § 55 IfSG. Es bedarf vielmehr einer ganzheitlich systematischen Auslegung der Normen im Infektionsschutzgesetz unter Berücksichtigung der Detailtiefe der EU-Trinkwasserrichtlinie (2020/2184) und deren Umsetzung in der nationalen TrinkwV, um eine Aussage darüber treffen zu können, ob dem Bestimmtheitsgebot in einer Gesamtschau der nationalen und europäischen Regelungsmaterie entsprochen wird und inwiefern der nationale Gesetzgeber gegebenenfalls einen eigenen Gestaltungsspielraum im Verordnungstext der TrinkwV normiert hat.
Der Beitrag wird fortgesetzt.
[1] Siehe einführend zur Delegationssicherung bei dynamischen Steuerungsaufgaben: Martini, Normsetzung und andere Formen exekutivischer Selbstprogrammierung, in: Voßkuhle/Eifert/Möllers (Hrsg.), GVwR II³, § 33, Rn. 31.
[2] Überschrift aus dem Artikel vom 22.11.2023 auf der Webseite des SWR, https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/mannheim/kreis-warnt-vor-giftigem-harz-in-leitungen-100.html (aufgerufen am 28.07.2024).
[3] Vgl. ebd.
[4] Siehe allgemein zur Rechtsfähigkeit der WEG Suilmann, in: Bärmann, WEG Kommentar, 15. Aufl. 2023, § 9 a WEG, Rn. 4–6; zur Klassifizierung von Versorgungsleitungen als Gemeinschaftseigentum siehe BGH, Urt. v. 26.10.2012 – V ZR 57/12 – Entscheidungsgründe 10 und 11.
[5] https://www.bund.net/themen/chemie/hormonelle-schadstoffe/bisphenol-a/trinkwasserleitungen/, (aufgerufen am 29.07.2024).
[6] Zum behördlichen Vorgehen des Gesundheitsamt Rhein-Neckar-Kreis siehe: https://www.cvua-stuttgart.de/docs/CVUAS_Bisphenol_A_in_Trinkwasser_Poster.pdf (aufgerufen am 14.08.2024); Hinweis auf E-Mail-Korrespondenz mit dem Gesundheitsamt Freudenstadt vom 02.08.2024.
[7] https://www.bfr.bund.de/cm/343/bisphenol-a-bfr-schlaegt-gesundheitsbasierten-richtwert-vor-fuer-eine-vollstaendige-risikobewertung-werden-aktuelle-expositionsdaten-benoetigt.pdf , S. 1 (aufgerufen am 28.07.2024).
[8] Ebd.
[9] Nietner, Bisphenol A im Trinkwasser – Ein Problem nach Sanierung von Hausinstallationen mit Epoxidharz, https://www.ua-bw.de/pub/beitrag.asp?subid=0&Thema_ID=2&ID=3817&Pdf=No&lang=DE, erschienen am 25.07.2024 (aufgerufen am 29.07.2024).
[10] Ebd.
[11] Ebd.
[12] Vgl. stellvertretend die Bezugnahme auf Studien des Japanese National Institute of Advanced Industrial Sience and Technology (AIST) und der U.S. Food and Drug Adminstration (FDA) in: Analysis of bisphenol-propane in dialyzer and its effect on human body, Materials Express 13 (2023), 170, 171.
[13] Vgl. zum behördlichen Vorgehen die Hinweise des Rhein-Neckar-Kreises und des CVUA Stuttgart, https://www.cvua-stuttgart.de/docs/CVUAS_Bisphenol_A_in_Trinkwasser_Poster.pdf (aufgerufen am 14.08.2024).
[14] Mann, in: Sachs, Grundgesetz, 9. Aufl. 2021, Art. 80, Rn. 1.
[15] Vgl. Wortlaut TrinkwV (2023), BGBI. 2023 Abs. 1 Nr. 159 Satz 1.
[16] Krämer-Hoppe, in: Krießling, IfSG Kommentar, 3. Aufl. 2022, § 38, Rn. 7.
[17] Wolff, in: Kahl/Ludwigs, HVwR V, 2023, § 153, Rn. 12; zur Durchbrechung des Gewaltenteilungsgrundsatzes siehe Brenner, in: Huber/Voßkuhle, GG, 8. Aufl. 2024, Art. 80, Rn. 11.
[18] Ossenbühl, Rechtsverordnung, in: HStR V, ³2007, § 103, Rn. 17.
[19] Zur Wesentlichkeitsdoktrin in seinen Einzelheiten siehe stellvertretend BVerfG, Urt. v. 19.09.2018 – 2 BvF 1/15 – juris, Rn. 194–196.
[20] Bauer, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, Bd. II, 3. Aufl. 2015, Art. 80, Rn. 32 und 33; BVerfG, Urt. v. 19.09.2018 – 2 BvF 1/15 – juris, Rn. 200.
[21] Ebd.; zur Auslegung des Wortlautes siehe BVerfGE 38, 348, 357; vgl. stellvertretend zur st. Rspr. hinsichtlich der Eingriffsintensität BVerfGE 86, 288, 311, und zum Adressatenkreis BVerfGE 86, 288, 317.
[22] BVerfG, Beschl. v. 12.11.1958 – 2 BvL 4/56 – juris, Rn. 134.
[23] Wolff, in: Kahl/Ludwigs, HVwR V, 2023, § 153, Rn. 49; BVerfGE 48, 210 (222); 58, 257 (277); 106, 1 (19).
[24] Sannewald, in: Schmidt-Bleibtreu, GG Kommentar, 13. Aufl. 2014, S. 1962, Rn. 59; vgl. auch BVerfGE 1, 14, 60; 2, 307, 334; 55, 207, 226; BVerfG-K, NVwZ 2009, 906, Rn. 14 und Rn. 15.
[25] Vgl. Ausführungen bei Saurer, Rechtsverordnungen zur Umsetzung europäischen Richtlinienrechts, JZ 2007, 1073, 1074; grundlegend auch BVerfG, Urt. v. 23.10.1951 – 2 BvG 1/51 – juris, Rn. 152.
[26] Martini, Normsetzung und andere Formen exekutivischer Selbstprogrammierung, in: Voßkuhle/Eifert/Möllers, GVwR II³, § 33, Rn. 36; BVerfGE 58, 257–283, juris, Rn. 63.
[27] Für abgeschwächte Bestimmtheitsanforderungen: Calliess, Die verfassungsrechtliche Zulässigkeit von fachgesetzlichen Rechtsverordnungsermächtigungen, NVwZ 1998, 12.
[28] Remmert, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Dezember 2013 Lfg. 70, Art. 80, Rn. 116; vgl. zu den vage gefassten Verordnungsermächtigungen im Umweltrecht Saurer, Rechtsverordnungen zur Umsetzung europäischen Richtlinienrechts, JZ 2007, 1073.
[29] Wolff, in: Kahl/Ludwigs, HVwR V, 2023, § 153, Rn. 56.