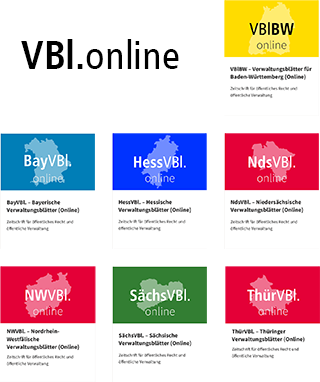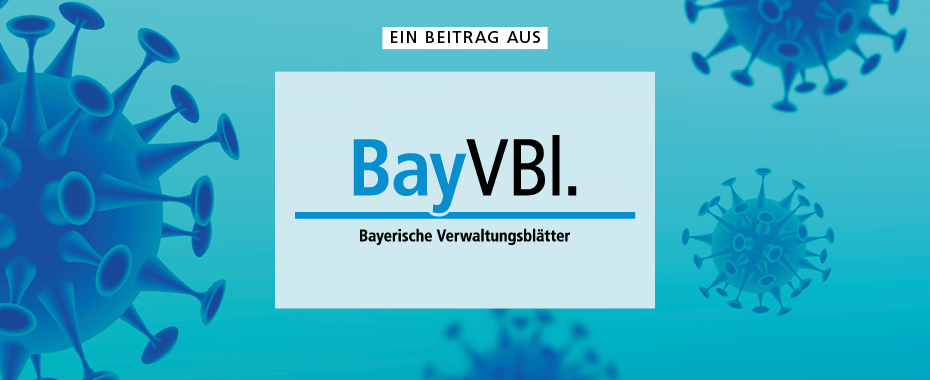Die schlichte Schiebeanordnung als neue Erscheinung des Verfassungsprozessrechts
Beschluss des BVerfG vom 26. März 2021
Die schlichte Schiebeanordnung als neue Erscheinung des Verfassungsprozessrechts
Beschluss des BVerfG vom 26. März 2021
Mit Beschluss vom 26. März 2021 hat das BVerfG1 angeordnet, dass das Gesetz zum Beschluss des Rates vom 14. Dezember 2020 über das Eigenmittelsystem der Europäischen Union und zur Aufhebung des Beschlusses 2014/335/EU, Euratom (Eigenmittelbeschluss- Ratifizierungsgesetz – ERatG)2 bis zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung durch den Bundespräsidenten nicht ausgefertigt wird.
I. Ausgangslage
Dieser Beschluss hat sich durch die einstweilige Anordnung vom 15. April 2021 erledigt, indem der Eilantrag abgelehnt wurde3. Adressat des Beschlusses war unausgesprochen der Bundespräsident, der für die Ausfertigung von Gesetzen gemäß Art. 82 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 GG zuständig ist. Der Beschluss war eine so genannte Schiebeanordnung (oder Hängebeschluss)4. Das sind Beschlüsse, mit denen die Schaffung vollendeter Tatsachen während eines einstweiligen Rechtsschutzverfahrens in Verfassungsstreitigkeiten gemäß § 32 BVerfGG bis zum Ergehen einer regulären Entscheidung über den Antrag gemäß § 32 BVerfGG verhindert werden soll5, das heißt ein „Eil-Eil-Rechtsschutz“6.
II. Das Novum eines förmlichen Hängebeschlusses im Verfassungsprozess
Hängebeschlüsse sind in der Verwaltungsgerichtsbarkeit nicht unüblich7, insbesondere bei asyl- und ausländerrechtlichen Abschieberechtsschutzverfahren und bei Beamtenkonkurrentenstreitigkeiten. Im Verfassungsstreitverfahren sind sie sehr selten8. Wobei man sich über die Qualifizierung einer Entscheidung im Rahmen von § 32 BVerfGG als „Schiebeanordnung“ oft streiten kann9. Ob eine „reguläre“ Entscheidung im Rahmen von § 32 BVerfGG oder nur eine Schiebeanordnung vorliegt, lässt sich oft nur aus dem Kontext durch Auslegung erkennen10.
Entscheidend ist, ob durch den Beschluss der Sache nach die Hauptsacheentscheidung (dann reguläre Entscheidung nach § 32 BVerfGG) oder eine Entscheidung gemäß § 32 BVerfGG (dann Schiebeanordnung) gesichert werden soll, das heißt aus der Perspektive des Spruchkörpers als Nächstes mit einer Entscheidung in der Hauptsache oder mit einer Entscheidung gemäß § 32 BVerfGG zu rechnen ist. Letzteres ist dann anzunehmen, wenn die Entscheidung so kurz befristet ist, dass nicht wirklich mit Ergehen der Hauptsacheentscheidung zu rechnen ist11 oder wenn ausdrücklich auf eine nachfolgende Entscheidung gemäß § 32 BVerfGG verwiesen wird12 oder wenn die angegriffene Entscheidung noch nicht abgesetzt ist oder noch nicht dem BVerfG vorgelegt wurde13. Die bisher ergangenen Schiebeanordnungen waren, soweit ersichtlich, alle Beschlüsse, die mit einer Begründung versehen waren. Eilkonstellationen, in denen noch nicht einmal Zeit für eine kurze Begründung der Eilentscheidung war, wie bei der vom 26. März 2021, gab es natürlich auch bisher schon. Dies wurde aber anders gelöst, und zwar durch eine informelle Bitte des Gerichts gegenüber der betroffenen staatlichen Stelle, der in aller Regel nachgekommen wurde14.
Der Entscheidung vom 14. Mai 1996 zu Art. 16a GG konnte man zwischen den Zeilen den Hinweis des Gerichts entnehmen, dass es seine damalige ausgreifende Praxis mittels Telefonanrufe drohende Abschiebungen vorläufig zu unterbinden, zurückfahren wollte15. Im vorliegenden Fall wählte das Gericht den offiziellen Weg, über die Gründe kann man nur spekulieren. Die Bedeutung der Sache, die gegebenenfalls zu erwartende Dauer des Hauptsacheverfahrens, vermuteter Unmut im Bundespräsidialamt oder die möglichen Implikationen in den internationalen Beziehungen könnten das BVerfG motiviert haben.
III. Die Zulässigkeit von Hängebeschlüssen
Schiebeanordnungen haben im BVerfGG keine ausdrückliche Grundlage16, so wie die Hängebeschlüsse im Verwaltungsprozessrecht keine Grundlage in der VwGO haben17. Formal kann man sie zwar auf § 32 BVerfGG stützen, weil sie eine einstweilige Regelung zum Inhalt haben, materiell sind sie es aber nicht, weil sie nicht auf dem von § 32 BVerfGG der Sache nach vorausgesetzten Mindestmaß an tatsächlicher Grundlage und oder substanzieller Abwägung beruhen18. Aus der fehlenden Regelung im BVerfGG wird man nicht ihre Unzulässigkeit folgern können, vielmehr folgt aus der gesetzlichen Anerkennung der Möglichkeit des Erlasses einer einstweiligen Anordnung gemäß § 32 BVerfGG und aus dem Sinn der Einräumung von Verfassungsrechtsschutz, dass in Ausnahmefällen eine förmliche Absicherung des einstweiligen Rechtsschutzes möglich sein muss19. Die Begründung ist beim Verfassungsprozess, auch bei der Verfassungsbeschwerde, allerdings schwächer als beim Verwaltungsprozess, bei dem man zur Rechtfertigung der Hängebeschlüsse Art. 19 Abs. 4 GG heranziehen kann20, der in stärkerem Maße effektiven Rechtsschutz fordert als Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG21. Die Begründung trägt dennoch. Zudem ist insbesondere anerkannt, dass das Bundesverfassungsgericht im einstweiligen Rechtsschutz nach § 32 BVerfGG die notwendigen Anordnungen treffen kann, die zur Sicherung der Hauptsacheentscheidung geboten sind, ohne dass diese Anordnung auch in der Hauptsache möglich wäre, solange es die Hauptsache nicht vorwegnimmt22.
Entsprechend spricht für die Zulässigkeit des Hängebeschlusses, dass es so erst recht möglich sein muss, dass das Gericht einen solchen erlässt, um überhaupt eine Entscheidung im Eilverfahren und dann entsprechend in der Hauptsache treffen zu können. Für die Zulässigkeit eines Hängebeschlusses ist von Bedeutung, dass das verfassungsgerichtliche Verfahren keine aufschiebende Wirkung entfaltet23. Hängebeschlüsse sind daher auch im verfassungsprozessualen Verfahren zulässig, auch wenn dies bisher selten diskutiert wurde. Sie sollen die Zeitspanne zwischen dem Eingang des Antrags auf vorläufigen Rechtsschutz und der Eilentscheidung des Gerichts überbrücken und verhindern, dass bis dahin durch gewisse Handlungen vollendete Tatsachen geschaffen werden. Unabdingbare Voraussetzung für den Erlass einer verfassungsgerichtlichen Zwischenverfügung ist die noch fehlende Entscheidungsreife im vorläufigen Rechtsschutzverfahren. Sie ergehen in Situationen, in denen eine reguläre Entscheidung nach § 32 BVerfGG noch nicht erlassen werden kann, entweder weil die Tatsachengrundlage dafür, trotz zügigen Handelns der Rechtsschutzsuchenden24, noch nicht geklärt ist oder weil der Spruchkörper noch keine Zeit hatte, die von § 32 BVerfGG erforderliche Abwägungsentscheidung zu fällen. Ersteres kann insbesondere deshalb vorliegen, weil die angegriffene Entscheidung noch nicht vorliegt oder deren Gründe noch nicht bekannt sind25.
Zweiteres kann gegeben sein, weil die entscheidungserheblichen Rechtsfragen noch nicht hinreichend überschaubar sind oder das Gericht im Zuge der Gewährung rechtlichen Gehörs die Antwort eines Beteiligten auf eine Rückfrage abwarten möchte26. Voraussetzung 4für eine Schiebeanordnung sind daher zunächst die Gründe des § 32 BVerfGG27 sowie zusätzlich noch substanzielle Gründe dafür, nicht so lange zuzuwarten, bis die Voraussetzungen für eine reguläre Entscheidung nach § 32 BVerfGG vorliegen. Es müssen daher, wie im Verwaltungsprozess28 auch im Verfassungsprozess, erstens der Eintritt irreparabler Folgen drohen, zweitens der Erlass einer Entscheidung im einstweiligen Verfahren nicht rechtzeitig genug erreichbar sein und drittens, die Abwägung zugunsten der Rechtsschutzinteressen ausfallen29. Dies ist ausgeschlossen, wenn die rechtsschutzsuchende Person (bei den subjektiv-rechtlichen Verfahren) nicht alle ihr zumutbaren Mittel genützt hat, um eine rechtzeitige Entscheidung gemäß § 32 BVerfGG zu ermöglichen30. Üblich, aber nicht zwingend ist die ausdrückliche zeitliche Befristung31 einer Schiebeanordnung32 und oder der Verweis auf seine auflösende Bedingtheit durch eine folgende Entscheidung gemäß § 32 BVerfGG.
IV. Die Zulässigkeit im vorliegenden Fall
Ob die Voraussetzungen einer Schiebeanordnung im vorliegenden Fall vorlagen, lasst sich wegen der fehlenden Begründung nur beschränkt beurteilen. Verfahrensgegenstand der Verfassungsbeschwerde und des Antrages auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ist das Eigenmittelbeschluss-Ratifizierungsgesetz. Dabei handelt es sich um das deutsche Zustimmungsgesetz zum Beschluss (EU, Euratom) 2020/2053 des Rates vom 14. Dezember 2020 über das Eigenmittelsystem der Europäischen Union und zur Aufhebung des Beschlusses 2014/335/EU, Euratom33. Dieser Beschluss basiert auf der Einigung der Staats- und Europäischen Rates vom 17. bis 21. Juli 202034. Er setzt die Schlussfolgerungen um, die die Einnahmeseite des dort beschlossenen Finanzpakets betreffen. Der Beschluss verfolgt zwei Ziele. Zum einen soll das Finanzierungssystem der Union reformiert werden, ein politisch eher unumstrittenes Anliegen, für das mit dem Austritt des Vereinigten Königreichs gegenwärtig ein guter Zeitpunkt vorliegt35.
Weiter soll der Beschluss aber auch eine europäische Strategie zur Bewältigung der absehbaren Folgen der Corona-Pandemie verfolgen36, die, so der Gesetzgeber, „die Mitgliedstaaten vor eine historische Herausforderung stellt“37. Die Eigenmittelfinanzierung des EU-Haushalts wird angepasst mit dem Ziel, die Berechnung der Anteile etwas zu vereinfachen und eine angemessenere Lastenteilung in der Finanzperiode 2021 bis 2027 zu erreichen38. Weiter wird neben den bestehenden traditionellen Eigenmitteln, die insbesondere bestehen39 aus Zöllen, dem Anteil am Mehrwertsteueraufkommen der Mitgliedstaaten40 und den BNE-Eigenmitteln41 (wird finanziell am bedeutendsten sein) eine neue Eigenmittelkategorie in Form einer so genannten Plastik-Abgabe eingeführt. Weiter wird zur Finanzierung des Aufbauinstrumentes des Konjunkturpakets Next-Generation-EU auf der Basis von Art. 122 AEUV die Europäische Kommission ermächtigt, Mittel bis zu einem Betrag von 750 Mrd. Euro und mit einer Laufzeit von bis zum 31. Dezember 2058 aufzunehmen, um die unmittelbaren wirtschaftlichen und sozialen Schäden der Corona- Pandemie zu beheben. Die generierten Mittel sollen jeweils hälftig zur Gewährung von rückzuzahlenden Darlehen und einseitigen Zuschüssen zur Unterstützung von Reformen und Investitionen in den Ländern der Europäischen Union eingesetzt werden42. Die Rückzahlung der Kredite, die zur Finanzierung von Ausgaben aufgenommen wurden, erfolgt aus dem EU-Haushalt. Der deutsche Gesetzgeber schätzt die auf Deutschland zukommenden Verpflichtungen im Jahr 2021 auf 38 Mrd. Euro und einer Steigerung in den nächsten sechs Jahren auf 43,1 Mrd. Euro, wobei er betont, die Lasten nicht genau abschätzen zu können43. Eigenmittelbeschlüsse des Rates ergehen gemäß Art. 311 Abs. 3 AEUV in einem besonderen Gesetzgebungsverfahren einstimmig und nach Anhörung des Europäischen Parlaments und treten erst nach Zustimmung der Mitgliedstaaten im Einklang mit ihren jeweiligen verfassungsrechtlichen Vorschriften in Kraft. Im Umkehrschluss heißt dies, dass mit Wirksamkeit des deutschen Zustimmungsgesetz Deutschland keine staatlichen Einflussmöglichkeiten mehr auf das Wirksamwerden des Beschlusses (EU, Euratom) 2020/2053 hat, sodass der Eintritt irreparabler Umstände droht, wenn das Gesetz in Kraft tritt.
Die erste Voraussetzung für eine Schiebeanordnung war gegeben, ebenso die zweite, da das BVerfG noch nicht über den Antrag gemäß § 32 BVerfGG entschieden hatte. Da der Deutsche Bundestag über das deutsche Zustimmungsgesetz erst am 25. März 2021 mehrheitlich (unter Ablehnung der AfD-Fraktion und Enthaltung der Fraktion DIE LINKE) entschied44 und das BVerfG am 26. März 2021 auf einen Eilantrag vom 22. März 2021 hin seinen Schiebeanordnung fasste, beruht das Fehlen des Beschlusses im Sinn von § 32 BVerfGG auch nicht auf einer Nachlässigkeit des Gerichts. Bei der Abwägung zwischen dem Rechtsschutzinteresse einerseits und dem Vollzugsinteresse andererseits wird man zumindest sagen können, dass angesichts der Langfristigkeit der mit dem Eigenmittelbeschluss, insbesondere mit Blick auf die gestattete Kreditaufnahme, eingegangen Verpflichtungen, die verfassungsrechtliche Zulässigkeit eines solchen Beschlusses der Union wenigstens in dem Maße sichergestellt sein sollte, wie es durch ein summarisches Verfahren im Rahmen eines einstweiligen Verfahrens gemäß § 32 BVerfGG möglich ist. Die Schiebeanordnung erging daher verfahrensrechtlich korrekt.
V. Die Bedeutung der Schiebeanordnung für den weiteren Verfahrensverlauf
Ergehen einstweilige Beschlüsse, drängt sich immer die Frage auf, inwieweit diese Indizien für den Ausgang des Hauptsacheverfahrens darstellen. Unstreitig ist bei Prognosen dieser Art Vorsicht geboten. Allerdings kann der Erlass einer Maßnahme im einstweiligen Rechtsschutzverfahren generell zumindest nicht als Indiz für die Erfolglosigkeit des Rechtsschutzverfahrens gedeutet werden. Aber auch die Annahme eines Erfolges derselben wäre – wie die spätere Ablehnung des Antrags gemäß § 32 BVerfGG zeigt – vorschnell gewesen, dafür war die Schiebeanordnung prozessual noch zu früh. In der Sache wurde mit dem Beschluss vom 26. März 2021 noch nicht einmal das vorletzte Wort für das Hauptsacheverfahren gesprochen45. Die Entscheidung im Eilrechtschutz wurde gut drei Wochen später am 15. April 2021 getroffen, wobei der Eilantrag abgelehnt wurde46. Die Entscheidung in der Hauptsache steht noch aus. Der Umstand, dass der Beschluss ohne Begründung veröffentlich wurde, legte die Annahme nahe, das Gericht habe auf die Vorläufigkeit besonders hinweisen wollen. Der Beschluss sollte dem Gericht nur etwas Zeit verschaffen, um über den Antrag in der Eilentscheidung entscheiden zu können, ohne durch die Unterzeichnung durch den Bundespräsidenten vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden. Dies erklärt auch, weshalb die Schiebeanordnung am 26. März 2021 erlassen wurde, bloß einen Tag nachdem der Bundestag für das Eigenmittelratifizierungsgesetz gestimmt hatte. Die Schiebeanordnung bildete daher kein Indiz für den Ausgang der Entscheidung über den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung47.
VI. Beschluss vom 15. April 2021 (2 BvR 547/21)
Der Erlass der einstweiligen Anordnung bedurfte etwas Zeit, da er eine belastbare Abwägungsentscheidung erforderte, angesichts seiner Bedeutung. Jede Verzögerung der Umsetzung der Kreditaufnahme und der Hilfeleistung der Europäischen Union hätte ganz erhebliche wirtschaftliche Folgen gehabt. Mit Beschluss vom 15. April 2021 hat das BVerfG das dargestellte Vorbringen der Beschwerdeführer zumindest als nicht offensichtlich durchgreifend angesehen und den Eilantrag konsequent abgelehnt48. Dabei wurde jedoch weniger ein Ultravires Handeln der EU als eine Verletzung der Verfassungsidentität (Art. 79 Abs. 3 GG) geprüft, wobei nach einer summarischen Prüfung eine offensichtliche Verletzung nicht festgestellt werden konnte49. Zunächst halt das BVerfG dabei fest, dass noch nicht feststeht, ob sich aus dem Demokratieprinzip eine justiziable Begrenzung der Übernahme von Zahlungsverpflichtungen erwachst, wobei jedoch ohnehin nur äußerst evidente Verstoße erfasst sein durften, nachdem dem Gesetzgeber ein weiter Einschätzungsspielraum insbesondere mit Blick auf die Haushaltsfreiheit zusteht50.
Gegen einen Verstoß gegen die Verfassungsidentität wird sodann angeführt, dass Deutschland grundsätzlich nicht, sondern nur in Ausnahmefallen und dann auch grundsätzlich nur pro rata, unmittelbar für die Aufnahme der 750 Milliarden Euro haften werde. Überdies spreche gegen einen Verstoß, dass Hohe, Dauer und Zweck der aufzunehmenden Mittel ebenso begrenzt sind wie eine mögliche Haftung Deutschlands51. Ob ein Verstoß gegen Art. 79 Abs. 3 GG vorliegt, sei letztendlich eine Entscheidung der Hauptsache, sodass das Gericht dann in eine allgemeine Folgenabwägung übergeht52. Diese fuhrt im Ergebnis zur Ablehnung des Eilantrags, da die Nachteile einer einstweiligen Anordnung bei unterstellter Erfolglosigkeit der Hauptsache die Nachteile im umgekehrten Falle überwiegen. Diese Einschätzung wird darauf gestützt, dass eine Verzögerung des Inkrafttretens des Eigenmittelbeschlusses 2020 dessen oben dargestellte Ziele gefährden konnte, diese Verfehlung sich zudem als irreversibel herausstellen konnte und eine Verzögerung zu außenpolitischen Verwerfungen fuhren konnte53. VII. Der weitere Verfahrensverlauf Das Hauptverfahren selbst wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Anrufung des EuGH im Hauptsacheverfahren zwecks Auslegung des Art. 122 AEUV durfte naheliegen, zumindest sofern man einen Verfassungsverstoß ernsthaft für möglich halt. Alles Weitere der Hauptsache wird man abwarten müssen. Das BVerfG hat in seinem EZB-Beschluss vom 5. Mai 2020, 2 BvR 859/15 belegt54, dass es gewillt und in der Lage ist, die Einhaltung der Integrationsschranken des Art. 23 GG praxiswirksam zu kontrollieren und insbesondere die Verantwortlichkeit der Mitgliedstaaten für ihre eigene Haushaltswirtschaft, die mit fehlendem Charakter der EU als Finanzunion umschrieben wird, ernst nimmt. Bei der Entscheidung vom 15. April 2021 auf die Folgenabwägung abzustellen, war sachlich richtig, weil der Ausgang des Verfassungsbeschwerdeverfahrens nicht eindeutig ist. Ob das deutsche Zustimmungsgesetz die Grenzen des Art. 23 Abs. 1 GG einhält, bedarf zumindest einer ins Detail gehenden Untersuchung. Die Verfassungsbeschwerde, von prominenten Einzelpersonen eingelegt55 und getragen von dem Bündnis Bürgerwille, begründet den behaupteten Verfassungsverstoß zum einen mit Vorliegen eines „Ultra-vires-Akt“ im Sinn von Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG i. V. m. dem Zustimmungsgesetz zum Lissabon-Vertrag und zum anderen mit einem Verstoß des Identitätsvorbehalts des Art. 23 Abs. 1 Satz 3 i. V. m. Art. 79 Abs. 3 i. V. m. Art. 20 GG56.
Liegt eine Verletzung der Integrationsschranken des Art. 23 Abs. 1 GG vor, kann der Burger über die Verfassungsbeschwerde eine Mitwirkung beziehungsweise eine unzureichende Verhinderung dieser Verletzung durch deutsche Verfassungsorgane im Rahmen derer Integrationsverantwortung mittels der Verfassungsbeschwerde rügen. Eine Verletzung der Ultra-vires-Grenze liegt vor, wenn die EU-Organe auf hinreichend qualifizierte und strukturell bedeutsame Weise ihre Kompetenzen überschritten haben. Das Vorliegen des Ultra-vires-Aktes scheint zunächst mit dem Argument begründet zu werden, dass Eigenmittelbeschlusse nicht gleichzeitig Kreditaufnahmebeschlusse sein durften. Gerügt wird der faktische Eingriff in eine Fiskalunion, die so nicht von Art. 311 AEUV getragen werde. Der Eigenmittelbeschluss verstoße gegen das Unionsprinzip, dass die Mitgliedstaaten nicht wechselseitig für ihre jeweiligen Verbindlichkeiten einstehen müssen und in ihrer Finanzpolitik eigenverantwortlich handeln können. Ob diese enge Auslegung des Art. 311 AEUV Erfolg haben wird, durfte eher zweifelhaft sein57. Eine weite Auslegung des Begriffs der Eigenmittel58 lasst die Zulässigkeit von begrenzten Fremdmitteln durchaus zu. Ob das Ausmaß der Fremdmittel allerdings noch von dem System des Art. 311 AEUV gedeckt ist, insbesondere die Aufgabe der Obergrenze der Eigenmittel ist nicht ganz so sicher, da eine grenzenlose Kreditaufnahme kaum legitimiert sein durfte59. Weiter sei ein „Ultra-vires‛‛-Akt auch deshalb gegeben, weil der Beschluss (EU, Euratom) 2020/2053 nicht die Voraussetzung für eine wirtschaftspolitische Hilfeleistungen von Mitgliedstaaten für die dann ausnahmsweise zulässige Kreditaufnahme erfülle. Nach Art. 122 Abs. 2 AEUV kann der Rat auf Vorschlag der Kommission beschließen, einem Mitgliedstaat unter bestimmten Bedingungen einen finanziellen Beistand der Union zu gewahren, sofern dieser aufgrund von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Ereignissen, die sich seiner Kontrolle entziehen, von Schwierigkeiten betroffen oder von gravierenden Schwierigkeiten ernstlich bedroht ist. Beim Vorliegen dieser Voraussetzungen kann der Rat dem Mitgliedstaat finanziellen Beistand gewahren.
Art. 122 Abs. 2 AEUV bestimmt nicht näher, in welcher Form dieser Beistand zu gewahren ist. Denkbar sind deshalb alle möglichen Formen finanzieller Hilfeleistung60. Ebenso wenig wie Art. 143 AEUV kann Art. 122 Abs. 2 AEUV zur Finanzierung solcher finanziellen Hilfen durch die Begebung von Anleihen durch die Union selbst ermächtigen. Eine entsprechende Kompetenz steht der Union nicht zu61. Art. 122 Abs. 2 AEUV stellt auch keine Grundlage für einen Finanzausgleich dar, wie ihn in Deutschland Art. 107 Abs. 2 GG vorsieht62. Die Corona-Pandemie ist zwar an sich ein außergewöhnliches Ereignis, ob Maßnahmen zur Konjunkturbelebung, wie sie mit den Mitteln ermöglicht werden sollen, aber noch Aufbauinstrumente als Reaktion auf außergewöhnliche und gravierende wirtschaftliche Schwierigkeiten aufgrund von Naturkatastrophen sind, durfte zumindest fraglich sein. Entscheidend durfte die aus Art. 122 AEUV gebotene Zweckbindung63 des Eigenmittelbeschlusses sein. Die unionsrechtlich verfolgten Aufbauinstrumente sind nur mittelbar auf die Überwindung der Corona-Folgen gerichtet. Die Bundesregierung selbst plant, 37 % der Zuweisungen der Europäischen Union für den Klimaschutz und 20 % für Digitalisierung zu verwenden64. Die Europäische Union hat insoweit ersichtlich keine Bedenken, obwohl der Klimaschutz nicht unmittelbar durch die Corona-Pandemie ausgelost ist65.
Der Identitätsvorbehalt des Art. 23 Abs. 1 Satz 3 GG i. V. m. Art. 79 Abs. 3 GG schützt unter anderem die haushaltspolitischen Gesamtverantwortung des Deutschen Bundestags, die zumindest dann verletzt ist, wenn der Deutsche Bundestag durch eine Maßnahme der Europäischen Union seine parlamentarischen Haushaltsverantwortung insoweit verliert, dass er das Budgetrecht künftig nicht mehr eigenverantwortlich ausüben kann oder unabsehbare Risiken eingeht, etwa weil er für Willensentscheidungen Dritter mit schwer kalkulierbaren Folgen mithaften konnte. Das Vorliegen einer Verletzung des Identitätsvorbehalts scheint mit dem Argument behauptet zu werden, der Deutsche Bundestag könne die eingegangenen Haushaltsverpflichtungen nicht überblicken und übernehme zudem unzulässig die Verantwortung für Haushaltsentscheidungen der Parlamente anderer Mitgliedstaaten. Der Hinweis in der Gesetzesbegründung, die haushälterischen Folgen seien nicht wirklich uberblickbar66, und eine entsprechende Warnung des Bundesrechnungshofes67 sprechen zumindest eher für als gegen dieses Argument. Das Haftungsvolumen und die Haftungsdauer sind schon ungewöhnlich. Entscheidend dürfte sein, wie überschaubar das BVerfG die Risiken für den Deutschen Bundestag einschätzen wird.
VII. Schluss
Die Schiebeanordnung vom 26. März 2021 bestätigt eine alte und eine neue Erkenntnis aufs Neue. Die erste Erkenntnis ist, dass das BVerfG sein Prozessrecht selbstbewusst und wirksam fortbildet und handhabt, sofern dies erforderlich erscheint. Die zweite ist, dass es gewillt ist, für den Mitgliedstaat Deutschland den Charakter, dass die Mitgliedstaaten die „Herren der Verträge“ oder auch die „Damen der Verträge“ sind, auch Wirklichkeit werden zu lassen und die Integrationsschranken des Art. 23 GG auch gegenüber der Europäischen Union – in der gebotenen unionsfreundlichen Weise – in Stellung zu bringen, wenn deren Voraussetzung seiner Meinung nach gegeben sein könnten und es mehr Zeit benötigt, dies zu beurteilen. Die verfahrensrechtliche Bedeutung hat die Schiebeanordnung durch den Erlass der ablehnenden Entscheidung im Sinn von § 32 BVerfGG verloren, seine dogmatische Bedeutung als ein klarer Fall einer verfahrenssichernden Schiebeanordnung ohne Begründung bleibt.
Besprochen in BayVBl. 11/2021.
1 BVerfG, B.v. 26.03.2021 – 2 BvR 547/21 – BayVBl. 2021, 378; s. www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/03/rs20210326_2bvr054721.html.
2 BT-Drs. 19/26821.
3 BVerfG, B.v. 15.04.2021 – 2 BvR 547/21, s. www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/bvg21-029.html.
4 S. dazu BayVBl. 2021, 378, s. auch Krull, Der „Hängebeschluss“ im System des vorläufigen Rechtsschutzes der Verwaltungsgerichtsordnung, 2016, S. 37 f.; Graßhof in Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge, BVerfGG, Stand Juli 2002, Rn. 107; Berkemann in Umbach/Clemens/Dollinger, BVerfGG, 2 Aufl. 2005, § 32 Rn. 417.
5 Berkemann (o. Fn. 4), Rn. 417.
6 Riedl, Der Corona-Aufbaufonds, die Fiskalunion und das Bundesverfassungsgericht, Verfassungsblock vom 27.03.2021, https://verfassungsblog.de/der-corona-aufbaufonds-die-fiskalunion-und-das-bundesverfassungsgericht/.
7 Ausführlich Guckelberger, Zulässigkeit und Anfechtbarkeit verwaltungsgerichtlicher Hängebeschlüsse, NVwZ 2001, 275 ff.
8 In diese Richtung auch Höltschi, EU-Aufbaufonds: Das Bundesverfassungsgericht streut deutschen Sand ins Getriebe, NZZ 26.03.2021, abrufbar unter: www.nzz.ch/wirtschaft/bundesverfassungsgericht-stopptvorerst-eu-corona-aufbaufonds-ld.1608834.
9 Zuletzt abgelehnt: BVerfG, B.v. 12.03.2021; dazu: Redaktion beck-aktuell: becklink 2019226. BVerfG, B.v. 18.12.2003 – 2 BvQ 70/03 dürfte ebenfalls keine Schiebeanordnung sein, sondern eine einstweilige Anordnung; a. A. Merten, NVwZ 2004, 1078 f.
10 Genannt werden in der Literatur Graßhof (o. Fn. 4) Rn. 107 und Berkemann (o. Fn. 4) Rn. 417 vor allem BVerfGE 85, 127/128; BVerfGE 88, 185/186; und ferner BVerfGE 76, 253; BVerfGE 77, 130/133 und dazu noch BVerfGE 104, 38/39; BVerfG, EuGRZ 1998, 448; BVerfG, NVwZ 1996, Beilage 2, 9 (nur bei Berkemann [o. Fn.4] Rn. 417).
11 BVerfGE 76, 253 ff.; BVerfG, NVwZ 1996, Beilage 2, 9.
12 BVerfGE 88, 185/187; BVerfG, NVwZ 1996, Beilage 2, 9; Krull, „Hängebeschluss“ (o. Fn. 4) 2016, S. 37.
13 BVerfGE 88, 185/186.
14 Schneider in Burkiczak/Dollinger/Schorkopf (Hrsg.), BVerfGG, 2015, § 32 Rn. 29; Berkemann (o. Fn. 4), Rn. 417; Krull, „Hangebeschluss“ (o. Fn. 4) 2016, S. 38.
15 BVerfG, U.v. 14.05.1996 – 2 BvR 1516/93 – BVerfGE 94, 166, 215 ff.
16 Krull, „Hangebeschluss“ (o. Fn. 4) 2016, S. 37.
17 Guckelberger (Fn. 7), NVwZ 2001, 275/276.
18 Krull, „Hangebeschluss“ (o. Fn. 4) 2016, S. 37; in der Sache vergleichbar Graßhof (o. Fn.4) Rn. 107.
19 So ist die Zulassigkeit von Schiebeanordnungen allgemein anerkannt – s. Nachweise in Fn. 4).
20 BVerfG, B.v. 11.10.2013 – 1 BvR 2616/13 – NVwZ 2014, 363.
21 BVerfG, U.v. 14.05.1996 – 2 BvR 1516/93 – BVerfGE 94, 166/215 ff.; BVerfG, B.v. 13.03.2003 – 2 BvQ 3/03 – juris Rn. 17; Schneider in Burkiczak/ Dollinger/Schorkopf (Hrsg.), BVerfGG, 2015, § 32 Rn. 28 kritisch dazu Barczak in Barczak, BVerfGG, 2018 § 32, Rn. 4.
22 BVerfGE 31, 381/385; Graßhof in Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge BVerfGG (60. EL Juli 2020), § 32 Rn. 167.
23 Walter in BeckOKBVerfGG (10. Ed. Stand 01.01.2021), § 32 Rn. 7.
24 Ist ein substanziellerer Sachvortrag, als der dem Antrag zugrunde liegende, dem Betroffenen moglich, ergeht keine Schiebeanordnung – BVerfG, NVwZ 1996, Beilage 2, 9; Krull, „Hangebeschluss“ (o. Fn. 4) 2016, S. 38.
25 Roeser, EuGRZ 1996, 132/144.
26 Guckelberger (Fn. 7), NVwZ 2001, 275/276.
27 Krull, „Hangebeschluss“ (o. Fn. 4) 2016, S. 37;
28 Schoch in Schoch/Schneider VwGO (39. EL Juli 2020), § 47, Rn. 182a.
29 Graßhof (o. Fn.4) Rn. 107.
30 Krull, „Hangebeschluss“ (o. Fn. 4) 2016, S. 37; Roeser, EuGRZ 1996, 132/144.
31 BVerfGE 77, 130/133: Erwahnt Schiebeanordnung von vier Wochen; BVerfGE 76, 253: ein Monat; BVerfG, NVwZ 1996, Beilage 2, 9: zwei Wochen.
32 Strenger (immer erforderlich zumindest ublich) Graßhof (o. Fn.4) Rn. 107.
33 EU ABl. L 424/1.
34 BT-Drs. 19/26821 S. 1.
35 Art. 2 – 4, Art. 7 – 9 Beschluss (EU, Euratom) 2020/2053.
36 Art. 5 – 7 Beschluss (EU, Euratom) 2020/2053.
37 BT-Drs. 19/26821 S. 1.
38 BT-Drs. 19/26821 S. 1.
39 Art. 2 Abs. 1 lit. a) Beschluss (EU, Euratom) 2020/2053.
40 Art. 2 Abs. 1 lit b) Beschluss (EU, Euratom) 2020/2053.
41 Art. 2 Abs. 1 lit d), Abs. 3 Beschluss (EU, Euratom) 2020/2053.
42 S. genauer BT-Drs 19/27838 S. 2.
43 BT-Drs. 19/26821 S. 3.
44 Vgl. Höltschi, NZZ (Fn. 8).
45 Riedl (Fn. 6).
46 BVerfG, B.v. 15.04.2021 – 2 BvR 547/21, s. https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/bvg21-029.html.
47 Vglb. Höltschi, NZZ (Fn. 8).
48 BVerfG, B.v. 15.04.2021 – 2 BvR 547/21, s. https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/bvg21-029.html.
49 BVerfG, B.v. 15.04.2021 – 2 BvR 547/21, s. https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/bvg21-029.html; ausgeschlossen wird es ebenfalls nicht, da das BVerfG es auch für möglich erachtet, dass die „Ermächtigung der Europäischen Kommission zur Aufnahme von 750 Milliarden Euro auf dem Kapitalmarkt über die in Art. 311 Abs. 3 AEUV enthaltene Ermächtigung hinausgeht“.
50 BVerfG, B.v. 15.04.2021 – 2 BvR 547/21, s. https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/
bvg21-029.html.
51 BVerfG, B.v. 15.04.2021 – 2 BvR 547/21, s. https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/bvg21-029.html.
52 BVerfG, B.v. 15.04.2021 – 2 BvR 547/21, s. https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/bvg21-029.html.
53 BVerfG, B.v. 15.04.2021 – 2 BvR 547/21, s. https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/bvg21-029.html.
54 S. dazu Stürmer/Wolff, BayVBl. 2020, 549.
55 U.a. von Bernd Lucke, der die AfD bekanntlich mitgründete, aus dieser aber wegen deren Wandel 2015 austrat.
56 Vgl. Bündnis Bürgerwille, Inhalt der Verfassungsbeschwerde, abrufbar unter: https://buendnis-buergerwille.de/verfassungsbeschwerde.
57 So auch Riedl (Fn. 6).
58 S. zum Begriff ausführlich: Waldhoff in Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 5. Aufl. 2016, Art. 311 Rn. 7; Niedobitek in Streinz, EUV/AEUV, 3. Aufl. 2018, Art. 311 Rn. 12 f.
59 Vgl. Waldhoff in Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 5. Aufl. 2016, Art. 311 Rn. 17; offen Niedobitek in Streinz, EUV/AEUV, 3. Aufl. 2018, Art. 311 Rn. 28.
60 Häde in Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 5. Aufl. 2016, Art. 122, Rn. 9.
61 Häde in Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 5. Aufl. 2016, Art. 143, Rn. 9.
62 Häde in Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 5. Aufl. 2016, Art. 122, Rn. 9.
63 S. dazu Kempen in Streinz, EUV/AEUV, 3. Aufl. 2018, Rn. 12.
64 BT-Drs 19/27838 S. 2.
65 Kritisch insoweit auch Riedl (Fn. 6).
66 S.o. Fn. 45.
67 Vgl. NZZ, EU-Corona-Fonds: Der deutsche Rechnungshof sieht hohe Risiken für Bundeshaushalt, 11.03.2021, abrufbar unter www.nzz.ch/wirtschaft/eu-corona-fonds-der-deutsche-rechnungshof-sieht-hoherisiken-fuer-bundeshaushalt-ld.1606247?reduced=true.