Gesetz zur Digitalisierung baurechtlicher Verfahren
Neue Regelungen zur Einreichung von Bauanträgen und Angrenzerbenachrichtigung - Teil 2
Gesetz zur Digitalisierung baurechtlicher Verfahren
Neue Regelungen zur Einreichung von Bauanträgen und Angrenzerbenachrichtigung - Teil 2

c) Kenntnisgabeverfahren
In Kenntnisgabeverfahren ist vorgesehen, dass die Baurechtsbehörde innerhalb von fünf Arbeitstagen dem Bauherrn elektronisch in Textform den Zeitpunkt mitteilt, zu dem die Bauvorlagen vollständig sind (§ 53 Abs. 5 LBO). Die gesetzliche Vorgabe ist aber nur umsetzbar, wenn die Baurechtsbehörde Kenntnis von den elektronischen Zugangsdaten des Bauherrn hat. Eine Verpflichtung des Bauherrn, einen „digitalen Briefkasten“ einzurichten und vorzuhalten, sehen das Onlinezugangsgesetz oder die Landesbauordnung nicht vor. Den Baurechtsbehörden bleibt bis zur Einführung eines digitalen Serviceportals durch das Land daher nur, den Bauherren schriftlich – oder falls er seine Telefonnummer angegeben hat – telefonisch um die elektronischen Kontaktdaten zu bitten, falls solche existieren.
Die Gemeinde soll der Baurechtsbehörde nach § 53 Abs. 6 Satz 2 LBO „unverzüglich“ mitteilen, ob ein Ausschlussgrund nach § 53 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 bis 4 vorliegt, z. B. weil die Erschließung des Vorhabens nicht gesichert ist oder eine hindernde Baulast besteht. Diese Verpflichtung kann die Gemeinde indes nur erfüllen, wenn sie Kenntnis von den Bauvorlagen bzw. dem Bauvorhaben hat. Da die Bauvorlagen aber nicht mehr bei ihr, sondern bei der Baurechtsbehörde einzureichen sind, ist ungewiss, wann und wie die Gemeinde diese Kenntnis tatsächlich erlangt. Allein die vorgesehene unverzügliche „Bereitstellung“ der Bauvorlagen durch die Baurechtsbehörde (§ 53 Abs. 1 Satz 4 LBO) dürfte jedenfalls dann nicht genügen, wenn die Gemeinde davon nichts erfährt, z. B. bei bloßer Einstellung der Bauvorlagen in ein behördliches Onlineportal. Dann wäre aber auch nicht gesichert, dass die Baurechtsbehörde dem Bauherrn etwaige von der Gemeinde mitzuteilende Ausschlussgründe i. S. d. § 53 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 bis 4 LBO innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Einreichung der Bauvorlagen mitteilt, wie dies nunmehr in § 53 Abs. 6 Satz 2 LBO vorgesehen ist.
d) Vollständigkeitsmitteilung im Baugenehmigungsverfahren
Wie auch im Kenntnisgabeverfahren hat die Baurechtsbehörde im Baugenehmigungsverfahren dem Bauherrn elektronisch in Textform den Zeitpunkt des Eingangs des vollständigen Antrags mitzuteilen. Außerdem muss sie den Bauherrn in gleicher Form den Zeitpunkt des Ablaufs der zweimonatigen Frist nach § 54 Abs. 5 LBO für die Entscheidung über den Bauantrag unterrichten (§ 54 Abs. 2 Nr. 1 LBO). Die Übergangsvorschrift des § 77 Abs. 5 LBO befreit die Baurechtsbehörde von der Verpflichtung, die elektronische Textform zu verwenden, nicht. Liegen der Baurechtsbehörde aber die digitalen Kontaktdaten des Bauherrn nicht vor, stellen sich die gleichen Probleme wie im Kenntnisgabeverfahren (siehe 2. c)).
e) Angrenzerbenachrichtigung
Obwohl der Titel des „Gesetzes zur Digitalisierung baurechtlicher Verfahren“ keinen Hinweis auf eine sonstige Verfahrensänderung enthält, ist die Angrenzerbenachrichtigung mit dem neuen § 55 Abs. 1 Satz 1 LBO weitgehend abgeschafft. Nur noch dann, wenn eine AAB von einer Vorschrift des öffentlichen Baurechts erteilt werden soll, die auch dem Schutz des Nachbarn dient, hat die Gemeinde auf Veranlassung und nach Maßgabe der Baurechtsbehörde die Eigentümer angrenzender Grundstücke (Angrenzer) innerhalb von fünf Arbeitstagen ab dem Eingang der vollständigen Bauvorlagen über das Bauvorhaben zu benachrichtigen.
aa) Die Neuregelung stellt eine tiefgreifende Veränderung der bisherigen Gesetzeslage dar.1Der Städtetag Baden-Württemberg hat – soweit ersichtlich erstmalig – von seinem Recht nach § 50 a Abs. 6 der Geschäftsordnung des Landtags von Baden-Württemberg v. 16.10.2019 (GBl. S. 429) Gebrauch gemacht, vor dem Ausschuss für Landesentwicklung und Wohnen unmittelbar Stel-lung zu nehmen. In der Sache hat er die Neuregelung der Nachbarbeteili-gung detailliert kritisiert, LT-Drs. 17/5635, S. 2 ff. Die Angrenzerbenachrichtigung im bisherigen Umfang hat im süddeutschen Raum lange Tradition, hat sich in der Praxis gut bewährt und ist auch im Rechtsdenken der Bevölkerung verwurzelt. Sie dient nicht allein nachbarlichen Belangen, sondern erfüllt zugleich die behördliche Pflicht zur Aufklärung des entscheidungserheblichen Sachverhalts (§ 24 Abs. 1 LVwVfG). Die Angrenzerbenachrichtigung auf AAB von nachbarschützenden Vorschriften des öffentlichen Baurechts zu reduzieren, ist für die Zielsetzung der Beschleunigung baurechtlicher Verfahren kontraproduktiv und wird zu erheblichen Risiken bei den Bauherren sowie zusätzlichen Verfahren nebst Unsicherheiten für Bauvorhaben führen. Es ist auch nicht ersichtlich, weshalb gerade die mit dem Gesetz angestrebte Digitalisierung des baurechtlichen Verfahrens eine weitgehende Abschaffung der Angrenzerbenachrichtigung erfordern könnte. Ohne die bisherige Benachrichtigung erhält der Angrenzer gerade mit Beginn des Verwaltungsverfahrens keine Kenntnis von dem Bauvorhaben. Er wird regelmäßig mögliche Bedenken und Einwendungen nicht frühzeitig äußern können. Den Bauherren und den Baurechtsbehörden wird die Möglichkeit genommen, Bedenken zu prüfen und zur Vermeidung von (nachbar-)rechtswidrigen Baugenehmigungen den Bauantrag weiterzuentwickeln. Bauherren werden künftig entweder erst durch die Bekanntgabe der Baugenehmigung oder möglicherweise sogar erst durch den Baubeginn mit dem Bauvorhaben konfrontiert. Sie werden daher vermehrt vorsorglich Rechtsbehelfe einlegen und Eilrechtschutz in Anspruch nehmen müssen.215 Insbesondere die Kommunalen Landesverbände, die Regierungspräsidien, Haus & Grund Baden sowie Haus & Grund Württemberg haben entspre-chende Befürchtungen geäußert, LT-Drs. 17/5422, S. 10 A. 2.
bb) Ob eine Vorschrift auch dem Schutz des Nachbarn dient, ist auch für die Baurechtsbehörden nicht in jedem Fall mit der objektiven Eindeutigkeit feststellbar, wie sie für die Anwendung einer solchen Verfahrensvorschrift nötig ist. Mag der Nachbarschutz bei einzelnen bauordnungsrechtlichen Vorschriften, wie etwa über Abstandsflächen, noch ohne Weiteres feststellbar sein, ist dies etwa bei Festsetzungen in Bebauungsplänen über die Bauweise oder die überbaubare Grundstücksfläche keineswegs immer eindeutig, sondern bedarf näherer Auslegung, zu der es zweckmäßig ist, auch eventuell betroffene Angrenzer anzuhören. Sie werden künftig jedoch nur noch dann im Wege der Angrenzerbenachrichtigung angehört, wenn die zuständige Baurechtsbehörde die betreffende Vorschrift als nachbarschützend bewertet. Hinzu kommt, dass die Reichweite nachbarschützender „Vorschriften des öffentlichen Baurechts“ unklar ist. Sollten damit alle von der Baurechtsbehörde zu prüfenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften (vgl. § 58 Abs. 1 Satz 1 und 2 LBO) gemeint sein, hätte zur Vermeidung von Missverständnissen auf diesen Prüfungsumfang verwiesen werden können, anstatt ihn mit einem anderen Begriff zu umschreiben. Sollte mit dem Begriff „öffentliches Baurecht“ jedoch nur ein Teil der nach § 58 Abs. 1 Satz 1 und 2 LBO zu prüfenden Vorschriften gemeint sein, hätte er mangels hinreichender Bestimmbarkeit näher definiert werden sollen. So ist insbesondere unklar, ob der Begriff „öffentliches Baurecht“ auch solche „anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften“ i. S. d. § 29 Abs. 2 BauGB erfasst, die über bauordnungsrechtliche Regelungen hinaus Anforderungen an ein Bauvorhaben stellen, wie z. B. Vorschriften im Umweltrecht.
Erfahren Angrenzer von den Bauabsichten, könnte der weit-gehende Verzicht auf ihre Anhörung zu einem Bauvorhaben mittels der bisherigen Angrenzerbenachrichtigung im Gegenzug vermehrt zu Anträgen auf ermessensfehlerfreie Entscheidung über ihre Hinzuziehung als Beteiligter nach § 13 Abs. 2 Satz 1 LVwVfG mit entsprechendem Mehraufwand und ggf. sogar gesondert zulässigen16 Rechtsbehelfen im Falle der Ablehnung führen.
cc) Gravierend ist der mit dem Verzicht auf die regelmäßige Angrenzerbenachrichtigung einhergehende Wegfall der Präklusion. Angrenzer sind nicht mehr – wie bisher – mit Einwendungen ausgeschlossen, die sie nicht innerhalb von vier Wochen seit Zustellung ihrer Benachrichtigung vom Bauantrag erhoben haben. Sie können auch noch deutlich nach Erteilung der Baugenehmigung sowie nach Baubeginn und teilweise sogar bis zur Rohbaufertigstellung Einwendungen gegen das Bauvorhaben wegen Verletzung nachbarschützender Vorschriften erheben und in verwaltungsgerichtlichen (Eil-)Rechtschutzverfahren vorbringen. Der Bauherr erfährt erst nach der Genehmigungserteilung und teilweise nach Baubeginn von solchen Einwendungen des Angrenzers, die in dieser späten Phase des Projekts geprüft und in begründeten Fällen berücksichtigt werden müssen, um einen Baustopp zu vermeiden. Umplanungen mit entsprechenden Kosten für den Bauherrn sind sehr wahrscheinlich. Der Aufwand geht deut-lich über die bisher vorgesehenen regelmäßigen Benachrichtigungen der Angrenzer hinaus, die im Übrigen Baugenehmigungsverfahren nicht verzögern. Die Angrenzerbenachrichtigung erfolgte bisher parallel zur weiteren Bearbeitung des Bauantrags und der Bauvorlagen. Selbst wenn eine Verzögerung von vier Wochen eintreten würde, überwöge das Interesse des Bauherrn an einer möglichen Präklusion sowie an der für ihn eintretenden Rechtssicherheit und der Vermeidung von Rechtsbehelfs- und Rechtsmittelverfahren.
dd) Ohne regelmäßige Angrenzerbenachrichtigung wird die Anzahl der Widerspruchsverfahren und der verwaltungsgerichtlichen (Eil-)Verfahren voraussichtlich deutlich zunehmen. Angrenzer haben erst in diesen weiteren Verfahren die Möglichkeit, ihre Argumente vorzutragen und gehört zu werden. Gerade bei den Einwänden, ein Bauvorhaben verletze das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme mit seiner den Nachbar schützenden Wirkung, wird nicht früher reagiert werden können, weil die Angrenzerbenachrichtigung auf Anträge für AAB begrenzt ist. Verletzungen des Rücksichtnahmegebots werden aber bei Rechtsbehelfen der Angrenzer in der Praxis ganz überwiegend und vor allem nicht nur in Bezug auf AAB gerügt.
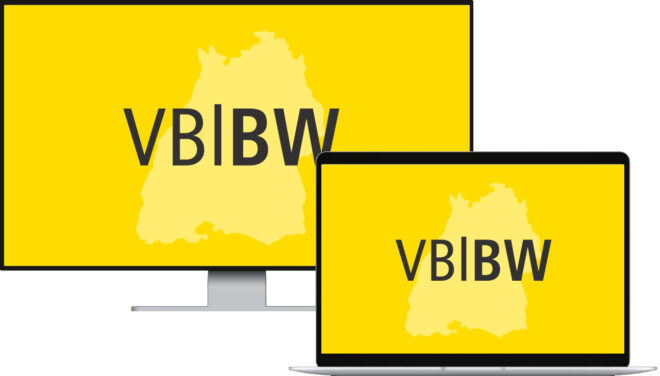 ee) Der Aufwand für Widerspruchs- und Verwaltungsgerichtsverfahren wird deutlich steigen, weil ohne eine mögliche Präklusion nicht nur die rechtzeitig vorgebrachten Einwendungen geprüft werden müssen, sondern alle Einwendungen, die bis zum Abschluss der mündlichen Verhandlung erhoben werden. Die Laufzeiten der Widerspruchs- und Verwaltungsgerichtsverfahren werden zunehmen. Weiteres Personal wird erforderlich sein. Zusätzliche Kosten für die Landeskasse werden entstehen.
ee) Der Aufwand für Widerspruchs- und Verwaltungsgerichtsverfahren wird deutlich steigen, weil ohne eine mögliche Präklusion nicht nur die rechtzeitig vorgebrachten Einwendungen geprüft werden müssen, sondern alle Einwendungen, die bis zum Abschluss der mündlichen Verhandlung erhoben werden. Die Laufzeiten der Widerspruchs- und Verwaltungsgerichtsverfahren werden zunehmen. Weiteres Personal wird erforderlich sein. Zusätzliche Kosten für die Landeskasse werden entstehen.
ff) Bisher hatte die Baurechtsbehörde die Möglichkeit, neben den Angrenzern auch sonstige Eigentümer benachbarter Grundstücke vom Bauvorhaben zu benachrichtigen, deren öffentlich-rechtlich geschützte nachbarlichen Belange berührt sein konnten (§ 55 Abs. 1 Satz 3 LBO a. F.). Gerade bei schwieriger Nachbarschaft, komplexen Projekten oder innovativen Vorhaben war diese Möglichkeit in der Praxis von großer Bedeutung. Der Bauherr konnte anregen, sofern die Gemeinde nicht bereits von sich aus tätig war, den sonstigen Nachbarn zu informieren, damit auch dessen Einwendungen möglichst frühzeitig vorgetragen wurden und im Übrigen –soweit nicht geprüft – nach Fristablauf ausgeschlossen waren. Der Bauherr erhielt dadurch frühzeitig die für ihn wichtige Rechtssicherheit. Mit der Reduzierung der Nachbarbenachrichtigung auf beabsichtigte AAB-Entscheidungen von nach-barschützenden Vorschriften des öffentlichen Baurechts stellt sich die Frage, ob die Baurechtsbehörde Angrenzer oder sonstige Nachbarn auch sonst weiterhin vom Bauvorhaben benachrichtigen darf und ob hierdurch die Präklusionswirkung des § 55 Abs. 2 LBO begründet werden könnte. Das erscheint zweifelhaft. Grundsätzlich ermittelt die Behörde den entscheidungserheblichen Sachverhalt zwar einzelbezogen von Amts wegen (§ 24 LVwVfG). Das schließt die Möglichkeit ein, nicht am Verfahren beteiligte Dritte anzuhören, die in ihren rechtlichen Interessen berührt sein könnten. Für das baurechtliche Genehmigungsverfahren enthält § 55 Abs. 1 LBO insoweit allerdings eine spezielle Regelung, die eine Anhörung sonstiger Dritter von Amts wegen in anderen als den von § 55 Abs. 1 LBO erfassten Fällen (beabsichtigte AAB-Entscheidung von nachbarschützenden Vorschriften des öffentlichen Baurechts) ausschließt. Sie könnte als eine der Amtsermittlung nach § 24 LVwVfG insoweit „entgegenstehende Bestimmung“ im Sinne des § 1 Abs. 1 LVwVfG verstanden werden. Hierfür spricht, dass der Landesgesetzgeber die Angrenzerbenachrichtigung auf die Fälle beabsichtigter AAB-Entscheidungen von nachbarschützenden Vorschriften des öffentlichen Baurechts beschränkt und zugleich die Möglichkeit abgeschafft hat, sonstige Nachbarn von Amts wegen anzuhören (§ 55 Abs. 1 Satz 3 LBO a. F.). Als Korrektiv ist die Verpflichtung eingeführt, die Baugenehmigung auch sonstigen Nachbarn zuzustellen oder nach Maßgabe des § 9 Abs. 1 OZG bekanntzugeben, deren öffentlich-rechtlich geschützte nachbarliche Belange durch das Vorhaben berührt sein können (§ 58 Abs. 1 Satz 7 LBO).17 Diese Systematik spricht dagegen, eine Anhörung sonstiger Dritter von Amts wegen mit der Folge einer Präklusion nach § 55 Abs. 2 LBO noch als zulässig anzusehen.
gg) Soweit ein Nachbar oder Angrenzer bisher mit dem ge-planten Bauvorhaben einverstanden war, konnte er die Bauvorlagen unterschreiben, die der Baurechtsbehörde vorgelegt wurden. Wenn die Bauvorlagen nur noch elektronisch in Textform eingereicht werden dürfen, stellt sich die Frage, wie der Nachbar bei Bedarf seine Zustimmung erklären kann. Grundsätzlich wird die Unterschrift im elektronischen Rechtsverkehr durch eine „qualifizierte“ elektronische Signatur ersetzt. Da bloß die Textform vorgeschrieben ist (§ 55 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 LBO), ist eine lesbare Erklärung ausreichend, in der die Person des Erklärenden genannt ist (keine Unterschrift), die auf einem dauerhaften Datenträger abgegeben werden muss, der frei gewählt werden kann (§ 126 b BGB).
ii) Die Gemeinde hat (nur) auf Veranlassung und nach Maßgabe der Baurechtsbehörde die Angrenzer zu benachrichtigen (§ 55 Abs. 1 Satz 1 LBO). Die Auswahl der zu benachrichtigenden Angrenzer ist daher Aufgabe der Baurechtsbehörde. Eine Benachrichtigung ist nicht erforderlich bei Angrenzern, die eine Zustimmungserklärung „in Textform“ abgegeben oder die Bauvorlagen unterschrieben haben oder durch das Vorhaben offensichtlich nicht berührt werden (§ 55 Abs. 1 Satz 2 LBO). Nach der Gesetzesbegründung ist die „Missbrauchs-/Fälschungsgefahr“ äußerst gering.18
Zwischenergebnis: Die weitgehende Abschaffung der An-grenzerbenachrichtigung ähnelt § 70 der Musterbauordnung (MBO)19 und den Regelungen in 14 anderen Bundesländern, hat aber offensichtlich keinen Zusammenhang mit dem Zweck des Gesetzes, das Baugenehmigungsverfahren zu digitalisieren. Der Gesetzgeber ist der Auffassung, die Änderung diene insgesamt einer deutlichen Beschleunigung baurechtlicher Verfahren, indem eine Benachrichtigung der Angrenzer nur erfolgt, wenn diese in ihren schutzwürdigen Rechten tan-giert sein können.20 Er übersieht dabei jedoch, dass Nachbarrechte auch ohne eine AAB-Entscheidung mit Erteilung einer Baugenehmigung tangiert sein können, z. B. bei der Verletzung des bauplanungsrechtlichen Gebietserhaltungsanspruchs oder des Gebots der gegenseitigen Rücksichtnahme. Insoweit möglicherweise betroffene Dritte werden künftig nicht mehr über das eingeleitete Verwaltungsverfahren benachrichtigt. Der Gesetzgeber scheint den Eindruck zu haben, dass Angrenzerbenachrichtigungen nur zu lästigen Ergebnissen und zu Verzögerungen führen. In der Praxis hat jedoch die Nachbarbenachrichtigung häufig dazu geführt, die Baurechtsbehörde auf Sachverhalte aufmerksam zu machen, die sich aus dem Bauantrag und den Bauvorlagen nicht ergaben, für die Anwendung des geltenden Rechts aber von Bedeutung waren. Der Bauherr hatte die Möglichkeit, in einer relativ frühen Phase des Baugenehmigungsverfahrens zu entscheiden, ob er seine Planung ändert und auf Einwendungen oder rechtliche Hindernisse reagiert. Für den Bauherrn war die alte Gesetzeslage daher vorteilhafter, weil sie ihm frühzeitig Klarheit darüber verschaffte, ob und welche Einwendungen benachrichtigte Nachbarn erheben. Der damit verbundene Zeitgewinn wird durch die Neuregelung zunichte gemacht.
f) Einwendungen
Einwendungen dürfen nur noch elektronisch in Textform oder zur Niederschrift vorgebracht werden (§ 55 Abs. 2 Satz 1 LBO). Eine bloß schriftliche Einwendung ist nicht mehr zulässig. Die Übergangsvorschrift des § 77 Abs. 5 LBO gilt hier nicht.
g) Präklusion
Die weitgehende Abschaffung der Angrenzerbenachrichtigung hat auch eine erhebliche Einschränkung der materiellen Präklusion der Angrenzereinwendungen zur Folge. Hatte ein auf die materielle Präklusion hingewiesener Angrenzer bisher innerhalb der Vierwochenfrist keine oder unvollständige Einwendungen erhoben, war er insoweit mit seinen Einwendungen ausgeschlossen. Die Baurechtsbehörde und der Bauherr konnten im Verfahren relativ früh Klarheit gewinnen, ob und welche Einwendungen beachtlich sind. Da künftig Angrenzer nur noch zu benachrichtigen sind, wenn eine AAB-Entscheidung von nachbarschützenden Vorschriften des öffentlichen Baurechts beabsichtigt ist, kann nur diesen Angrenzern gegenüber die materielle Präklusion eintreten, vorausgesetzt sie wurden ordnungsgemäß nach § 55 Abs. 2 Satz 3 LBO belehrt. Da der Gesetzgeber die Benachrichtigung und damit auch die Präklusionswirkung nicht auf die AAB-Entscheidung reduziert hat, ist der benachrichtigte Angrenzer gehalten, sich ggf. zu dem Bauvorhaben insgesamt zu äußern und entsprechende Einwendungen zu erheben, sofern seine Rechte verletzt sein könnten. Anderenfalls wäre er damit präkludiert.
Nicht benachrichtigte Angrenzer oder Nachbarn können mit ihren Einwendungen nicht präkludiert sein, so dass sie die Möglichkeit haben, mit fristgerechtem Rechtsbehelf gegen die Baugenehmigung vorzugehen und ihre Einwendungen zu einem späteren Zeitpunkt vorzutragen.
h) Erteilung der Baugenehmigung
Die mit dem Genehmigungsvermerk versehenen Bauvorlagen sind dem Antragsteller mit der Baugenehmigung zuzustellen oder nach Maßgabe des § 9 Abs. 1 OZG bekannt zu geben (§ 58 Abs. 1 Satz 6 LBO). Es reicht daher nicht, nur den „reinen“ Bescheid zuzustellen. Hat der Bauherr nicht die Einwilligung nach § 9 Abs. 1 OZG erteilt und kein digitales Nutzerkonto, hat die Baurechtsbehörde nur die Möglichkeit, die mit Genehmigungsvermerk versehenen Bauvorlagen mit der Baugenehmigung zuzustellen. Soweit Bauanträge elektronisch eingereicht werden, muss die Baurechtsbehörde die Baugenehmigung und sämtliche Bauvorlagen ausdrucken. Für Baurechtsbehörden bedeutet dies einen nicht unerheblichen Aufwand. In der Regel werden sie nicht über entsprechende Plotter oder Drucker verfügen, die nunmehr angeschafft werden müssen. Die Richtigkeit der Annahme des Gesetzgebers, es würden nur geringe Druck-, Versand- und Personalkosten in der Verwaltung entstehen,21 ist zweifelhaft.
Wegen der eingeschränkten Angrenzerbenachrichtigung ist die Baugenehmigung aber nicht nur den benachrichtigten Angrenzern, sondern auch sonstigen Nachbarn zuzustellen oder nach Maßgabe des § 9 Abs. 1 OZG bekannt zu geben, deren öffentlich-rechtlich geschützte nachbarlichen Belange durch das Vorhaben berührt sein können (§ 58 Abs. 1 Satz 7 LBO). Die Baurechtsbehörde muss daher prüfen und entscheiden, ob es nicht benachrichtigte Angrenzer oder sonstige Nachbarn gibt, deren öffentlich-rechtlich geschützten nachbarlichen Belange durch das Vorhaben berührt sein können. Die Beurteilung ist nicht einfach. Teilweise gibt es ausführliche Rechtsprechung, teilweise ist z. B. bei Festsetzungen von Bebauungsplänen eine detaillierte Prüfung erforderlich, ob die jeweilige Festsetzung nachbarschützenden Charakter hat. Gerade bei vorhabenbedingten Immissionen können im Einzelfall zahlreiche Nachbarn in ihren durch das Gebot der Rücksichtnahme geschützten nachbarlichen Belangen berührt sein.
Stellt die Baurechtsbehörde einem Angrenzer oder sonstigen Nachbarn die Baugenehmigung entgegen § 58 Abs. 1 Satz 7 LBO nicht zu oder gibt sie ihm die Baugenehmigung nicht nach § 9 Abs. 1 OZG bekannt, kann die Baugenehmigung insoweit nicht in Bestandskraft erwachsen. Ein nicht benachrichtigter Angrenzer oder sonstiger Nachbar hat unter Berücksichtigung der Maßgaben von Treu und Glauben weiterhin die Möglichkeit, einen Rechtsbehelf gegen die Baugenehmigung zu erheben. Jedenfalls für den Bauherrn kann im Vergleich zur früheren Angrenzerbenachrichtigung erst vergleichsweise spät der Widerstand eines Dritten bekannt werden. Sollte er berechtigt sein, wird eine Änderung des Bauvorhabens erhebliche Kosten und möglicherweise einen Amtshaftungsanspruch gegen die Baurechtsbehörde auslösen.
3. Ergebnis
Der Zweck des Gesetzes, Baugenehmigungsverfahren zu digitalisieren, ist zu begrüßen. Mit der elektronischen Textform ist eine wichtige Voraussetzung geschaffen worden. Bestimmten Besonderheiten wie den Vorhaben nach § 43 Abs. 5 LBO hat der Gesetzgeber aber ebenso wenig Rechnung getragen wie dem Defizit, dass die Bauherren in aller Regel noch keinen „digitalen Briefkasten“ i. S. v. § 9 OZG besitzen. Der weitgehenden Einschränkung der Angrenzerbenachrichtigung liegt auf den ersten Blick eine nachvollziehbare Motivation zugrunde. Bei genauer Betrachtung hatte die Angrenzerbenachrichtigung in Baden-Württemberg aber nicht nur eine lange Tradition, sondern war von erheblichem Vorteil für Bauherren und Baurechtsbehörden.
Bereits in einer frühen Phase des Verfahrens konnte durch die materielle Präklusion Rechtssicherheit geschaffen werden. Berechtigte Einwendungen ermöglichten der Baurechtsbehörde rechtmäßige Entscheidungen und dem Bauherrn Rechtssicherheit, nicht im weiteren Verfahren mit Rechtsbehelfen überzogen zu werden. Baden-Württemberg hat sich weitgehend der Musterbauordnung und den Regelungen in zahlreichen anderen Bundesländern angenähert. Allerdings ist nicht immer das Niveau der Mehrheit das richtige Ergebnis. Es bleibt zu hoffen, dass der Gesetzgeber Anregungen der beteiligten Verbände und betroffenen Kreise künftig intensiver prüft und berücksichtigt. Auch wenn es wünschenswert ist, wird der Gesetzgeber bei den bereits geplanten weiteren Änderungen der Landesbauordnung wohl keine (notwendige) Korrektur vornehmen. Es bleibt aber zu hoffen, dass künftige Änderungen weniger Aufwand und Rechtsunsicherheit zur Folge haben werden. Die nächste Änderung der Landesbauordnung durch ein „Gesetz zum schnelleren Bauen“ ist schon in Planung.
Der Beitrag entstammt den Verwaltungsblättern Baden-Württemberg 04/2024, Seite 33
----------
- 1Der Städtetag Baden-Württemberg hat – soweit ersichtlich erstmalig – von seinem Recht nach § 50 a Abs. 6 der Geschäftsordnung des Landtags von Baden-Württemberg v. 16.10.2019 (GBl. S. 429) Gebrauch gemacht, vor dem Ausschuss für Landesentwicklung und Wohnen unmittelbar Stel-lung zu nehmen. In der Sache hat er die Neuregelung der Nachbarbeteili-gung detailliert kritisiert, LT-Drs. 17/5635, S. 2 ff.
- 215 Insbesondere die Kommunalen Landesverbände, die Regierungspräsidien, Haus & Grund Baden sowie Haus & Grund Württemberg haben entspre-chende Befürchtungen geäußert, LT-Drs. 17/5422, S. 10 A. 2.


