Wer bezahlt die Kindertagesbetreuung?
Einblicke in die Finanzierungsstrukturen von Bund, Ländern und Kommunen
Wer bezahlt die Kindertagesbetreuung?
Einblicke in die Finanzierungsstrukturen von Bund, Ländern und Kommunen
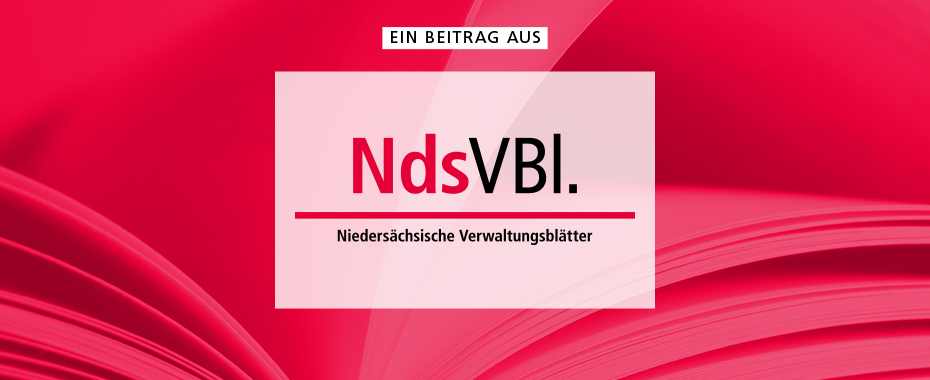
Mit der Frage nach der Finanzierung der Kindertagesbetreuung ist mir – jedenfalls nach einer Formulierung aus der Literatur – ein Thema mit „Sprengkraft für die Kommunalfinanzen“ in Niedersachsen zugewiesen.2 Der öffentliche Finanzierungsbedarf für die Kindertagesförderung ist insgesamt erheblich: Seit dem 01.01.2013 haben Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Eintritt in die Grundschule nach § 24 Abs. 3 SGB VIII Anspruch auf Betreuung in einer Kindertagesstätte oder in der Kindertagespflege.3 Die Plätze müssen zwar nicht beitragsfrei zur Verfügung gestellt werden, jedoch führt die Verpflichtung zur sozialverträglichen Beitragsgestaltung zu einer Begrenzung der zu erzielenden Elternbeteiligung.4 Auch dem Einrichtungsträger kann – wenn überhaupt – ein Eigenanteil nur in begrenztem Umfang zugemutet werden.5
Die restlichen Kosten verbleiben bei der öffentlichen Hand. Der Bund leistet nach Maßgabe des sog. Kita-Qualitätsgesetzes einen Zuschuss von insgesamt rund 4 Mrd. € für die Jahre 2023/20246, wovon auf Niedersachsen rund 374 Mio. €7 entfallen. Im Übrigen sind die Länder, denen nach § 74a SGB VIII die Ausgestaltung der Finanzierung der Kindertagesförderung obliegt, und die kommunale Ebene gefordert. Die Auseinandersetzung über die Finanzierung der Kindertagesförderung ist nach gegenwärtigem Stand im Wesentlichen zugespitzt auf das Verhältnis zwischen Land einerseits, Kommunen andererseits.8 Die Kostenbelastung und auch die Kostensteigerungen in den vergangenen Jahren sind für beide enorm: Die Ausgaben des Landes für Finanzhilfe, Betriebskostenförderung in der Kindertagesbetreuung, Weiterentwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung und Erhöhung der Teilhabe sind zwischen 2007 und 2021 von 200 Mio. auf 1,5 Mrd. € angestiegen,9 die Zuschussbeiträge der Kommunen von etwa 600 Mio. € auf über 2 Mrd. €.10
Anliegen des Beitrags ist es nicht, konkrete Reformempfehlungen für das Land Niedersachsen zu geben.11 Vielmehr soll es in erster Linie darum gehen, einen Beitrag zu diesen Reformdiskussionen zu leisten, indem der größere Kontext dargestellt wird: der verfassungsrechtliche Rahmen und die Gestaltungsmöglichkeiten des Landesgesetzgebers (II.). Letztere betreffen die grundsätzliche Gestaltung des Finanzierungsmodells (III.), die Finanzierungsbeteiligten und die Gestaltung ihrer jeweiligen Beiträge (IV.), aber auch die Steuerung der Leistungserbringung und die Abwicklung der Finanzierung (V.). Über die Reformdiskussionen für die Kindertagesbetreuung, die zuletzt in einigen Bundesländern geführt worden sind, hinaus, sind diese Gestaltungsmöglichkeiten auch für das nächste sozialpolitische Projekt von Bedeutung: den Anspruch auf einen Ganztagesplatz im Grundschulalter ab 2026.12
II. Verfassungsrechtliche und ökonomische Grundlagen
1. Gebotenheit öffentlich organisierter und teilfinanzierter Kindertagesbetreuung
Am Anfang dieser Einordnung muss die Feststellung stehen, dass die Diskussion keine über das „Ob“ der staatlich organisierten und zu erheblichen Teilen finanzierten Kindertagesbetreuung sein kann, sondern nur eine über das „Wie“ der Finanzierungsstrukturen und Finanzierungsbeteiligungen. Das „Ob“ ist verfassungsrechtlich vorgegeben durch den Schutz von Ehe und Familie sowie des ungeborenen Lebens, aber auch durch den Auftrag zur tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung der Geschlechter (Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG):13 Wo keine Fremdbetreuung erfolgt, werden Betreuungsleistungen zu ganz überwiegenden Teilen von Frauen wahrgenommen, die entsprechende Nachteile im Berufsleben erleiden.14 In der Verfügbarkeit der anderenfalls durch die Kinderbetreuung gebundenen Eltern(-teile) für den Arbeitsmarkt liegt auch die ökonomische Bedeutung und Notwendigkeit der Kindertagesbetreuung: Eine an Überalterung und Fachkräftemangel leidende Gesellschaft kann es sich nicht einmal kurzfristig leisten, Eltern durch Betreuungsnotwendigkeiten von Arbeitsmarkt fernzuhalten.15 Einfach-rechtlich ist der Betreuungsplatzanspruch aus § 24 Abs. 3 SGB VIII als echter und unbedingter Rechtsanspruch ausgestaltet,16 bei Nichterfüllung können Eltern Schadensersatzansprüche gegen die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe geltend machen.17
2. Gestaltungsspielräume
Die Zielsetzung, flächendeckend die Vereinbarkeit von Familie und Beruf (Art. 6 Abs. 1 GG) sowie die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern (Art. 3 Abs. 2 GG) zu gewährleisten, begründet die Erforderlichkeit bundesgesetzlicher Regelungen zur Kindertagesförderung nach Art. 72 Abs. 1, 2, 74 Abs. 1 Nr. 7 GG.18 Bundesgesetzliche Regelungen zur Kindertagesbetreuung enthalten §§ 2 Abs. 2 Nr. 3, 22 bis 25 SGB VIII, wobei § 24 SGB VIII die grundsätzlichen Betreuungsansprüche in verschiedenen Altersstufen regelt und §§ 22 bis 23 SGB VIII – unter dem Vorbehalt näherer Bestimmung durch Landesgesetz – verschiedene Fördergrundsätze zum Ausdruck bringt: die Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit (§ 22 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII), die Einbeziehung, Unterstützung und Ergänzung der Erziehung in der Familie (§§ 22 Abs. 2 Nr. 2, 22 a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, Satz 2 SGB VIII), die Pluralität der Jugendhilfe, §§ 3 f. SGB VIII, d. h. die „Vielfalt von Trägern unterschiedlicher Werteorientierung und […] von Inhalten, Methoden und Arbeitsformen“ und die Koexistenz und Zusammenarbeit von Trägern der freien und öffentlichen Jugendhilfe19 sowie – damit zusammenhängend – ein gewisses Wunsch- und Wahlrecht der Personensorgeberechtigten (§ 5 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII)20. Im Übrigen überlässt § 74 a Satz 1 SGB VIII die Regelung der Finanzierung der Kindertagesförderung dem Landesgesetzgeber. Die Vorschrift soll, so das Bundesverwaltungsgericht, den „Ländern (…) ermöglichen, in eigener Verantwortung die Finanzierung von Tageseinrichtungen zu regeln und ihnen dabei alle Möglichkeiten der Finanzierung (…) eröffnen“.21
3. Grenzen des Gestaltungsspielraums
Als Teil des in den wesentlichen Strukturentscheidungen bundeseinheitlich geregelten Kinder- und Jugendhilferechts ist diese Gestaltungsermächtigung freilich nicht grenzenlos, sie stellt „den Landesgesetzgeber nicht frei von jeglicher Bindung an die bundesgesetzlich geregelten materiellen Ziele und Grundsätze der Jugendhilfe. Die Finanzierung von Tageseinrichtungen bleibt bezogen auf ein Angebot von Jugendhilfe im Sinne des SGB VIII.“22 Das Fördersystem muss deshalb insbesondere die „‚Pluralität der Jugendhilfe‘, d. h. die Pluralität der Träger und die Pluralität der Inhalte, Methoden und Arbeitsformen ermöglichen, unterstützen und effektiv gewährleisten“.23 Der aus diesen Grundsätzen abzuleitende Gleichbehandlungsanspruch der Träger und das Wunsch- und Wahlrecht der Personensorgeberechtigten werden durch grundrechtliche Erwägungen nochmals verstärkt: Art. 12 Abs. 1 GG24 sowie für religionsgemeinschaftliche Träger das Selbstbestimmungsrecht aus Art. 140 GG i. V. m. Art. 137 Abs. 3 WRV25 gebieten ebenfalls die Gleichbehandlung gewerblicher und karitativer Träger untereinander und mit öffentlichen Trägern. Die grundrechtlichen Gewährleistungen machen weiterhin Vorgaben, die der Landesgesetzgeber für die Betriebsorganisation aufstellt – etwa Offenlegungspflichten und Prüfungsbefugnisse öffentlicher Stellen – besonders rechtfertigungsbedürftig.26
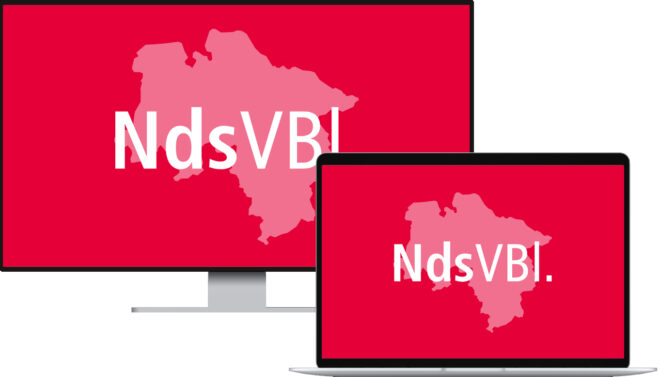 Der Schutz des elterlichen Erziehungsrechts (Art. 6 Abs. 2 GG) verlangt eine möglichst effektive Ausgestaltung des Wunsch- und Wahlrechts, insbesondere mit Blick auf die religiöse oder weltanschauliche Ausrichtung einer Tagesstätte.27 Wie schon angesprochen verlangen der Schutzanspruch gegenüber der staatlichen Gemeinschaft und die Gewährleistungspflicht des Gesetzgebers, „Grundlagen dafür zu schaffen, dass Familientätigkeit und Erwerbstätigkeit aufeinander abgestimmt werden können und die Wahrnehmung der familiären Erziehungsaufgaben nicht zu beruflichen Nachteilen führt“.28 Gleichzeitig steht die staatliche Familienförderung durch finanzielle Leistungen aber – so das Bundesverfassungsgericht –„unter dem Vorbehalt des Möglichen im Sinne dessen, was der Einzelne vernünftigerweise von der Gesellschaft beanspruchen kann. Der Gesetzgeber hat im Interesse des Gemeinwohls neben der Familienförderung auch andere Gemeinschaftsbelange bei seiner Haushaltswirtschaft zu berücksichtigen und dabei vor allem auf die Funktionsfähigkeit und das Gleichgewicht des Ganzen zu achten.“29 Erforderlich ist die staatliche Bezuschussung aber insoweit als Eltern andernfalls von der Inanspruchnahme der Betreuungsleistungen absehen müssten.30 Ferner gebietet es der Grundsatz der Abgabengerechtigkeit (Art. 3 Abs. 1 GG), unterschiedlicher Leistungsfähigkeit angemessen Rechnung zu tragen, was die typisierte Abstufung nach § 90 Abs. 3, 4 SGB VIII zugrunde legt.31 Die Rechtsprechung ist hier insgesamt großzügig. Einkommenbezogene Gebührenstaffelungen sollen dem Gebot der Abgabengerechtigkeit schon genügen, „solange selbst die Höchstgebühr die tatsächlichen Kosten der Einrichtung pro Platz nicht deckt und in einem angemessenen Verhältnis zu der damit abgegoltenen Verwaltungsleistung steht. Unter dieser Voraussetzung wird allen Benutzern im Ergebnis ein vermögenswerter Vorteil zugewendet. Auch die Nutzer, die die volle Gebühr zahlen, werden nicht voraussetzungslos zur Finanzierung allgemeiner Lasten und vor allem nicht zur Entlastung sozial schwächerer Nutzer herangezogen, sondern nehmen an einer öffentlichen Infrastrukturleistung teil, deren Wert die Gebührenhöhe erheblich übersteigt.“32
Der Schutz des elterlichen Erziehungsrechts (Art. 6 Abs. 2 GG) verlangt eine möglichst effektive Ausgestaltung des Wunsch- und Wahlrechts, insbesondere mit Blick auf die religiöse oder weltanschauliche Ausrichtung einer Tagesstätte.27 Wie schon angesprochen verlangen der Schutzanspruch gegenüber der staatlichen Gemeinschaft und die Gewährleistungspflicht des Gesetzgebers, „Grundlagen dafür zu schaffen, dass Familientätigkeit und Erwerbstätigkeit aufeinander abgestimmt werden können und die Wahrnehmung der familiären Erziehungsaufgaben nicht zu beruflichen Nachteilen führt“.28 Gleichzeitig steht die staatliche Familienförderung durch finanzielle Leistungen aber – so das Bundesverfassungsgericht –„unter dem Vorbehalt des Möglichen im Sinne dessen, was der Einzelne vernünftigerweise von der Gesellschaft beanspruchen kann. Der Gesetzgeber hat im Interesse des Gemeinwohls neben der Familienförderung auch andere Gemeinschaftsbelange bei seiner Haushaltswirtschaft zu berücksichtigen und dabei vor allem auf die Funktionsfähigkeit und das Gleichgewicht des Ganzen zu achten.“29 Erforderlich ist die staatliche Bezuschussung aber insoweit als Eltern andernfalls von der Inanspruchnahme der Betreuungsleistungen absehen müssten.30 Ferner gebietet es der Grundsatz der Abgabengerechtigkeit (Art. 3 Abs. 1 GG), unterschiedlicher Leistungsfähigkeit angemessen Rechnung zu tragen, was die typisierte Abstufung nach § 90 Abs. 3, 4 SGB VIII zugrunde legt.31 Die Rechtsprechung ist hier insgesamt großzügig. Einkommenbezogene Gebührenstaffelungen sollen dem Gebot der Abgabengerechtigkeit schon genügen, „solange selbst die Höchstgebühr die tatsächlichen Kosten der Einrichtung pro Platz nicht deckt und in einem angemessenen Verhältnis zu der damit abgegoltenen Verwaltungsleistung steht. Unter dieser Voraussetzung wird allen Benutzern im Ergebnis ein vermögenswerter Vorteil zugewendet. Auch die Nutzer, die die volle Gebühr zahlen, werden nicht voraussetzungslos zur Finanzierung allgemeiner Lasten und vor allem nicht zur Entlastung sozial schwächerer Nutzer herangezogen, sondern nehmen an einer öffentlichen Infrastrukturleistung teil, deren Wert die Gebührenhöhe erheblich übersteigt.“32
Weitere verfassungsrechtliche Vorgaben ergeben sich aus der Stellung der Gemeinden und – sofern diese am System der Kindertagesförderung beteiligt werden – der Gemeindeverbände. Das durch Art. 28 Abs. 2 GG geschützte Selbstverwaltungsrecht schließt das Recht zur eigenverantwortlichen Aufgabenerfüllung und in diesem Rahmen auch zur organisatorischen und finanziellen Aufgabenwahrnehmung ein.33 Gleichzeitig muss die kommunale Finanzausstattung durch das Land sicherstellen, dass den Kommunen ausreichend Finanzmittel zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben zustehen.34 Noch konkreter sind die Vorgaben landesverfassungsrechtlicher Konnexitätsprinzipien, die einen Mehrbelastungsausgleich für Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Übertragung neuer Aufgaben vorsehen. Inzwischen enthalten alle Landesverfassungen von Flächenländern ein striktes Konnexitätsprinzip (in Niedersachsen Art. 57 Abs. 4 NV): Der Landesgesetzgeber muss nicht nur irgendeine Ausgleichsregelung treffen, er muss die der kommunalen Ebene entstehenden Mehrkosten „entsprechend“, d. h. grundsätzlich auch in der Höhe ausgleichen, in der sie auf kommunaler Ebene entstehen.35 Im Rahmen der Neuordnung der Finanzierungsstrukturen kann die Überprüfung der Einhaltung des Konnexitätsprinzips gegenüber jeder einzelnen Gemeinde und jedem einzelnen Gemeindeverband zu erheblichen Schwierigkeiten und Unsicherheiten führen – diesen kann ggf. durch Verständigungen zwischen Land und kommunalen Spitzenverbänden entgegengewirkt werden.36
Schließlich sind als Beschränkungen der gesetzgeberischen Gestaltungsfreiheit auch die Verpflichtungen anzusehen, die das Land nach Maßgabe des KiTa-Qualitätsgesetzes gegenüber dem Bund eingegangen ist. Ungeachtet der Frage, ob die durch dieses Gesetz, und zuvor schon durch das sog. Gute-Kita-Gesetz,37 begründete Konditionalität außerhalb der Verfassung mit der finanzverfassungsrechtlichen Systematik vereinbar ist,38 begründen die abgeschlossenen Vereinbarungen jedenfalls eine eigene Rechtspflicht. Das Land Niedersachsen hat sich in diesem Zusammenhang insbesondere verpflichtet, den Fachkraft-Kind-Schlüssel zu verbessern und besondere Finanzhilfen für Kräfte in Ausbildung sowie für die Förderung der sprachlichen Bildung zu gewähren.39
III. Finanzierungsmodelle
Auf der Grundlage dieser Überlegungen können nun die Gestaltungsmöglichkeiten des Landesgesetzgebers betrachtet werden. Die dargestellte Reichweite der Gestaltungsfreiheit führt zu durchaus erheblichen Unterschieden in der Ausgestaltung in verschiedenen Ländern.40 Als Grundmodelle der öffentlichen Finanzierungsbeteiligung lassen sich dabei die Zuwendungs- oder Objektfinanzierung einerseits, die Entgelt- oder Subjektfinanzierung andererseitsidentifizieren. Bei der Zuwendungsfinanzierung erhalten die Einrichtungsträger öffentliche Leistungen auf der Basis abstrakt-genereller Fördergrundsätze, Anknüpfungspunkt der Finanzierung sind die Einrichtung oder die dort erbrachten Dienste, die staatliche Förderung ist objektbezogen. Demgegenüber setzt die Entgeltfinanzierung bei den leistungsbezogenen Kindern an, sie ist also subjektbezogen. Hier werden durch gesetzliche Festlegung oder im Wege von Leistungs-, Qualitäts- und Entgeltvereinbarungen Anforderungen für die konkrete Leistungserbringung aufgestellt und die tatsächlich erbrachten Leistungen vergütet.41
Das gegenwärtige Finanzierungssystem in Niedersachsen stellt sich als Mischform dar, wobei mit den gesetzlich geregelten Landeszuschüssen, die einrichtungsbezogen erfolgen und im Wesentlichen an Personalkosten knüpfen, das Element der Zuwendungsfinanzierung überwiegt,42 und nur in geringem Umfang, insbesondere bei der Weiterleitung der nach Maßgabe des KiTa-Qualitätsgesetzes erhaltenen Bundesmittel (vgl. §§ 31 f. NKitaG), entgeltähnliche Sonderzuschüsse für einzelne Leistungen erfolgen.
In der Literatur wird zum Teil die Auffassung vertreten, dass im Bereich unbedingter staatlicher Gewährleistungsansprüche allein die Entgeltfinanzierung systemgerecht sei – es handle sich dort nach der gesetzlichen Wertung nämlich um eine öffentliche Aufgabe, deren Erbringung durch Private der Staat in einem an der tatsächlichen Inanspruchnahme orientierten Finanzierungssystem abgelten müsse.43 In der Praxis durchsetzen konnte sich diese Auffassung kaum: Auch bei der Neuordnung der Kita-Finanzierung greifen die meisten Bundesländer auf Mischformen zurück, wobei sehr häufig das Modell der Zuwendungsfinanzierung als Ausgangspunkt gewählt wird.44 Gleichzeitig ist im Rahmen der Neuordnung der Kita-Finanzierung aber durchaus eine Tendenz zur Stärkung von Strukturen der Entgeltfinanzierung erkennbar.45
In der Sache vermag diese Auffassung deshalb nicht zu überzeugen, weil sich die öffentliche Gewährleistungsverantwortung auch im Wege der Zuwendungsfinanzierung realisieren lässt, jedenfalls dann, wenn – etwa durch entgeltbezogene Sonderzuschüsse oder eine Orientierung der Zuschüsse am tatsächlichen Aufwand der Einrichtung je Kind46 – eine Rückbindung an die tatsächlichen Aufwendungen gelingt. Gleichzeitig hat die Einführung zusätzlicher, auf konkrete Leistungen bezogener Zuschüsse, wie sie etwa die Neuregelung der Kita-Finanzierung in Nordrhein-Westfalen prägte47, auch zusätzlichen Abrechnungsaufwand zur Folge. Eine höhere oder stärker zweckgerichtete Beteiligung der öffentlichen Hand und insbesondere des Landes kann also durchaus im Rahmen des bisherigen Systems erfolgen, indem in Zuschussberechnungen weitere Aufwendungen als Personalkosten in stärkerem Maße eingestellt und ggf. zusätzliche, zweckgebundene Zuschüsse eingeführt werden. Gleichwohl stellt die Entgeltfinanzierung i.e.S. – wie sie zuletzt in Mecklenburg-Vorpommern etabliert worden ist – aber eine sehr erwägenswerte Option für die Kita-Finanzierung dar: Für sie spricht der besonders zielgerichtete und schonende Einsatz öffentlicher Mittel.48 Durch Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsvereinbarungen können die zu erbringenden Förderleistungen präzise festgelegt werden und die Einrichtungsträger erhalten eine staatliche Finanzierung nur hinsichtlich der tatsächlich erbrachten Leistungen.
IV. Finanzierungsbeteiligte
Von der Ausgestaltung des Förderungssystems zu unterscheiden ist die Frage, welche Akteure an den Kosten der Kindertagesförderung beteiligt werden sollen. Grundsätzlich in Betracht kommen Bund, Land, Gemeindeverbände, Gemeinden, Eltern und Einrichtungsträger. Die jeweiligen Beteiligungen lassen sich folgendermaßen abschichten.
1. Beteiligung des Bundes
Von vornherein festgelegt ist die Beteiligung des Bundes. Dessen Zuschuss fließt an das Land, das auch sicherstellen muss, dass die dem Bund gegenüber vertraglich übernommenen Verpflichtungen erfüllt werden.49 Wo diese – wie gegenwärtig etwa mit Blick auf die Sprachförderung nach § 31 NKitaG – in der Gewährleistung zusätzlicher Leistungen bestehen, kann dies durch entsprechende Weiterleitung von Finanzierung und Verhaltensanforderungen bewirkt werden.50 Möglich wäre aber auch die eigenständige Umsetzung der Verhaltensvorgaben in Fördervoraussetzungen oder Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsvereinbarungen und die Einstellung der vom Bund erhaltenen Mittel in die allgemeine Finanzierungsbeteiligung des Landes. Während Ersteres die transparentere Umsetzung der gegenüber dem Bund übernommenen Verpflichtungen verspricht, könnte der zweite Weg zu einer insgesamt klareren Struktur des Finanzierungssystems auf Landesebene, vor allem gegenüber den Kommunen und Einrichtungsträgern, führen.
2. Elternbeiträge und Eigenanteile
Die Beteiligung von Personensorgeberechtigten und Einrichtungsträgern an den Kosten der Kindertagesförderung ist in weiten Teilen eine politische Entscheidung, die ökonomischen Gegebenheiten Rechnung tragen muss. Während Elternbeiträge in den dargestellten Grenzen der Sozialverträglichkeit und Abgabengerechtigkeit möglich wären,51 geht eine politische Entwicklungstendenz in Richtung einer weitgehenden Beitragsfreiheit, wie sie in Niedersachsen nach § 22 Abs. 2 NKitaG für Kinder ab dem dritten Lebensjahr für acht Stunden pro Tag gewährleistet ist. Die Elternbeitragsfreiheit kann durchaus auch geeignet sein kann, einen erheblichen Standortvorteil im Wettbewerb um junge, gut ausgebildete Arbeitskräfte zu bilden.52 Sofern Elternbeiträge erhoben werden sollen, spricht viel – anders als bislang in Niedersachsen vorgesehen, wo § 22 Abs. 1 NKitaG die Bemessung der Elternbeiträge den Einrichtungsträgern überantwortet –53 für eine zentrale Festlegung durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe54 oder gar das Land:55 Dies wirkt einem „Preiskampf“ zwischen Einrichtungen und Kommunen entgegen, sichert die Abgabengerechtigkeit (auch über die großzügigen Maßstäbe der Gerichte hinaus) und ermöglicht eine transparente Gestaltung des Finanzierungssystems insgesamt.
Ob Einrichtungsträger durch einen Eigenanteil an den Kosten beteiligt werden sollen, hängt maßgeblich davon ab, welche Akteure als Einrichtungsträger gewonnen werden sollen oder können. Eigenanteile leistet nur, wer Kindertageseinrichtungen aus eigenständiger Motivation betreibt: karitative und wohlfahrtsstaatliche Träger, Betriebe, Elterninitiativen.56 Will oder muss man, um den Betreuungsbedarf zu decken oder um eine stärkere Steuerung der Leistungserbringung zu ermöglichen, auf gewerbliche Anbieter zurückgreifen, muss man auf Eigenanteile verzichten und Möglichkeiten zur Gewinnerzielung vorsehen.57 Im Interesse der Transparenz des Finanzierungssystems sollten auch diese Fragen – anders als bislang in Niedersachsen –58 auf Landesebene entschieden und festgelegt werden.59 Werden Eigenanteile nur abstrakt vorgegeben60 oder ergeben sie sich erst im Rahmen einer Fehlbedarfsfinanzierung,61 kann dies zu erheblichen Unsicherheiten und Planungsschwierigkeiten führen.
3. Landkreise
Eine Besonderheit des gegenwärtigen Systems der Kindertagesförderung in Niedersachsen besteht in der Finanzierungsbeteiligung der Landkreise. Das liegt daran, dass sie im Vereinbarungswege die ihnen durch § 1 Nds.AG SGB VIII zugewiesene Aufgabe als örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe zumeist an die Kommunen abgegeben haben.62 Auch wenn sich die Landkreise zunehmend in unterschiedlicher Form und Intensität an den Kosten beteiligen, hat dies Auswirkungen finanzieller Art, weil die Kosten der Kindertagesförderung dadurch nur insoweit in die interkommunale Umverteilung einbezogen werden, als die Landkreise Zuwendungen als „eine Art ‚kreisinterner Finanzausgleich‘“ gewähren.63 Vor allem aber hat es Auswirkungen organisatorischer Art, weil die Bündelungsfunktion, die die örtlichen Träger häufig haben, eingeschränkt ist. Sie sind zwar nach § 21 NKitaG für die Planung der Kindertagesstätten verantwortlich, bei ihnen laufen aber nicht, wie in anderen Ländern, die Stränge der Kita-Finanzierung zusammen. Die Entscheidung, ob dies auch im Rahmen einer möglichen Finanzierungsreform beibehalten soll, liegt auf der Ebene der Kommunen und ihrer Spitzenverbände.64
4. Land und Gemeinden
Im gegenwärtigen System in Niedersachsen verlagern sich somit weite Teile des multipolaren Systems der Kita-Finanzierung65 auf das Verhältnis von Land und Gemeinden: Die Gemeinden tragen die organisatorische Verantwortlichkeit der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, sie regeln das Verhältnis zu den Einrichtungsträgern, sodass es von der jeweiligen örtlichen Situation abhängt, ob von diesen ein Eigenanteil verlangt wird; in den Bereichen, in denen noch Elternbeiträge erhoben werden,66 sollen die Gemeinden, wenn sie die Aufgaben der örtlichen Träger übernommen haben, deren Nichteinbringlichkeit kompensieren.67 Die Beteiligung des Landes beläuft sich nach §§ 24 ff. NKitaG – von den bereits angesprochenen Sonderzuschüssen abgesehen – auf einen Zuschuss zu den Personalkosten. Planungsunsicherheiten und steigende Kosten für die Kommunen resultieren vor allem daraus, dass dieser Zuschuss auf Grundlage von Pauschalen erfolgt,68 diese jedoch „mehr und mehr hinter den realen tariflichen Personalkosten zurückbleiben“.69 Auch der nach § 21 Abs. 1 DVO NKitaG vorgesehene Dynamisierungsfaktor der sog. Jahreswochenstundenpauschale ist unzureichend. Dies führt auch dazu, dass die in §§ 25 ff. NKitaG vorgesehene prozentuale Beteiligung an den Personalkosten nicht erreicht wird.70 Hinzu kommt, dass eine Beteiligung des Landes an sonstigen Kosten der Einrichtungsträger, nicht vorgesehen ist.
Vor diesem Hintergrund erstaunt es nicht, wenn über eine erhebliche Belastung der kommunalen Haushalte in Niedersachsen durch die Kosten der Kindertagesförderung berichtet wird.71 Ungeachtet der Frage, ob für einzelne Aufgabenerweiterungen ein Konnexitätsausgleich verlangt werden kann,72 ist mit Blick auf die zukünftige Ausgestaltung des Finanzierungssystems daran zu erinnern, dass die mit der Kindertagesbetreuung angestrebte Förderung von Familien und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Aufgabe auch des Landes ist73 und dass das Land eine allzu hohe Kostenbelastung der Kommunen auch aufgrund ihres Anspruchs auf angemessene Finanzausstattung74 vermeiden muss.75
5. Fazit
Mag hinsichtlich der Höhe der einzelnen Finanzierungsbeteiligungen also Spielraum verbleiben für politische Richtungsentscheidungen: Eine Neukonzeption der Kita-Finanzierung in Niedersachsen sollte auf ein System zielen, dass die Kosten der Kindertagesbetreuung transparent abbildet und – unter Berücksichtigung der jeweiligen Leistungsfähigkeit – die einzelnen Beteiligungsquoten klar ausweist.76 Dies gilt für die Beteiligungsquoten des Landes und der Kommunen sowie für etwaige Elternbeiträge und Eigenanteile der Träger. Erneut diskutiert werden sollte darüber> hinaus die finanzielle und organisatorische Entlastung der Landkreise.
V.Steuerung, Abrechnung und Kontrolle
Aus den vorstehenden Überlegungen sollte bereits deutlich geworden sein, dass mit der Finanzierung der Kindertagesförderung auch Fragen der inhaltlichen Steuerung der Leistungserbringung verknüpft sind: Das gilt für den Versuch des Bundes, durch die Verknüpfung seiner Zuschüsse mit inhaltlichen Verpflichtungen – bei denen die Länder aus verschiedenen Feldern wählen konnten – steuernden Einfluss auf die Kindertagesbetreuung zu nehmen. Das gilt aber auch für die Ausgestaltung der Zuschüsse des Landes sowie für die Frage nach Eigenanteilen der Träger. Vor allem aber gilt es für die Ausgestaltung des Finanzierungsmodells und die Frage, inwieweit und auf welche Weise die Erbringung öffentlicher Leistungen an die Erfüllung von Verhaltensvorgaben geknüpft werden kann: ein besonders zielgerichtetes Steuerungsinstrument stellt die Entgeltfinanzierung dar, bei der die vereinbarungsgemäße Leistung überprüft wird und ggf. Anpassungen und Rückforderungen erfolgen können.77 Aber auch im Grundmodell der Zuwendungsfinanzierung lassen sich durch „Fördervoraussetzungen“ und die Stipulation von Rückforderungsrechten Vorgaben etwa zu Gruppenstrukturen und -größen, Aufnahmekriterien, Betreuungsschlüsseln, Personalqualifikation, pädagogischer Qualität, Schließzeiten und Essensversorgung aufstellen.78 Über ein Instrument zur Überprüfung der Einhaltung solcher Vorgaben, über das in anderen Ländern derzeit diskutiert wird,79 verfügt Niedersachsen bereits: die Befugnis des Landesrechnungshofs zur Prüfung bei Einrichtungsträgern.80
Schließlich sollte noch ein weiterer Punkt bei der Diskussion über eine Neuregelung der Finanzierung der Kindertagesförderung bedacht werden: die Transparenz und Einfachheit des gewählten Finanzierungssystems. Je stärker pauschaliert die Finanzierung erfolgt, und je klarer die einzelnen Finanzierungsbeteiligungen durch den Gesetzgeber festgelegt werden, desto einfacher gelingt die Abwicklung des Finanzierungssystems.81 Diese kann inzwischen, von der Erteilung der Betriebserlaubnis, über die Vergabe von Betreuungsplätzen bis zur Abrechnung der Kosten automatisiert erfolgen. Die Digitalisierung, die zu erheblicher Effizienzsteigerung und damit Kostenersparnis führen kann, setzt aber digitaltaugliches Recht voraus.82
VI. Ergebnisse
Was also lässt sich in konzeptioneller Hinsicht und aus einer Außenperspektive zu Reformperspektiven für die Kita-Finanzierung in Niedersachsen festhalten? Ich will zusammenfassend drei Punkte benennen:
- 1 Es gilt, die Kindertagesförderung und ihre Finanzierung als eine zentrale öffentliche Aufgabe zu verstehen. Vor diesem Hintergrund und auch mit Blick auf die finanzielle Situation der Kommunen ist insbesondere der Umfang der Beteiligung des Landes zu erörtern.
- 2 Die Entscheidung, die Rolle der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Vereinbarungswege den Gemeinden zuzuweisen, sollte auf den erneuten Prüfstand gestellt werden. In jedem Fall sollten Diskussionen über die Art und Höhe von Finanzierungsbeteiligungen auf zentraler Ebene geführt und entschieden werden. Es sollte ein System konzipiert werden, das die Beteiligung an den einzelnen für die Kindertagesförderung entstehenden Kosten transparent abbildet und zuweist.
- 3 Die Finanzierungsdiskussion sollte auch unter Steuerungsaspekten geführt werden. Dies betrifft die Wahl des Finanzierungsmodells, noch stärker aber die Aufstellung und Durchsetzung von Anforderungen an die Leistungserbringung. Mitbedacht werden sollten schließlich die Transparenz und Effizienz des Finanzierungssystems und seiner Abwicklung.
Entnommen aus den NdsVBl. Heft 7/2024.


