Neue Regelungen zur temporären Errichtung von PV-Freiflächenanlagen auf geschädigten Waldstandorten
Rechtliche Ausgangssituation und Rahmenbedingungen
Neue Regelungen zur temporären Errichtung von PV-Freiflächenanlagen auf geschädigten Waldstandorten
Rechtliche Ausgangssituation und Rahmenbedingungen
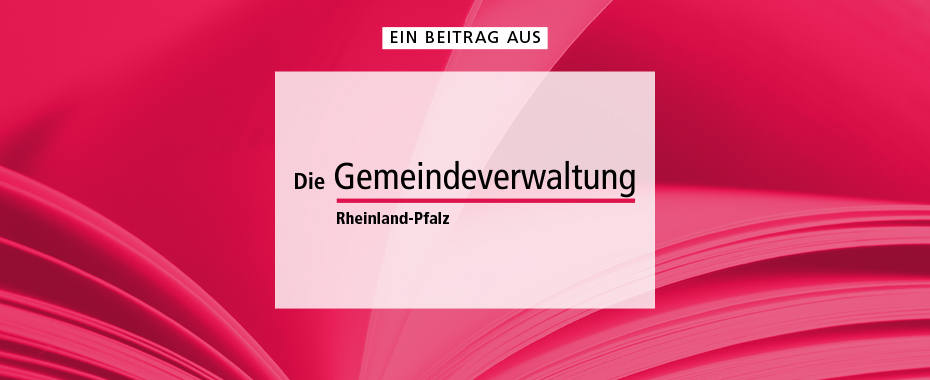
Das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität hat mit Schreiben vom 28.04.2023 an die Zentralstelle der Forstverwaltung und an die Forstämter „Neue Regelungen zur temporären Errichtung von PV-Freiflächenanlagen auf geschädigten Waldstandorten“ veröffentlicht. Mit den Vorgaben soll eine geregelte und möglichst naturverträgliche Realisierung erreicht werden. Der Inhalt des Schreibens wird nachstehend wiedergegeben.
Vor dem Hintergrund der Klima- und Energiekrise fragen verstärkt waldbesitzende Kommunen und Privatpersonen an, ob auf Waldstandorten eine PV-Freiflächenanlage errichtet werden kann. Bei den Waldstandorten handelt es sich oftmals um Standorte, auf denen der Waldbestand infolge klimawandelbedingter Extremwetter stark beeinträchtigt oder z. T. auch in Auflösung begriffen ist. In diesen Fällen ist aber zugleich zu berücksichtigen, dass der Wald als Ökosystem mit seiner natürlichen Regenerationsfähigkeit fortbesteht, auch wenn zeitweilig keine Bäume das äußere Bild prägen. Im Sinne der gemeinwohlorientierten und vielfältigen Waldwirkungen besteht daher waldrechtlich eine Grundpflicht der Waldbesitzenden zur unverzüglichen Wiederaufforstung unbestockter oder unvollständig bestockter Waldflächen durch Naturverjüngung, Pflanzung oder Saat, Vorwälder sowie plangemäße natürliche Sukzession. Waldrechtlich ist für die Errichtung einer PV-Freiflächenanlage eine Genehmigung zur Umwandlung der Waldfläche in eine andere Bodennutzungsart erforderlich.
Aufgrund des nunmehr im EEG formulierten „überragenden öffentlichen Interesses“ an erneuerbaren Energien ist im Abwägungsprozess die Gewichtung z. B. einer PV-Freiflächenanlage gegenüber dem Walderhaltungsgebot deutlich gestärkt worden. Eine entsprechende Umwandlung durch die Forstämter ist daher aktuell nicht mehr „grundsätzlich“ abzulehnen, sondern es ist abhängig von den Umständen des Einzelfalls über die Genehmigungsfähigkeit zu entscheiden.
Ziel ist es, die betreffende Entwicklung planvoll zu steuern, den Ausbau von erneuerbaren Energien zu unterstützen und den Wald, v. a. geschlossene, intakte Waldökosysteme, zumal solche mit jahrhundertelanger Lebensraumtradition (sog. historisch alte Wälder), mit ihren wichtigen Beiträgen für den Klima- und Biodiversitätsschutz entsprechend des gemeinwohlorientierten Walderhaltungsgrundsatzes zu bewahren (vgl. § 1 i. V. m. § 6 und § 13 Abs. 2 LWaldG). Der bereits jetzt vorhandene Verlust von Waldflächen in Rheinland-Pfalz (2020: Verlust von ca. 100 ha) soll durch die Energiewende nicht drastisch ansteigen.
Vor diesem Hintergrund wurden einheitliche Rahmenbedingungen für eine mögliche Entwicklung von PV-Freiflächenanlagen auf umgewandelten Waldstandorten festgelegt.
Rechtliche Ausgangssituation und Rahmenbedingungen
Die Thematik „PV-Freiflächenanlagen auf Waldstandorten“ betrifft verschiedene Rechtsbereiche, die im Folgenden dargestellt werden.
- LWaldG: Genehmigung zur Umwandlung des Waldes erforderlich Nach dem Landeswaldgesetz sind vom Baumbestand entblößte Waldflächen (z. B. durch Borkenkäferkalamität) unverzüglich wieder aufzuforsten. Die vorübergehend unbestockte Waldfläche bleibt weiterhin Wald im Sinne des Gesetzes. Für die Errichtung einer PV-Freiflächenanlage (Anpflanzung von Bäumen wird dadurch verhindert) ist somit eine Genehmigung zur Umwandlung der Fläche in eine andere Bodennutzungsart notwendig.
Die Umwandlungsgenehmigung ist auch bei kalamitätsbedingt entwaldeten Waldflächen notwendig. Bei der Bearbeitung von Umwandlungsanträgen sind die Träger Öffentlicher Belange zu hören und die verschiedenen Belange und Interessen untereinander und gegeneinander abzuwägen. In das waldrechtliche Genehmigungsverfahren förmlich einzubeziehen sind dabei sowohl die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung als auch bei Erreichen bestimmter Schwellenwerte die Maßgaben des UVP-G. Versagt werden soll die Genehmigung zur Umwandlung, wenn die Erhaltung des Waldes im überwiegenden öffentlichen Interesse liegt.
Aufgrund des nunmehr erhöhten Abwägungsgewichtes der erneuerbaren Energien im EEG („überragendes öffentliches Interesse“) ist eine „grundsätzliche“ Versagung nicht mehr möglich. Vielmehr werden im Zuge der einzelfallbezogenen Abwägung z. B. die konkreten Waldwirkungen in die Betrachtung einzubeziehen sein. Liegen keine Versagungsgründe vor, soll die Umwandlungsgenehmigung nach § 14 LWaldG analog zum Verfahren zur Errichtung von Anlagen zur Nutzung der Windenergie befristet erteilt werden. Diese Befristung ist als Bedingung in die Umwandlungsgenehmigung aufzunehmen.
- Novelle EEG: Erneuerbare Energien im überragenden öffentlichen Interesse In der Novelle des EEG wurde den erneuerbaren Energien ein überragendes öffentliches Interesse eingeräumt. Die Formulierung in § 2 EEG lautet: „Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen sowie den dazugehörigen Nebenanlagen liegen im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit. Bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sollen die erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht werden.“ Diese neue Formulierung im EEG hat zur Folge, dass im Rahmen der Abwägung zur Umwandlung von Waldstandorten zur anschließenden Nutzung für eine PV-Freiflächenanlage die erneuerbaren Energien deutlich gestärkt wurden.
Aufgrund der fehlenden baurechtlichen Privilegierung bleibt – anders als bei Windenergieanlagen – für PV-Freianlagen im Außenbereich jedoch weiterhin die Aufstellung von Bebauungsplänen sowie ggfs. die Anpassung der Flächennutzungspläne erforderlich.
- Landesverordnung über Gebote für Solaranlagen auf Ackerland- und Grünlandflächen in benachteiligten Gebieten In den Vollzugshinweisen zur Landesverordnung sind die Regelungen für Solaranlagen definiert. Anlagen auf Waldstandorten sind nicht nach dem EEG vergütungsfähig. Vor diesem Hintergrund kommt für PV-Freiflächenanlagen auf bisherigen Waldstandorten nur ein Betrieb außerhalb des EEG in Betracht.
- Anlagen außerhalb des EEG
Grundsätzlich können PV-Freiflächenanlagen auch außerhalb des EEG errichtet und betrieben werden. Auch bei einer PV-Freiflächenanlage außerhalb des EEG müsste ein Waldstandort allerdings ebenfalls nach den o. g. Bestimmungen des LWaldG rechtlich und sachlich umgewandelt werden. Alle PV-Vorhaben in der Freifläche müssen planerisch den Vorgaben des LEP IV (G166) genügen.
Vorgaben für eine Umwandlung eines Waldstandorts definieren
Um die rechtlich mögliche Umwandlung von Waldflächen für PV-Freiflächenanlagen sinnvoll zu steuern, sind folgende besondere Standortkriterien und im Falle einer Genehmigung entsprechende Bedingungen mit einer Umwandlung zu verbinden.
Kriterien des Waldstandorts für eine Umwandlung:
- Die Waldfläche liegt an der Wald-Feld-Grenze und ist durch Klimawandelfolgen stark geschädigt. Entsprechende Schadflächen weisen aktuell keine waldtypischen Merkmale (z. B. Waldinnenklima) mehr auf.
Begründung: Intakte Wälder sollten aus Klimaschutzaspekten, Gründen des Walderhaltungsgebots und weiteren Gründen des Gemeinwohls nicht gerodet und umgewandelt werden. Deshalb dürfen entsprechende PV- Freiflächenanlagen nicht in geschlossenen Waldgebieten angelegt werden, um das Waldinnenklima und die ökologisch wertvollen Waldlebensräume nicht zu zerschneiden.
- Die Waldfläche liegt möglichst innerhalb eines Radius von 900 m zu reinen, allgemeinen und besonderen Wohngebieten, zu Dorf-, Kern- und Mischgebieten oder möglichst innerhalb des Seitenrandstreifens (500 m) entlang von Autobahnen oder Schienenwegen. Eine Umwandlung von Waldstandorten außerhalb dieser Gebiete sollte vermieden werden.
Begründung: Außerhalb von 900 m ist eine flächeneffizientere Energieerzeugung mit Windenergieanlagen grundsätzlich rechtlich möglich.
- Bei der Waldfläche sollte es sich um Standorte handeln, die möglichst erst nach 1850 bewaldet wurden, zuvor also einer anderen Bodennutzungsart unterlagen, die durch Wald natürlich oder künstlich abgelöst wurde.
Begründung: Historisch alte Waldstandorte mit jahrhundertelanger, u. U. bereits bis zum Ende der letzten Eiszeit zurückreichender Lebensraumtradition sind ökologisch von herausragender Bedeutung. Dies gilt insbesondere mit Blick auf die nach Bodenschutzrecht besonders geschützten Waldböden mit ihren in diesem Fall mutmaßlich besonders komplex vernetzten und arten- und genvielfältigen Organismen. Mit der Änderung der Bodennutzungsart geht diese überragend wertvolle Eigenschaft unwiederbringlich verloren.
Bedingungen und Auflagen bei einer Umwandlung eines Waldstandorts:
- Die Umwandlung wird auf 20 Jahre (max. 30 Jahre) befristet erteilt.
- Die Fläche muss im Sinne der Vollzugshinweise der Landesverordnung über Gebote für Solaranlagen auf Ackerland- oder Grünlandflächen in benachteiligten Gebieten geeignet sein. Bauordnungsrechtliche Anforderungen können absehbar erfüllt werden.
- Die Rückbaukosten der gesamten PV-Anlage und die Kosten für eine Wiederaufforstung müssen über eine entsprechende Bankbürgschaft abgesichert sein.
- Die PV-Freiflächenanlage soll möglichst naturverträglich und Solarparks“ entnommen und an den Standort angepasst realisiert werden.
- Sollten nach max. 30 Jahren naturschutzfachliche oder andere Gründe einer Wiederaufforstung der umgewandelten Waldfläche entgegenstehen, ist die nicht wieder in Wald umwandelbare Fläche 1:1 an einer anderen Stelle mit vergleichbaren Strukturen auszugleichen. Nur im Ausnahmefall kann die Zahlung einer Walderhaltungsabgabe nach LWaldG in Betracht gezogen werden.
In der textlichen Festsetzung des Bebauungsplans sind die oben aufgeführten Punkte 1 bis 5 festzusetzen. Insbesondere sind die baulichen und sonstigen Nutzungen und Anlagen nur für einen Zeitraum von max. 30 Jahren zulässig. Die festzusetzende Folgenutzung ist Wald (siehe § 9 (2) BauGB).
Im Flächennutzungsplan ist diese Fläche – aufgrund der lediglich befristeten Nutzung durch eine PV-Freiflächenanlage – weiterhin als Wald auszuweisen.
Bebauungsplan als weiteres kommunales Steuerungsinstrument
Für die Errichtung einer PV-Freiflächenanlage ist ein Bebauungsplan durch die Kommunen aufzustellen. Somit kann eine PV-Freiflächenanlage nur mit kommunalem Einverständnis errichtet werden. Ein „Wildwuchs“ von PV-Anlagen gegen den Willen der Kommune ist somit nicht möglich.
Um dies sicher zu stellen, ist durch eine Bedingung in der Umwandlungsgenehmigung durch die untere Forstbehörde sicherzustellen, dass von der Genehmigung zur Umwandlung erst Gebrauch gemacht werden darf, wenn ein entsprechender rechtskräftiger Bebauungsplan vorliegt und die beabsichtigte Errichtung einer PV-Freiflächenanlage auf der Fläche zulässig ist. Im Zuge der Bebauungsplanaufstellung ist eine Umwandlungserklärung durch die untere Forstbehörde abzugeben (vgl. § 14 LWaldG). Den Gemeinden steht nach § 2 Abs. 1 BauGB die Bauleitplanung zu. Sie entscheiden somit über die Inhalte des Flächennutzungsplans (der auch die Art der Bodennutzung beinhaltet) und den Bebauungsplan, der die rechtsverbindlichen Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung in dem Baugebiet normiert.
Die kommunale Planungshoheit umfasst auch die Befugnis, diese Pläne zu ändern (§ 1 Abs. 8 BauGB). Vor diesem Hintergrund und vor dem Hintergrund der Bestimmungen des § 9 Abs. 1 Nr. 18 b BauGB und § 9 Abs. 2 kann in einem Bebauungsplan die Bestimmung erfolgen, dass die Festsetzung der Nutzung für die Freiflächenfotovoltaik zeitlich begrenzt erfolgt. Insofern kann in dem Bebauungsplan „in besonderen Fällen“ (Klimaschutzziele etc.) die zeitliche Dauer der Nutzung als Freiflächenfotovoltaik festgesetzt werden und dann die Folgefestsetzung „Wald“ erfolgen. Dies muss zugleich im Einklang mit den Festsetzungen des Flächennutzungsplans stehen.
Entnommen aus Gemeindeverwaltung Rheinland-Pfalz 15/2023, Rn. 151.


