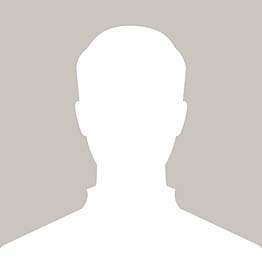Lärmschwerhörigkeit als Berufskrankheit
Urteil des Landessozialgerichts Baden-Württemberg
Lärmschwerhörigkeit als Berufskrankheit
Urteil des Landessozialgerichts Baden-Württemberg

Unter welchen Voraussetzungen Hörschäden als Berufskrankheit anzuerkennen sind und eine Verletztenrente begründen können, ist immer wieder Gegenstand sozialgerichtlicher Verfahren. Das Landessozialgericht Baden-Württemberg (LSG) hat nun im Falle eines Maschinenbedieners einen Anspruch auf Verletztenrente bejaht.
Arbeit an Stanzmaschine
Geklagt hat ein 1952 geborener Mann, der von 1976 bis 2016 bei einem Mitgliedsunternehmen der beklagten Berufsgenossenschaft als Maschinenbediener an Biege- und Stanzautomaten beschäftigt und dabei gehörschädigendem Lärm ausgesetzt war.
Die Lärmbelastungen ließen sich rekonstruieren und betrugen in der Zeit von 1976 bis 2000 Lärmexpositionspegel von 93 dB(A) sowie 2001 bis 2011 von 95 dB(A). Auf einen Antrag des Mannes erkannte die Berufsgenossenschaft eine Lärmschwerhörigkeit als Berufskrankheit (BK) nach Ziff. 2301 der Anlage 1 zur Berufskrankheitenverordnung (BKV) an.
Ein Anspruch auf Rente wegen der BK wurde indes verneint, da sie keine rentenberechtigende Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) zur Folge habe. Die arbeitsmedizinischen Voruntersuchungen zeigten lärmuntypische Hörkurvenverläufe. Das Ausmaß der Schwerhörigkeit entspreche aktuell einer hochgradigen bis an Taubheit grenzenden Schwerhörigkeit, wie sie mit der beruflichen Lärmeinwirkung nicht plausibel zu erklären sei.
Mehrere medizinische Gutachten eingeholt
Der Mann verfolgt den geltend gemachten Anspruch auf Verletztenrente vor dem Sozialgericht weiter. In dem Gerichtsverfahren wurden mehrere medizinische Gutachten eingeholt. Auf dieser Grundlage sprach das LSG als Folge der anerkannten BK 2301 einen Anspruch auf Verletztenrente zu.
Anspruchsgrundlage für die Gewährung der Verletztenrente ist § 56 Abs. 1 SGB VII (Siebtes Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Unfallversicherung). Danach haben Versicherte, deren Erwerbsfähigkeit über die 26. Woche nach dem Versicherungsfall hinaus um wenigstens 20 % gemindert ist, Anspruch auf eine Rente.
Ist die Erwerbsfähigkeit infolge mehrerer Versicherungsfälle gemindert und erreichen die Vomhundertsätze zusammen wenigstens die Zahl 20, besteht für jeden, auch für einen früheren Versicherungsfall, Anspruch auf Rente (Stützrententatbestand).
Die Folgen eines Versicherungsfalls sind nur zu berücksichtigen, wenn sie die Erwerbsfähigkeit um wenigstens 10 % mindern. Die MdE richtet sich gem. § 56 Abs. 2 Satz 1 SGB VII nach dem Umfang der sich aus der Beeinträchtigung des körperlichen und geistigen Leistungsvermögens ergebenden verminderten Arbeitsmöglichkeiten auf dem gesamten Gebiet des Erwerbslebens.
Minderung der Erwerbsfähigkeit
Die Bemessung der MdE hängt also von zwei Faktoren ab, nämlich zum einen von den verbliebenen Beeinträchtigungen des körperlichen und geistigen Leistungsvermögens und zum anderen von dem Umfang der dadurch verschlossenen Arbeitsmöglichkeiten.
Für die Bewertung einer unfallbedingten MdE kommt es auf die gesamten Umstände des Einzelfalls an. Ärztliche Meinungsäußerungen darüber, inwieweit derartige Beeinträchtigungen sich auf die Erwerbsfähigkeit auswirken, sind eine wichtige und vielfach unentbehrliche Grundlage für die richterliche Schätzung der MdE, v. a. soweit sie sich darauf beziehen, in welchem Umfang die körperlichen und geistigen Fähigkeiten des Verletzten durch die Unfallfolgen beeinträchtigt sind.
Erst aus der Anwendung medizinischer und sonstiger Erfahrungssätze über die Auswirkungen bestimmter körperlicher oder seelischer Beeinträchtigungen auf die verbliebenen Arbeitsmöglichkeiten des Betroffenen auf dem Gesamtgebiet des Erwerbslebens und unter Berücksichtigung der gesamten Umstände des Einzelfalls kann die Höhe der MdE geschätzt werden.
„Königsteiner Empfehlung“
Im vorliegenden Fall ist für die Bewertung der MdE das lärmbedingte Ausmaß der Innenohrschwerhörigkeit maßgebend. Bei der Beurteilung des Schweregrades einer durch beruflichen Lärm verursachten Schwerhörigkeit und für die Ermittlung der hierdurch bedingten MdE sind die Grundsätze und Tabellen heranzuziehen, wie sie in der „Empfehlung für die Begutachtung der Lärmschwerhörigkeit (BK 2301)“ – Königsteiner Empfehlung – niedergelegt sind (hierzu LSG Niedersachsen-Bremen, Urt. v. 20.01.2022 – L 14 U 107/20).
Voraussetzung für die Anerkennung eines Gehörschadens im Einzelfall ist der ursächliche Zusammenhang zwischen der versicherten Tätigkeit und einer arbeitsbedingten Lärmeinwirkung (Einwirkungskausalität) sowie der ursächliche Zusammenhang zwischen der Lärmeinwirkung und dem Gehörschaden (haftungsbegründende Kausalität).
Ein Zusammenhang zwischen der arbeitsbedingten Lärmexposition und der Schwerhörigkeit ist als wahrscheinlich anzusehen, wenn mehr Gesichtspunkte dafür als dagegen sprechen. Grundsätzlich sind bei der MdE-Einschätzung abgrenzbare Anteile der Schwerhörigkeit nur dann außer Betracht zu lassen, wenn sie nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit auf eine arbeitsbedingte Lärmeinwirkung zurückgeführt werden können.
Ist die Abgrenzung von nicht arbeitsbedingten Anteilen einer Schwerhörigkeit nicht sicher möglich, ist die gesamte Schwerhörigkeit der BK 2301 zuzuordnen oder zu verwerfen.
Gehörschädigender Lärm
Bei dem Mann liegt beidseits eine Innenohrschwerhörigkeit vor. Während seiner versicherten Berufstätigkeit von 1976 bis 2016 war er gehörschädigendem Lärm ausgesetzt. Ausgehend davon, dass sich der Arbeitsplatz bis zum Berufsende 2016 nicht verändert hat, steht fest, dass der Mann Lärm von 95 dB(A) ausgesetzt und damit potenziell gehörschädigend tätig war.
Das lärmbedingte Ausmaß der Innenohrschwerhörigkeit rechtfertigt eine MdE von 25 v. H., sodass ein Anspruch auf Verletztenrente besteht. Die eingeholten Gutachten ergaben, dass das Ausmaß der gesamten Schwerhörigkeit bis Mai 2012 noch als lärmbedingt anzusehen ist, jedenfalls ab August 2013 aber ein abgrenzbarer, nicht mehr als lärmbedingter Anteil der Schwerhörigkeit festgestellt werden kann.
Die in der Folgezeit festzustellende Verschlimmerung der Lärmschwerhörigkeit lässt sich nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit auf die arbeitsbedingte Lärmeinwirkung zurückführen. Eine einseitige Lärmbelastung als Ursache für einen asymmetrischen Hörbefund ist selten und nur plausibel, wenn die Lärmquelle immer sehr nahe an einem Ohr war.
Dies war bei dem Mann aber nach der Arbeitsplatzbeschreibung nicht der Fall. Er arbeitete an einem Band, bei dem drei Stanzautomaten vor ihm und rechts von ihm positioniert waren. Eine einseitige Lärmbelastung, die die zwischenzeitlich unterschiedliche Ausprägung der Lärmbelastung erklären würde, lag nicht vor.
Landessozialgericht Baden-Württemberg, Urt. v. 25.08.2022 – L 9 U 41/22
Entnommen aus der Gemeindeverwaltung Rheinland-Pfalz 11/2024, Rn. 93.