Die inneren Kommunalverfassungen
Zwischen Bewährung und Entwicklungsnotwendigkeiten
Die inneren Kommunalverfassungen
Zwischen Bewährung und Entwicklungsnotwendigkeiten
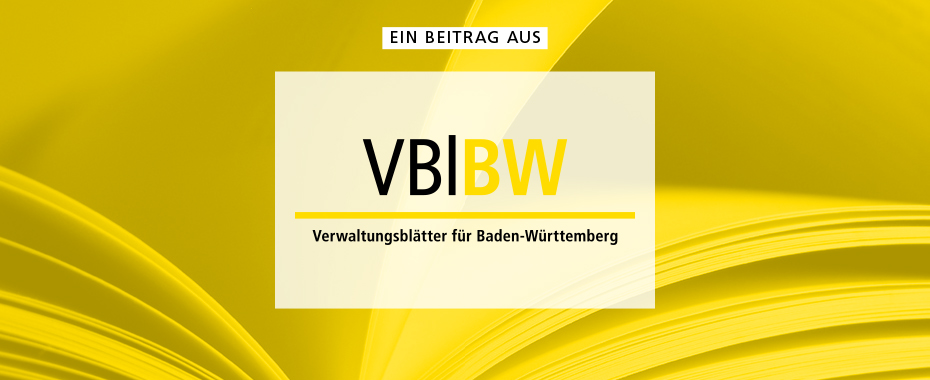
Nachdem der Deutsche Landkreistag 2023 nach Ende der Coronapandemie sein seit 1994 alljährlich durchgeführtes und seit Langem auch an dieser Stelle1Siehe dazu die Tagungsberichte von Henneke, DVBl. 1994, 516–519; 1994, 1229–1234; 1995, 1064–1069; 1996, 791–797; 1997, 1270–1276; 1998, 685–697 und 1999, 860–870 sowie Henneke, VBlBW 2000, 337–348; 2001, 241–252; 2002, 269–279; 2003, 257–269; 2004, 248–261; 2005, 249– 264; 2006, 249–264; 2007, 241–257; 2008, 241–258; 2009, 241–252; 2010, 253–269; 2011, 289–304; 2012, 241–255; 2013, 250–262; 2014, 241–251; 2015, 269–283; 2016, 274–282; 2017, 265–274; 2018, 265–279; 2019, 265– 270; 2020, 265–272; 2022, 187–197; 2022, 353–362 sowie 2023, 265–275. dokumentiertes Professorengespräch2In den Schriften zum deutschen und europäischen Kommunalrecht, Richard Boorberg Verlag Stuttgart, sind die Dokumentationen der Professorengespräche 1994–2023 erschienen: Henneke (Hrsg.), Stärkung der kommunalen Handlungs- und Entfaltungsspielräume (Gespräch 1994); Aktuelle Entwicklungen der inneren Kommunalverfassung (Gespräch 1995); Steuerung der kommunalen Aufgabenverantwortung durch Finanz- und Haushaltsrecht (Gespräch 1996); Organisation kommunaler Aufgabenerfüllung (Gespräch 1997); Optimale Aufgabenerfüllung im Kreisgebiet? (Gespräch 1998); Kommunen und Europa – Herausforderungen und Chancen (Gespräch 1999); Kommunale Aufgabenerfüllung in Anstaltsform (Gespräch 2000); Verantwortungsteilung zwischen Kommunen, Ländern, Bund und Europäischer Union (Gespräch 2001); Kommunale Perspektiven im zusammenwachsenden Europa (Gespräch 2002); Die Kommunen in der Sozialpolitik (Gespräch 2003); Künftige Funktionen und Aufgaben der Kreise im sozialen Bundesstaat (Gespräch 2004); Föderalismusreform in Deutschland (Gespräch 2005); Kommunale Verwaltungsstrukturen der Zukunft (Gespräch 2006), Öffentlicher Auftrag bei sich wandelnden Marktbedingungen (Gespräch 2007); Die Kommunen in den Föderalismusreformen I und II (Gespräch 2008); Kommunalrelevanz des Vergaberechts (Gespräch 2009); Sparkassen, Landes- und Förderbanken nach der Finanzmarktkrise (Gespräch 2010); Stärkung kommunaler Bildungskompetenzen (Gespräch 2011); Kommunale Verantwortung für Gesundheit und Pflege (Gespräch 2012); Kommunale Selbstverwaltung in der Bewährung (Gespräch 2013); Gesicherte Kommunalfinanzen trotz Verschuldungs- und Finanzkrise (Gespräch 2014); Aufsicht und Finanzkontrolle über gebietlich begrenzte kommunale Aufgabenerfüllung (Gespräch 2015); Flüchtlingsunterbringung und -integration als kommunale Herausforderung (Gespräch 2016); Rechtliche Herausforderungen bei der Entwicklung ländlicher Räume (Gespräch 2017); Vergewisserungen über Grundfragen kommunaler Selbstverwaltung (Gespräch 2018); Gleichwertige Lebensverhältnisse bei veränderter Statik des Bundesstaates (Gespräch 2019); Bauen und Wohnen auf dem Lande und in der Stadt (Gespräch 2020); Funktionsfähigkeit des Bundesstaates und der Kreise auf dem Prüfstand (Gespräch 2021); Kommunalrelevanz des Vertrages der Ampel-Koalition (Gespräch 2022); Die Schuldenbremse in der Krise (Gespräch 2023). wieder im beginnenden Frühjahr durchführen konnte und mit der Thematik „Die Schuldenbremse in der Krise“ unter dem besonderen Blickwinkel der „Kommunen im föderalen Schuldenstaat“ das Thema des Jahres 2023 zwischen dem Beschluss des BVerfG v. 22.11.20223BVerfG, Beschl. v. 22.11.2022, DVBl. 2023, 151; dazu Henneke, DVBl. 2023, 324, 329 f. und dem Urteil vom 15.11.20234BVerfG, Urt. v. 15.11.2023, DVBl. 2024, 233; dazu Henneke, DVBl. 2024, 197. facettenreich behandeln und die Auslegung der zentralen Fragestellungen durchaus (mit-)prägen konnte, werfen 2024 die Kommunalwahlen in Baden-Württemberg, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ihren Schatten voraus, nachdem es seit dem Sommer 2023 in einigen Bundesländern in der Öffentlichkeit stark beachtete vereinzelte Bürgermeister- und Landratswahlen gegeben hat. Im Herbst 2024 stehen zudem Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg an.
Dies gab den Anlass, zahlreiche Fragestellungen zur inneren Kommunalverfassung zwischen Bewährung und Entwicklungsnotwendigkeiten unter der Gesamtthematik „Kommunale Demokratie zwischen Beteiligungschancen und Radikalisierungsgefahren“ zu behandeln. Besonders fruchtbar für das Gespräch waren dabei neben der gewohnten Einbeziehung juristischer Fragestellungen Betrachtungen aus der politikwissenschaftlichen Perspektive, die im Tagungsband5Henneke (Hrsg.), Kommunale Demokratie zwischen Beteiligungschancen und Radikalisierungsgefahren, Schriften zum deutschen und europäischen Kommunalrecht, Band 61, Stuttgart 2024 (i. E.) mit den Beiträgen von Nathalie Behnke, Viola Neu und Ursula Münch dokumentiert sind. Der nachfolgende Bericht beschränkt sich aus Raumgründen demgegenüber auf die Behandlung von Fragestellungen der inneren Kommunalverfassung in den 13 Flächenländern.
Die kommunale Demokratie ging der gesamtstaatlichen Demokratie voraus
Zu Beginn des Professorengesprächs stellte Prof. Dr. Hinnerk Wißmann (Münster) die These auf, dass in Deutschland die kommunale Selbstverwaltung als Teil der Begründung des modernen Staates die „große“ – gemeint ist damit die ältere – Schwester der parlamentarischen Demokratie sei. Die Verfassungsrechtslehre unterliege in ihrer Demokratiekonzeption damit traditionell einem unitarischen Fehlschluss, der den Eigenwert der grundständigen kommunalen Demokratie unterschätze. Er bekannte sich damit offensiv dazu, zu dem ihm aufgegebenen Thema: „Demokratie und kommunale Selbstverwaltung in historischer Perspektive und aktueller Entwicklung“ eine juristische Neujustierung zu formulieren.
Dabei erinnerte Wißmann eingangs daran, dass die Garantie der kommunalen Selbstverwaltung im Grundgesetz im Abschnitt über den Bund und die Länder verortet sei. Daher gehe die Staatsrechtslehre von einer gestuften Doppelsouveränität der Bundesrepublik und der Länder aus, von denen aus sie gegründet worden sei, da bezogen auf das jeweilige Gesamtvolk demokratische Herrschaft nur bei Bund und Ländern errichtet werde. Andere Akteure sollten demgegenüber nur zugeteilte Rechte haben. Diesen staatsrechtlichen Dualismus hielt Wißmann indes für unrealistisch. In der Gegenwart bestimme unzweifelhaft vor allem Art. 23 GG ganz maßgeblich das Feld der für die Souveränität entscheidenden Kompetenzverteilung, die sich eher als System von vertikalen Checks-and-Balances und nicht mehr als Hierarchie beschreiben lasse. Auch Art. 28 Abs. 2 GG sei „keine bloße Abspaltung aus dem Block der Länderrechte, sondern ein vollgültiger Beitrag zur Bildung und Aufgliederung der öffentlichen Gewalt“. Das verfassungsrechtliche Mehrebenensystem umfasse daher in zunächst prinzipiell gleicher Weise Europa, den Bund, die Länder und die kommunale Familie.
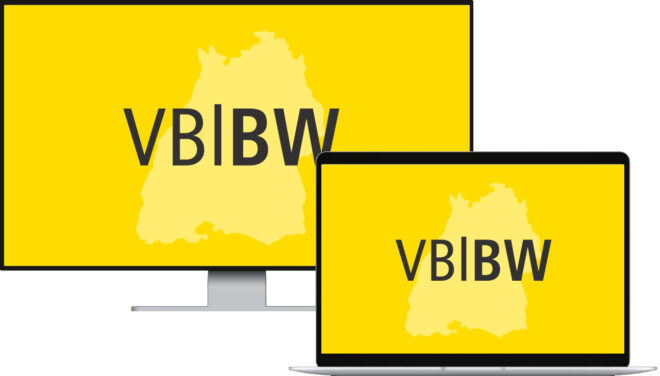 Verfassungshistorisch sei es eine unzulässige Verkürzung, für den Aspekt der Demokratie von einem staatsrechtlichen Vollrecht von Bund und Ländern auszugehen und der kommunalen Selbstverwaltung lediglich einen Status zweiter Ordnung zuzubilligen. Die Doppelidentität von Bund und Staaten sei eine Erfindung nach der Reichsgründung 1871 gewesen, die zunächst ohne demokratische Legitimation der Staatsgewalt ausgekommen sei, welche erst mit der Weimarer Reichsverfassung bzw. dem Grundgesetz beigemischt worden sei. Der deutsche Weg in den modernen Staat habe weder über eine Staatsgründung per Verfassung noch gar über die Deklaration von Menschen- und Bürgerrechten geführt. Die Staatsmodernisierung in Deutschland sei mithin anders als in den USA und Frankreich als „Revolution von oben“ als Resultat der preußischen Niederlage und des bayerischen Satellitenstatus gegenüber Frankreich im Wege von Verwaltungsreformen erfolgt. Dabei seien Stein, Hardenberg und Montgelas nicht absolutistisch völlig frei darin gewesen, wie viel Selbstverwaltung und bürgerliche Freiheit als „Wette auf höhere Effektivität des Staates“ gewährt wurden. Nach 1806 sei allerdings in der Tat in kurzer Frist auf dem Reißbrett der Verwaltungsreformer die moderne deutsche Verwaltungsorganisation von Gemeinden, Landkreisen, Regierungsbezirken und einigen Sonderbehörden als „konsistente Mischung aus Flächenmanagement und Ressortorientierung“ entstanden, nachdem die überkommenen Institutionen vor dem Ansturm Napoleons „zu Staub zerfallen“ seien. Bemerkenswert sei dabei, dass diese „neue Verwaltung“ seither über alle Wechsel der Staatsformen bis heute das selbstverständliche Normalmaß bilde, vor dem sich Modernismen aller Art zu rechtfertigen hätten.
Verfassungshistorisch sei es eine unzulässige Verkürzung, für den Aspekt der Demokratie von einem staatsrechtlichen Vollrecht von Bund und Ländern auszugehen und der kommunalen Selbstverwaltung lediglich einen Status zweiter Ordnung zuzubilligen. Die Doppelidentität von Bund und Staaten sei eine Erfindung nach der Reichsgründung 1871 gewesen, die zunächst ohne demokratische Legitimation der Staatsgewalt ausgekommen sei, welche erst mit der Weimarer Reichsverfassung bzw. dem Grundgesetz beigemischt worden sei. Der deutsche Weg in den modernen Staat habe weder über eine Staatsgründung per Verfassung noch gar über die Deklaration von Menschen- und Bürgerrechten geführt. Die Staatsmodernisierung in Deutschland sei mithin anders als in den USA und Frankreich als „Revolution von oben“ als Resultat der preußischen Niederlage und des bayerischen Satellitenstatus gegenüber Frankreich im Wege von Verwaltungsreformen erfolgt. Dabei seien Stein, Hardenberg und Montgelas nicht absolutistisch völlig frei darin gewesen, wie viel Selbstverwaltung und bürgerliche Freiheit als „Wette auf höhere Effektivität des Staates“ gewährt wurden. Nach 1806 sei allerdings in der Tat in kurzer Frist auf dem Reißbrett der Verwaltungsreformer die moderne deutsche Verwaltungsorganisation von Gemeinden, Landkreisen, Regierungsbezirken und einigen Sonderbehörden als „konsistente Mischung aus Flächenmanagement und Ressortorientierung“ entstanden, nachdem die überkommenen Institutionen vor dem Ansturm Napoleons „zu Staub zerfallen“ seien. Bemerkenswert sei dabei, dass diese „neue Verwaltung“ seither über alle Wechsel der Staatsformen bis heute das selbstverständliche Normalmaß bilde, vor dem sich Modernismen aller Art zu rechtfertigen hätten.
Wißmann stellte sodann heraus, dass diese Einrichtung der modernen Verwaltung eine frühe und nicht unmaßgebliche „Einübung in Demokratie“ gewesen sei, beispielhaft zu illustrieren an der Preußischen Städteordnung von 1808. Das sei die Verankerung lokaler Demokratie gewesen, lange bevor sie auf gesamtstaatlicher preußischer Ebene eingeführt worden sei, und nicht eine bloße Beteiligung an Verwaltungsgeschäften. Sie sei allerdings nur ein Mosaikstein der preußischen Staatserneuerung gewesen, da sie auf dem Land in dessen Landkreisen und mithin für 90 % der Bevölkerung nicht gegolten habe. Aber auch der Posten des Landrats als „Mittler zwischen König und Land“ trage einen demokratischen Impuls bei, da sich im Laufe der Zeit die Öffnung dieses hauptamtlichen Dienstpostens für fachlich geeignete Anwärter durchgesetzt habe, was den Abstand zwischen Volk und Staat jedenfalls in Preußen verkürzt habe.
Als weiteren Beleg dafür, dass die kommunale der gesamtstaatlichen Demokratie vorangehe, verwies Wißmann auf § 184 der Paulskirchenverfassung zu den Gemeinden, dem erst dann § 186 zu den deutschen Staaten gefolgt sei. Dabei sichere der Entwurf von 1849 die demokratisch verfasste Legitimation hoheitlicher Gewalt den Gemeinden zu. Allerdings werde hier auch die gemeindliche Ebene mit dem Begriff der Selbst-„Verwaltung“ zusammengeführt, was in späterer Zeit nach der Parlamentarisierung des Gesamtstaates zu Zuordnungsproblemen geführt habe.
Im Ergebnis greife es mithin deutlich zu kurz, Demokratie allein mit dem Bund und den Ländern zu verbinden und die lokale Selbstregierung dem Bereich einer staatsinternen Verwaltung zuzuordnen. Vielmehr sei in Deutschland „Demokratie“ im Sinne von Volksherrschaft normativ früher und anderenorts anzutreffen als auf der Ebene des Gesamtstaates. Erst später habe der „geradezu überwältigende Erfolg der Demokratisierung des Staates in Kombination mit seiner rechtsstaatlichen Durchbildung“ zur Zuordnung der kommunalen Selbstverwaltung in den Bereich der Länderexekutive geführt, wobei die Selbstverwaltungskompetenz auch „nach Rastede“ durch Gesetz bis an die Grenzen des Wesenskerns hinwegreguliert werden könne. Schließlich habe kurz darauf im Oktober 1990 die Bundesverfassungsgerichtsentscheidung zum Ausländerwahlrecht mit ihrer engen Verbindung von Staat, Demokratie und Gesamtvolk dazu beigetragen, dem kommunalen Bereich den Platz als „Selbst-Verwaltung“ zuzuweisen, welche in einen Gegensatz zur Demokratie des Staates gesetzt worden sei. Im unitarisierten Demokratiekonzept vom Volk über das Parlament zum Minister und hinunter zur Streifenpolizistin und zum Grundschullehrer verwirkliche sich aber die demokratische Legitimation der öffentlichen Gewalt durch Weisung und Kontrolle lediglich in der Theorie. Faktisch seien andere Faktoren entscheidend, vor allem die gute Ausbildung von Verwaltungsmitarbeitern, während die demokratische Verantwortung von Ministern gegenüber dem Parlament als vermeintliches Verbindungsstück zwischen Volk und Staatsgewalt realiter auf äußerste Missbrauchsfälle beschränkt sei. Kommunalrecht gehöre zum Verwaltungs-, nicht zum Verfassungsrecht.
Auch das Kommunalverfassungsrecht sei also verwaltungsrechtlich formatiert, allerdings sei eine Differenz zwischen Demokratiemodellen und der tatsächlichen Organisation von Herrschaft nachzuweisen. Wißmann verwies insoweit auf die in Folgebeiträgen behandelte Finanzierung von Ratsfraktionen, die Einführung einer politisierten Beigeordnetenverfassung, die versuchte Einführung von Sperrklauseln sowie auf Stichwahlen für das Amt der Hauptverwaltungsbeamten. Wißmann schloss seine Betrachtung mit der Feststellung, dass die kommunale Selbstverwaltung auch 2024 noch mit ihrer eigenen Pfadabhängigkeit zu kämpfen habe. Ein Weg aus der Überforderung könne darin liegen, den eigenen Beitrag zum Gesamtanliegen des Verfassungsstaates neu ins Zentrum zu rücken.
Kommunalwahlrecht in Zeiten der Kreise
Unmittelbar daran anschließend befasste sich der Präsident des Landesverfassungsgerichts Schleswig-Holstein, Prof. Dr. Christoph Brüning (Kiel), mit dem „Kommunalwahlrecht in Zeiten der Krise“ und ging eingangs auf jüngste rechtspolitische Entwicklungen bzw. Bestrebungen in Schleswig-Holstein (Anhebung der Mindestmitgliederzahl von Fraktionen) und Nordrhein- Westfalen (Erfolgswertgleichheitsverbesserungsgesetz) ein. Brüning stellte dazu fest, wenn die Anhebung der Fraktionsmindestgröße das diagnostizierte Zersplitterungsproblem in der Vertretungskörperschaft nicht bei der Wurzel fasse und die Einführung einer Sperrklausel verfassungsrechtlich unzulässig sei, rücke zunehmend das in der Rechtswissenschaft bisher äußerst vernachlässigte Sitzzuteilungsverfahren in den Blick. Aktuell richte sich dieses in den Flächenländern je sechsmal nach Hare-Niemeyer und Sainte-Laguë/Schepers und im Saarland nach d’Hondt.
In Baden-Württemberg hätten die kommunalen Landesverbände jüngst die Wiedereinführung des d’Hondtschen Auszählverfahrens verlangt, was die Landesregierung mit dem Hinweis abgelehnt habe, die beklagte zunehmende Zersplitterung kommunaler Gremien durch kleine Parteien und viele neu gegründete Wählervereinigungen sei nicht allein eine Folge des Sitzberechnungsverfahrens, sondern spiegele auch die größere Pluralität der Gesellschaft wider.
Brüning bereitete diese Fragestellung sorgfältig auf und verwies zunächst darauf, dass das Auszählverfahren der Übersetzung der Stimmenanteile einer Partei bzw. einer Liste in Mandate einer Vertretungskörperschaft diene, wobei wegen der dabei zwangsläufig auftretenden Rundungsnotwendigkeiten eine gesetzgeberische Wertung hinzutreten müsse. Dabei könne aus der Tatsache unvermeidbarer Erfolgswertungleichheiten nicht geschlossen werden, dass auch vermeidbare Erfolgswertungleichheiten zulässig seien. Er sprach sich dafür aus, dass nach einer gesetzgeberischen Systementscheidung für eine Verhältniswahl aus der Gleichheit der Wahl ein verfassungsrechtliches Gebot des besten Sitzzuteilungssystems folge. Dabei sei das Ergebnis eindeutig: Das Verfahren nach d’Hondt verzerre das Wahlergebnis bei der Sitzzuteilung, weil es sich zu Lasten von Splitterparteien auswirke. Das Verfahren nach Sainte-Laguë/ Schepers liefere demgegenüber immer das bestmögliche Ergebnis und stelle daher „das Maß der Dinge“ dar.
Der Sache nach führe eine zweckgerichtete Aufladung des Sitzzuteilungsverfahrens zu demselben Effekt wie die (Wieder-) Einführung einer Sperrklausel bei den Wahlen zu den Gemeinderäten und Kreistagen. Brüning referierte sodann die dazu ergangene Rechtsprechung des BVerfG und des VerfGH NRW und kam zu dem Befund, dass für den Fall, dass eine Funktionsbeeinträchtigung der kommunalen Volksvertretung hinreichend belegt werden könne, eine kommunale Sperrklausel nach wie vor verfassungskonform sei. Ein Argument könne insoweit sein, dass dem Kreistag mit der Wahl des Landrats in Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg eine Kreationsfunktion (wieder) zukomme.
Durchaus sorgenvoll betrachtete Brüning den seit Jahren zu beobachtenden, mit Zahlen unterlegten „Sinkflug bei der Kommunalwahlbeteiligung“, was auch zu der Forderung führe, die Wahlsysteme darauf zu überprüfen, ob sie für die Wähler attraktiver gestaltet werden könnten. Brüning zählte in diesem Zusammenhang zahlreiche erörterte Ursachen für eine sinkende Wahlbeteiligung auf, wobei er einräumte, dass es sich dabei zumeist um bloße Mutmaßungen handele. Sodann ging er näher auf diskutierte Maßnahmen ein, um einen positiven Effekt auf die Wahlbeteiligung zu erzielen, wobei Zusammenlegungen mit anderen Wahlen am probatesten erschienen. Insoweit ist zu vermerken, dass bereits seit Jahrzehnten in den eingangs genannten acht von dreizehn Flächenländern die Kommunalwahlen gemeinsam mit der Europawahl stattfinden; in Nordrhein-Westfalen ist dies nur einmal, nämlich 2014, praktiziert worden. Abweichungen bei den fünfjährigen Wahlperioden gibt es zudem nur noch in Niedersachsen, Hessen und Schleswig-Holstein, während die Kommunalwahlperiode in Bayern bekanntlich sechs Jahre umfasst. Am Ende dieses Überblicks warf Brüning auch noch den Stein einer möglichen Kommunalisierung des Kommunalwahlrechts ins Wasser, ohne sich dieser Überlegung letztlich anzuschließen. Er gelangte daher zu dem Fazit, dass sich die Veränderung im Wahlverhalten mutmaßlich nicht rückgängig machen lasse, weil sie dem Auseinanderdriften und der Individualisierung der Gesellschaft korrespondiere. Es brauche daher mehrere Repräsentanten, um das politische Spektrum des Volkes in den Gemeinden und Kreisen abzubilden, und dieses lasse sich angesichts der Erosion der Bündelungsfunktion der Parteien nicht mehr zusammenfassen. Abschließend befasste sich Brüning mit Elementen des Mehrheitswahlrechts in Nordrhein-Westfalen und Schleswig- Holstein, wo jeweils eine personalisierte Verhältniswahl stattfindet, und erörterte darüber hinaus mit ablehnender Tendenz generell- abstrakt Möglichkeiten der Einführung eines Mehrheitswahlrechts, da sich dann Minderheitsinteressen ggf. überhaupt nicht mehr in den Vertretungen wiederfänden. Daher erschienen ihm Änderungen im System die adäquate Reaktion zu sein. In Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein regte er angesichts der dort stattfindenden Aufblähungen der Vertretungskörperschaften durch Regelungen des Verhältnisausgleichs im Anschluss an nach dem Mehrheitswahlrecht vergebene Mandate eine Reduzierung der gesetzlich normierten Anzahl an Vertretern sowie eine Vergrößerung der Wahlbezirke, die zu einer Entschärfung des Verhältnisausgleichs führe, an.
[…]
VII. Fazit: Beim kommunalen Haus etwas mehr
Wetterfestigkeit wagen
Nachdem Bundesverfassungsrichter a.D., Innenminister a.D. Prof. Dr. Peter Michael Huber (LMU München) große Aufmerksamkeit für seine differenzierten Betrachtungen zum Zusammenspiel von direkter und repräsentativer Demokratie erzielt hatte, die zu dem Ergebnis führten, dass die vorhandenen direkt- demokratischen Elemente in der Kommunalverfassung sich als punktuelle Ergänzungen – bei unterschiedlichen Traditionen in den einzelnen Ländern – durchaus bewährt hätten und insoweit keiner grundsätzlichen Änderung bedürften, aber auch kein Allheilmittel zur Verbesserung kommunaler Entscheidungsfindungen darstellten, hob Prof. Dr. Martin Burgi (LMU München) zunächst hervor, dass gegenwärtig die Stichwörter Populismus, Autoritarismus, Polarisierung und Demokratieverdrossenheit, erschwerte Entscheidungsfindung durch viele kleine Gruppen oder Einzelne, Fragmentierung, sinkende Wahlbeteiligung, Zunahme von Hass und Hetze, Schwächung der Parteien und ihrer Scharnierfunktion, Aufschwung extremistisch denkender und handelnder Akteure etc. Konjunktur auch für die kommunalpolitische Diskussion und den Alltag in den kommunalen Vertretungskörperschaften hätten. Damit gingen erhebliche Herausforderungen einher, wobei der Verfassungsstaat insoweit auch einen erheblichen Beitrag auf der kommunalen Ebene zu leisten habe.
Zunächst seien bei den Wahlen zu den Vertretungskörperschaften stabilisierende Maßnahmen gefordert. Burgi gab zu bedenken, dass man die Wiedereinführung von Sperrklauseln nicht vorschnell ablehnen solle. Vom gut gepolsterten Stuhl des Bundesverfassungsgerichts aus sei es leicht zu sagen, dass die kommunalen Gremien mit den Folgen fehlender Sperrklauseln schon fertig würden. Die eingetretene Zersplitterung gebe seines Erachtens hinreichend Anlass, hier zu einer sorgfältigen Neubetrachtung zu kommen. Insoweit gehörten die Kommunalwahlgesetze zum Teil auf den Prüfstand.
Hinsichtlich der Vertretungskörperschaften stelle sich die Frage, wie in rechtspolitischer Hinsicht mit extremen Parteien und Wählervereinigungen umzugehen sei. Mit dem Begriff der „Potentialität“ sei das Ende der Diskussion sicherlich noch nicht erreicht. Auch müsse man das Thema extremer regionaler Teilgliederungen intensiver angehen. Dies sei derzeit nicht vernünf tig geregelt. Insoweit richte sich der Blick des Änderungsbedarfs entweder auf Art. 21 GG oder § 46 BVerfGG. Hinsichtlich der Fraktionsfinanzierung sei einhellig festgestellt worden, dass diese so bleiben solle, wie sie sei. Im Umgang mit Nachrückverfahren in Ausschüssen sei dagegen durchaus Reformbedarf auf der Gesetzgebungsebene festzustellen. Hinsichtlich der Bestimmung von Ausschussvorsitzenden hob Burgi hervor, dass man insoweit sehr viel rechtsvergleichendes Material kennengelernt habe und fügte augenzwinkernd hinzu: „Das Schöne am Kommunalrecht ist, dass man zur Verarbeitung rechtsvergleichenden Materials nicht ins Ausland fliegen muss. Das ist mithin nachhaltiges Forschen.“ Hier wie auch auf anderen Feldern könne man im Ländervergleich feststellen, welche Länder die besten Regelungen getroffen hätten.
Hinsichtlich der Wahl des Hauptverwaltungsbeamten und des weiteren Führungspersonals komme neben dem Kommunalrecht auch noch das Beamtenrecht ins Spiel, wobei auch Fragen der Rechtsschutzgewährung zu berücksichtigen seien. Es handele sich insoweit also um eine komplexe Konstellation, bei der allerdings konkrete Reformvorschläge unterbreitet worden seien. Das gelte sowohl für das Wahlprüfungsverfahren als auch für die Frage, nach welchen Kriterien Beigeordnetenwahlen durchgeführt werden sollen. Burgi wörtlich: „Es ist schon apart, dass dem vom Volk gewählten Bürgermeister oder Landrat durch Wahl der Beigeordneten mehrere Personen aus dem komplett anderen Spektrum, das die Mehrheit in der Vertretungskörperschaft bildet, an die Seite gestellt werden können, so dass der Hauptverwaltungsbeamte dann ein General ist, der keinen einzigen Offizier hat, auf den er sich aus seiner Sicht verlassen kann.“ Nach geltendem Recht stelle eine solche Einhegung eines volksgewählten Hauptverwaltungsbeamten ein bemerkenswertes Ergebnis dar.
Größere Aufmerksamkeit verdiene auch die Betrachtung kommunalpolitischen Agierens einerseits durch die Kommunalaufsicht und ihre Instrumente, zum anderen aber auch durch eine intensivere und kontinuierliche Begleitung durch die Medien. Hinsichtlich der Hinzufügung direkt-demokratischer Elemente zur repräsentativen Demokratie auf kommunaler Ebene vertrat Burgi die Auffassung, dass insoweit die Verhältnisse in den Kommunen etwas anders gelagert seien als in den Ländern. Im kommunalen Bereich habe man es in den Vertretungskörperschaften mit Ehrenamtlern zu tun, die sich mühevoll darum kümmerten, zu austarierten Lösungen auch auf schwierigen Feldern, etwa die Errichtung eines Windparks, zu kommen. Insoweit sei es durchaus problematisch, wenn durch Bürgerbegehren Aktivisten eine kommunalpolitische Arbeit von Jahren mit einem schlichten „Nein“ wieder kaputtmachen könnten. Das führe bei den Mitgliedern von Vertretungskörperschaften zu beachtlichen Frustrationserlebnissen. Hinsichtlich der Bereitstellung kommunaler Einrichtungen bekannte sich Burgi dazu, dass ihn die dazu ergangene Rechtsprechung nur bedingt überzeuge. Aus Art. 5 GG folge schließlich keinerlei Anspruch darauf, dass es überhaupt eine Stadthalle gebe. Wenn eine Kommune über eine solche verfüge, müsse sie daher von vornherein etwas mehr Bestimmungsautonomie darüber haben, was in dieser geschehe, als wenn sich die Kommune in der Situation einer Eingriffsverwaltung befinde, wo sie natürlich nicht verbieten könne, wie sich Gemeindemitglieder auf ihren Privatgrundstücken verhielten und welche Formen von Aktivitäten sie dort zuließen. Im Ergebnis plädierte Burgi dafür, dass man vor dem Hintergrund der eingangs von ihm beschriebenen Herausforderungen „beim kommunalen Haus schon etwas mehr Wetterfestigkeit wagen“ könne. Im Haus selbst müsse dann aber auch effektiver gearbeitet und besser kommuniziert werden. In der Summe dessen könnten dann die eingangs genannten Herausforderungen besser bewältigt werden.
Entnommen aus Verwaltungsblätter Baden-Württemberg 7/2024, S. 265.
----------
- 1Siehe dazu die Tagungsberichte von Henneke, DVBl. 1994, 516–519; 1994, 1229–1234; 1995, 1064–1069; 1996, 791–797; 1997, 1270–1276; 1998, 685–697 und 1999, 860–870 sowie Henneke, VBlBW 2000, 337–348; 2001, 241–252; 2002, 269–279; 2003, 257–269; 2004, 248–261; 2005, 249– 264; 2006, 249–264; 2007, 241–257; 2008, 241–258; 2009, 241–252; 2010, 253–269; 2011, 289–304; 2012, 241–255; 2013, 250–262; 2014, 241–251; 2015, 269–283; 2016, 274–282; 2017, 265–274; 2018, 265–279; 2019, 265– 270; 2020, 265–272; 2022, 187–197; 2022, 353–362 sowie 2023, 265–275.
- 2In den Schriften zum deutschen und europäischen Kommunalrecht, Richard Boorberg Verlag Stuttgart, sind die Dokumentationen der Professorengespräche 1994–2023 erschienen: Henneke (Hrsg.), Stärkung der kommunalen Handlungs- und Entfaltungsspielräume (Gespräch 1994); Aktuelle Entwicklungen der inneren Kommunalverfassung (Gespräch 1995); Steuerung der kommunalen Aufgabenverantwortung durch Finanz- und Haushaltsrecht (Gespräch 1996); Organisation kommunaler Aufgabenerfüllung (Gespräch 1997); Optimale Aufgabenerfüllung im Kreisgebiet? (Gespräch 1998); Kommunen und Europa – Herausforderungen und Chancen (Gespräch 1999); Kommunale Aufgabenerfüllung in Anstaltsform (Gespräch 2000); Verantwortungsteilung zwischen Kommunen, Ländern, Bund und Europäischer Union (Gespräch 2001); Kommunale Perspektiven im zusammenwachsenden Europa (Gespräch 2002); Die Kommunen in der Sozialpolitik (Gespräch 2003); Künftige Funktionen und Aufgaben der Kreise im sozialen Bundesstaat (Gespräch 2004); Föderalismusreform in Deutschland (Gespräch 2005); Kommunale Verwaltungsstrukturen der Zukunft (Gespräch 2006), Öffentlicher Auftrag bei sich wandelnden Marktbedingungen (Gespräch 2007); Die Kommunen in den Föderalismusreformen I und II (Gespräch 2008); Kommunalrelevanz des Vergaberechts (Gespräch 2009); Sparkassen, Landes- und Förderbanken nach der Finanzmarktkrise (Gespräch 2010); Stärkung kommunaler Bildungskompetenzen (Gespräch 2011); Kommunale Verantwortung für Gesundheit und Pflege (Gespräch 2012); Kommunale Selbstverwaltung in der Bewährung (Gespräch 2013); Gesicherte Kommunalfinanzen trotz Verschuldungs- und Finanzkrise (Gespräch 2014); Aufsicht und Finanzkontrolle über gebietlich begrenzte kommunale Aufgabenerfüllung (Gespräch 2015); Flüchtlingsunterbringung und -integration als kommunale Herausforderung (Gespräch 2016); Rechtliche Herausforderungen bei der Entwicklung ländlicher Räume (Gespräch 2017); Vergewisserungen über Grundfragen kommunaler Selbstverwaltung (Gespräch 2018); Gleichwertige Lebensverhältnisse bei veränderter Statik des Bundesstaates (Gespräch 2019); Bauen und Wohnen auf dem Lande und in der Stadt (Gespräch 2020); Funktionsfähigkeit des Bundesstaates und der Kreise auf dem Prüfstand (Gespräch 2021); Kommunalrelevanz des Vertrages der Ampel-Koalition (Gespräch 2022); Die Schuldenbremse in der Krise (Gespräch 2023).
- 3BVerfG, Beschl. v. 22.11.2022, DVBl. 2023, 151; dazu Henneke, DVBl. 2023, 324, 329 f.
- 4BVerfG, Urt. v. 15.11.2023, DVBl. 2024, 233; dazu Henneke, DVBl. 2024, 197.
- 5Henneke (Hrsg.), Kommunale Demokratie zwischen Beteiligungschancen und Radikalisierungsgefahren, Schriften zum deutschen und europäischen Kommunalrecht, Band 61, Stuttgart 2024 (i. E.)



