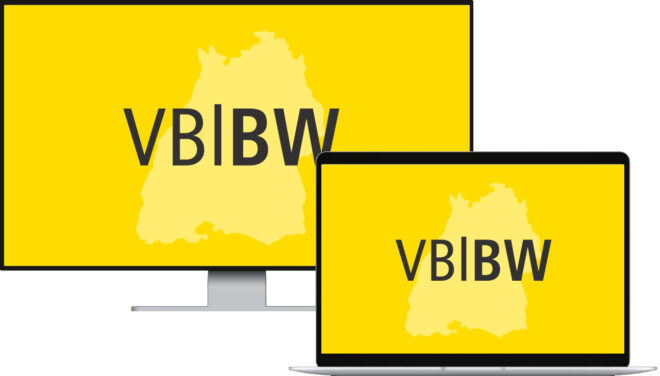Wir machen das Bauen schneller, einfacher und günstiger”
Hält die Genehmigungsfiktion, was die Landesregierung zur Reform der Landesbauordnung verspricht?
Wir machen das Bauen schneller, einfacher und günstiger”
Hält die Genehmigungsfiktion, was die Landesregierung zur Reform der Landesbauordnung verspricht?
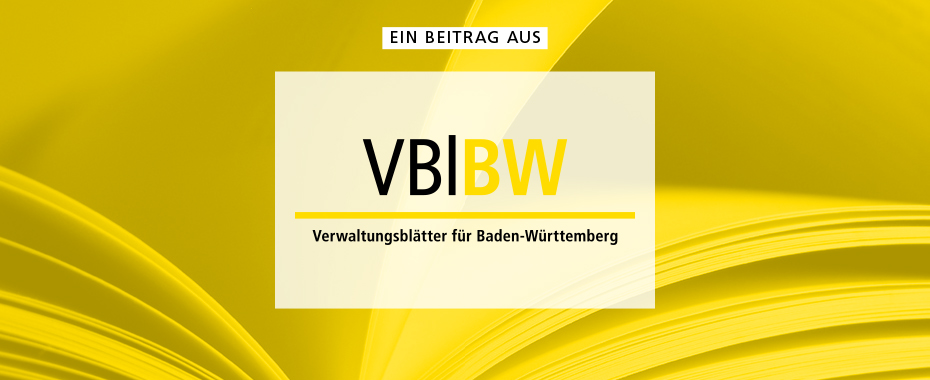
Das Land Baden-Württemberg hat im Juli 2024 den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Landesbauordnung veröffentlicht. Der Entwurf sieht unter anderem die Einführung einer Genehmigungsfiktion vor, nach der nahezu alle Bauvorhaben nach einem bestimmten Zeitraum als genehmigt gelten. Die vorgesehene Gestaltung unterscheidet sich von den Regelungen in den Bauordnungen anderer Länder.
Die Unterschiede ergeben sich im Wesentlichen durch die wenig zweckmäßig gestalteten Prüfpflichten im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren, den weitreichenden Ausschluss des Vollgenehmigungsverfahrens und die uneinheitliche und von zahlreichen Kriterien abhängige Frist zwischen dem Eingang des Bauantrags und dem Eintritt der Genehmigungsfiktion. Den Bauherren gibt die vorgesehene Genehmigungsfiktion nur eine scheinbare Rechtssicherheit, die Baurechtsbehörden zwingt sie häufiger zu repressiven Maßnahmen. Der Autor schlägt vor, den Anwendungsbereich der Genehmigungsfiktion in einem ersten Schritt auf Vorhaben des Wohnungsbaus der Gebäudeklasse 1 bis 3 zu begrenzen und den Eintritt der Genehmigungsfiktion an eine klar bestimmbare und ausreichend lange Frist zu knüpfen.
I. Genehmigungsfiktion im Baugenehmigungsverfahren
Seit Jahrzehnten wird darüber gestritten, ob die Chancen oder Risiken einer Genehmigungsfiktion überwiegen. Mit einer solchen Fiktion wird ein präventives Verbot nicht durch behördliche Erlaubnis überwunden; vielmehr tritt die Wirkung der Erlaubnis nach Ablauf eines bestimmten Zeitraums von selbst ein.
Auch im Baugenehmigungsverfahren ist die Genehmigungsfiktion nicht neu. Bereits in den 1960er-Jahren wurde sie in Bezug auf Werbeanlagen eingesetzt.1 1990 wurde sie erstmals auch für den Wohnungsbau geschaffen.2 Mitte der 2000er-Jahre wurde sie bereits in neun Bundesländern genutzt.3 Inzwischen haben mit Ausnahme von Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen alle Länder eine Genehmigungsfiktion eingeführt.4
In der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) am 06.11.2023 haben die Ministerpräsidenten mit dem Bundeskanzler einen „Pakt zur Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung” beschlossen.5 In dessen Wortlaut heißt es: „Wie im Bündnis bezahlbarer Wohnraum vereinbart, werden die Länder für die Genehmigungsverfahren im Wohnungsbau befristet bis 2026 in allen Landesbauordnungen eine bundesweit einheitliche Genehmigungsfiktion von drei Monaten einführen.” Die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz sind rechtlich nicht bindend, sondern müssen bundes- oder landesrechtlich umgesetzt werden. Die Bauministerkonferenz hat die Genehmigungsfiktion Ende 2023 in die Musterbauverordnung (MBO) aufgenommen.6 Auch die Musterbauordnung ist rechtlich nicht bindend, sondern gibt Empfehlungen zur Vereinheitlichung der Landesbauordnungen.
Die in den Ländern geschaffenen Regelungen zur Genehmigungsfiktion im Baugenehmigungsverfahren scheinen auf den ersten Blick durchaus ähnlich: Die Genehmigungsfiktion greift im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren (vBGV), überwiegend ohne thematische Einengung.7 Der Fristbeginn knüpft überwiegend an die Vollständigkeit des Bauantrags und der Bauvorlagen an.8 Eine Fiktionsbescheinigung ist überwiegend auf Antrag auszustellen9 und überwiegend keine Voraussetzung für die Bauausführung10. Am stärksten unterscheiden sich die Regelungen bei der Frist: Sie beginnt überwiegend mit dem Eingang der vollständigen Bauvorlagen und reicht von einem Monat11 bis zu drei Monaten mit Verlängerungsmöglichkeit „aus wichtigem Grund”12. Einige Bauordnungen verzichten auf die Vollständigkeit, sehen aber eine Möglichkeit zur Abwendung des Fristbeginns vor, indem die Genehmigungsbehörde Bauvorlagen nachfordert.13
II. Gesetzesentwurf für eine Genehmigungsfiktion in der Landesbauordnung Baden-Württemberg
Zur Umsetzung der politischen Zusage gegenüber dem Bund will das Land Baden-Württemberg mit dem „Gesetz für das schnellere Bauen” (im Folgenden: LBO-E) eine Regelung zur Genehmigungsfiktion in die Landesbauordnung (LBO) aufnehmen.
Der Gesetzesentwurf sieht folgende Regelung vor (vgl. § 58 Abs. 1 a LBO-E): Betrifft ein Bauantrag ein Vorhaben im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren, gilt die beantragte Genehmigung nach Ablauf einer bestimmten Frist als erteilt. Beginn und Dauer der Frist richten sich nach § 54 LBO, also den bislang schon geltenden Fristen im Genehmigungsverfahren. Das heißt: Für die Vollständigkeitsprüfung sind bis zu zehn Arbeitstage vorgesehen. Anschließend setzt die Baurechtsbehörde der Gemeinde und den Fachbehörden (§ 53 Abs. 3 und 4 LBO) eine Stellungnahmefrist von höchstens einen Monat. Nach Ablauf dieses Monats hat die Baurechtsbehörde über den Bauantrag im vBGV innerhalb eines Monats zu entscheiden (§ 54 Abs. 5 LBO). Ist die Entscheidung nicht bis zum Ablauf dieser Fristen bekannt gegeben, wird die Genehmigung fingiert. Auf Antrag des Bauherrn oder eines Angrenzers, dessen Einwendungen nicht entsprochen wird oder dessen öffentlich-rechtlich geschützte nachbarliche Belange durch das Vorhaben berührt sein können (vgl. § 58 Abs. 1 Satz 7 LBO-E), ist unverzüglich eine Fiktionsbescheinigung auszustellen (vgl. § 58 Abs. 1 a Satz 1 Nr. 3 Halbs. 1 LBO-E).
Auf den ersten Blick schafft die Genehmigungsfiktion lediglich eine spürbare Rechtsfolge, nämlich die Wirkung einer Baugenehmigung. Das Nichteinhalten der gesetzlich geregelten Fristen ist bislang bauordnungsrechtlich folgenlos. Nach der geltenden Rechtslage beschleunigt die Überschreitung der geregelten Fristen letztlich den Zugang zur Untätigkeitsklage, indem sie den Zeitraum der „angemessenen Frist” (vgl. § 75 VwGO) in bestimmten Konstellationen verkürzt.
Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass die scheinbare Ähnlichkeit der Genehmigungsfiktion in den Bundesländern nur in der Normgestaltung, nicht aber bei den in Bezug genommenen Vorgaben besteht. Dies betrifft den Anwendungsbereich (hierzu 1.) und die Gestaltung des Verfahrens, innerhalb dessen die Genehmigungsfiktion greift (hierzu 2.), sowie die Gestaltung der Frist, nach deren Ablauf die fingierte Baugenehmigung eintritt (hierzu 3.). Hinzu kommen landesspezifische Unterschiede in der Behördenstruktur (hierzu 4.) und landesspezifische Besonderheiten außerhalb des Baurechts (hierzu 5.).
1. Anwendungsbereich der Genehmigungsfiktion
Die Genehmigungsfiktion betrifft ausschließlich Vorhaben im vBGV. Welche Bauvorhaben im vBGV möglich sind, wird in den Ländern unterschiedlich definiert. In Baden-Württemberg ist das vBGV bislang im Wesentlichen nur bei Wohngebäuden und sonstigen Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3 anwendbar und nur bis zu einer bestimmten Grundflächen- oder Nutzerzahl zulässig (vgl. § 52 Abs. 1 i. V. m. § 51 LBO). Diese Begrenzung soll weitgehend entfallen; nach dem Gesetzesentwurf soll das vBGV bei allen Bauvorhaben mit Ausnahme von Sonderbauten zulässig sein. Der genaue Anwendungsbereich ist unklar, da Sonderbauten unverändert nicht abschließend definiert werden (vgl. § 38 Abs. 2 LBO: „insbesondere”). Auch wenn dieser handwerkliche Mangel im Gesetzgebungsverfahren behoben werden kann, ist eine erhebliche Ausweitung des vBGV zu erwarten. Hinzu kommt: Während das Vollgenehmigungsverfahren bislang nur bei Wohngebäuden der Gebäudeklasse 1 bis 3 ausgeschlossen war (vgl. § 51 Abs. 5 Halbs. 2 LBO), soll es zukünftig nur noch bei Sonderbauten zulässig sein (vgl. § 52 Abs. 1 LBO-E).
Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen sollen der Genehmigungsfiktion nur unterliegen, soweit sie beantragt sind (vgl. § 58 Abs. 1 a Satz 1 Nr. 2 LBO-E). Sie sind weder Teil der Bauvorlagen noch des Bauantrags (vgl. Legaldefinitionen in § 53 Abs. 1 Satz 1 und 2 LBO), sondern müssen gesondert beantragt werden (vgl. § 53 Abs. 1 Satz 3 LBO). Folglich ist ein Bauantrag auch dann vollständig, wenn ein zur Genehmigung erforderlicher Antrag auf Abweichung, Ausnahme und Befreiung nicht gestellt wird. Allerdings bezieht sich dann auch die Genehmigungsfiktion nur auf den Bauantrag und umfasst die nicht beantragten, aber zur Realisierung des Bauvorhabens erforderlichen Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen nicht. In dieser Konstellation kann die Baurechtsbehörde die Bauausführung auch ohne Rücknahme der fingierten Genehmigung untersagen. Die Erfahrungen der Praxis zeigen, dass die Antragsteller im weit überwiegenden Teil der Fälle die Erforderlichkeit eines Antrags auf Erteilung einer Abweichung, Ausnahme und Befreiung nicht erkennen. Der Freude über den Eintritt der Genehmigungsfiktion dürfte daher nicht selten ein „böses Erwachen” folgen. Der Rechtssicherheit erweist die beabsichtigte Regelung einen Bärendienst.
Immerhin soll der Antragsteller auf den Eintritt der Genehmigungsfiktion verzichten und damit eine behördliche Entscheidung herbeiführen können (vgl. § 58 Abs. 2 Satz 2 LBO-E).
2. Gestaltung des vereinfachten Baugenehmigungsverfahrens
Das vBGV bezweckt eine Beschleunigung, indem die Einhaltung bestimmter Vorgaben nicht behördlich geprüft, sondern in den Verantwortungsbereich des Antragstellers gelegt wird. Im vBGV bezieht sich die behördliche Prüfung und folglich die Genehmigung auf die bauplanerische Zulässigkeit, das Abstandsrecht und „andere öffentlich-rechtliche Vorschriften außerhalb dieses Gesetzes und außerhalb von Vorschriften auf Grund dieses Gesetzes, (…) soweit in diesen Anforderungen an eine Baugenehmigung gestellt werden” (vgl. § 52 Abs. 2 Nr. 3 Buchst. a LBO). Was genau unter dieser Formulierung zu verstehen ist, lässt die oberste Baurechtsbehörde bislang offen. Durch die Schaffung zahlreicher, insbesondere umweltbezogener Fachgesetze ist der Umfang dieser Vorschriften in den vergangenen Jahren stark angestiegen. Dies schafft eine Unwucht und bedarf einer Diskussion über den Zuschnitt des Verfahrens. Ziel sollte es sein, das vBGV als echtes „Fast-lane-Verfahren” zu gestalten. Die Prüfpflichten sollten begrenzt werden und sich nur auf wesentliche Belange der öffentlichen Sicherheit und auf solche Themen beziehen, die sich während oder nach der Bauausführung nicht mehr wirtschaftlich korrigieren lassen.
In der Praxis ist die Einbindung von Fachbehörden regelmäßig erforderlich. Erst wenn alle „notwendigen Stellungnahmen” vorliegen oder die Stellungnahmefrist von einem Monat verstrichen ist, beginnt die Entscheidungsfrist von einem Monat zu laufen (vgl. § 54 Abs. 5 Satz 2 LBO).20 Innerhalb dieses Monats muss die Baurechtsbehörde den Sachverhalt vollständig aufklären, Stellungnahmen auswerten, mögliche Widersprüche auflösen und die Entscheidung einschließlich aller Nebenbestimmungen treffen und dem Antragsteller bekanntgeben. Ein Monat ist hierfür ein äußerst knapp bemessener Zeitraum.
Zeitliche Engpässe entstehen erst recht, wenn weder eine Fachbehörde beteiligt werden muss noch das gemeindliche Einvernehmen erforderlich ist, aber die Angrenzer zu beteiligen sind, weil eine Abweichung, Ausnahme oder Befreiung beantragt wurde (vgl. § 55 Abs. 1 LBO). Denn Einwendungen der Angrenzer sind keine „für die Entscheidung notwendigen Stellungnahmen oder Mitwirkungen”, sodass sie den Beginn der Entscheidungsfrist nicht auslösen können (vgl. § 54 Abs. 5 Satz 2 LBO). Auch die im Gesetzesentwurf vorgesehene Regelung, dass Angrenzer und sonstige Nachbarn, deren öffentlich-rechtlich geschützte nachbarliche Belange durch das Bauvorhaben berührt sein können, zukünftig Beteiligte i. S. d. § 13 LVwVfG sind (vgl. § 55 Abs. 1 Satz 4 LBO-E), macht die Einwendung nicht zu einer den Beginn der Entscheidungsfrist aufschiebenden Mitwirkung. Denn der Begriff der Mitwirkung setzt eine Pflicht voraus, während die Stellung als Beteiligter Rechte im Verfahren gewährt. Konsequent trennt auch das allgemeine Verwaltungsverfahrensrecht zwischen der Anhörung Beteiligter und der Mitwirkung einer anderen Behörde (vgl. etwa § 38 Abs. 1 LVwVfG). Im Ergebnis wird die ohnehin knapp bemessene Entscheidungsfrist von einem Monat weiter verkürzt.
Ist eine Angrenzerbeteiligung erforderlich, benachrichtigt die Gemeinde auf Veranlassung der Baurechtsbehörde die Angrenzer innerhalb von fünf Arbeitstagen ab dem Eingang der vollständigen Bauvorlagen (vgl. § 55 Abs. 1 Satz 1 LBO). Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass Einwendungen zukünftig innerhalb von zwei Wochen zu erheben sind (vgl. § 55 Abs. 2 Satz 1 LBO-E). Wenn Gemeinde und Angrenzer diese Fristen (fünf Arbeitstage bzw. zwei Wochen) ausschöpfen, endet die Einwendungsfrist im kalendarisch ungünstigen Fall erst, nachdem die Baurechtsbehörde den Bauantrag bereits beschieden haben muss.21 Um dieses Ergebnis zu vermeiden, müsste gesetzlich geregelt werden, dass die Entscheidungsfrist erst nach Abschluss der Angrenzerbeteiligung zu laufen beginnt.
Hinzu kommt: Ist das gemeindliche Einvernehmen nur deshalb nicht erforderlich, weil die Gemeinde zugleich Baurechtsbehörde ist, muss der Gemeinderat bzw. der zuständige beschließende Ausschuss innerhalb der Entscheidungsfrist über planungsrechtlich relevante Bauanträge informiert werden, damit er durch planungsrechtliche Instrumente auf den Bauantrag reagieren kann.22 Die damit geforderte Sitzungshäufigkeit ist insbesondere während der Ferienzeit oder nach einer Gemeinderatswahl praktisch nicht umsetzbar.
Die Formulierung in der Pressemitteilung des Bauministeriums suggeriert, dass die Entscheidung über den Bauantrag lediglich verfasst sein muss; auch insoweit trifft die Aussage nicht zu. Denn die Entscheidung wird wie jeder Verwaltungsakt erst in dem Zeitpunkt wirksam, in dem sie dem Antragsteller bekannt gegeben wird (vgl. § 43 Abs. 1 LVwVfG). Wenn der Bescheid erst nach Eintritt der Genehmigungsfiktion zugeht, ist er hinsichtlich der Hauptentscheidung wirkungslos.23
Nach der im Verwaltungsverfahrensgesetz geregelten „Grundnorm” zur Genehmigungsfiktion können die Behörden die zur Genehmigungsfiktion führende Frist einmal angemessen verlängern, wenn dies wegen der Schwierigkeit der Angelegenheit gerechtfertigt ist (§ 42 a Abs. 2 Satz 3 LVwVfG). Der Gesetzesentwurf zur bauordnungsrechtlichen Genehmigungsfiktion sieht diese Möglichkeit nicht vor. Denn die beabsichtigte Regelung verweist „für die Dauer der Genehmigungsfrist” auf die Landesbauordnung und schließt damit die Anwendung der in § 42 a LVwVfG geregelten Verlängerungsmöglichkeit als Bestandteil der Frist aus.
Den gesamten Beitrag lesen Sie in den VBlBW Heft 1/2025.