Waffenrecht
Gemiedenes Gefahrengebiet im Fokus
Waffenrecht
Gemiedenes Gefahrengebiet im Fokus
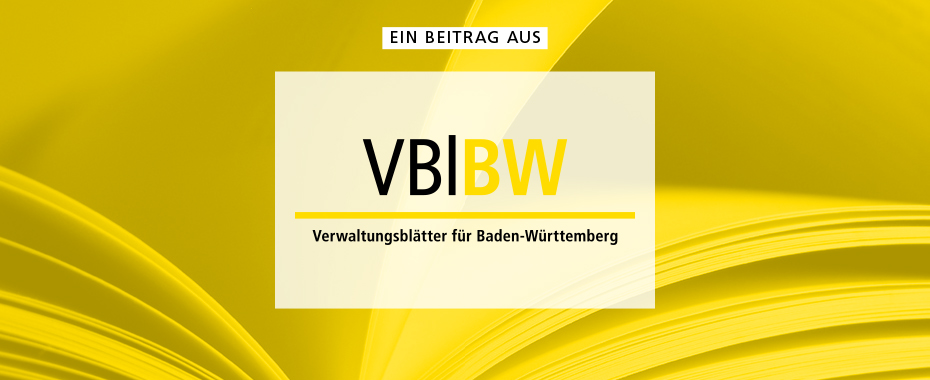
Der islamistische Anschlag auf einem Volksfest in Solingen im August 2024 hat zu einer rechtspolitischen Bündelung von Gefahrenabwehrmaßnahmen im sogenannten „Sicherheitspaket” geführt. Im Oktober 2024 wurden dadurch neben dem Polizei- und Ausländerrecht auch Verschärfungen des Waffenrechts angegangen.1 Dieser Aufsatz beleuchtet die wichtigsten waffenrechtlichen Änderungen und weitergehende Erfordernisse.
I.Einleitung
Das Waffenrecht als „gemiedenes Gefahrengebiet”2 stand jüngst im raren rechtspolitischen Fokus – leider erst als Folge der extremistischen Morde von Mannheim3 und Solingen4. Als Teil eines sogenannten „Sicherheitspaketes” der Bundesregierung wurde im Oktober 2024 das Waffenrecht angepasst: Enthalten sind dabei einige, bereits seit der letzten Änderung 20205 diskutierte6, rechtstechnische wie praktische Maßnahmen, anlassbezogen gleichwohl mit einer besonderen Sensibilität auf den Missbrauchsschutz vor Messern im öffentlichen Raum.
Im Waffenrecht streiten öffentliche Sicherheitsbelange mit den Nutzungsinteressen von Waffenbesitzern,7 insbesondere Jägern und Sportschützen. Dieser Interessenausgleich wird auch im hiesigen „Gesetz zur Verbesserung der inneren Sicherheit und des Asylsystems” sichtbar, etwa in den nachträglich durch den Ausschuss für Inneres und Heimat eingebrachten, erweiterten Ausnahmeregelungen8. Dennoch ordnet sich das Gesetz insgesamt in die verschärfende Regelungsrichtung des waffenrechtlichen Rechtsrahmens ein, wie diese seit Jahrzehnten zu beobachten ist – meist nach tragischen Gewalttaten.9
Zu wenig Aufmerksamkeit erfährt erneut die Umsetzungsebene in den Bundesländern. Dortige Waffenbehörden sind meist auf einer unteren Verwaltungsebene angesiedelt, etwa den Kreispolizeibehörden, und bereits bisher oft personell kärglich ausgestattet.10 Die neuerlichen Verschärfungen werden den Vollzugsaufwand für die Waffenbehörden abermals erhöhen.
Hiesige Betrachtung beleuchtet die wichtigsten11 Anpassungen und ergründet die weiter bestehenden Sicherheitsbedarfe.
II.Die waffenrechtlichen Neuerungen
1.Fokus Messer
Nach den extremistischen Morden von Mannheim und Solingen versucht der Gesetzgeber über Messerverbote und -führverbote ein Sicherheitszeichen zu setzen.12 Dabei soll dem „Sicherheitsproblem Messer”13 insbesondere durch deren ortsbezogene Eindämmung im öffentlichen Raum begegnet werden.
a)Verbot des Führens von Messern bei öffentlichen Veranstaltungen
Das Waffengesetz kennt praxisrelevante orts- oder gegenstandsbezogene Führverbote, insbesondere auf öffentlichen Veranstaltungen, § 42 WaffG, oder für bestimmte Hieb- und Stoßwaffen, § 42 a WaffG. Danach sind sämtliche Waffen, egal ob erlaubnisbedürftig oder -frei, auf öffentlichen Veranstaltungen verboten. Dies gilt nicht nur für Versammlungen14, sondern auch bei öffentlichen Vergnügungen, etwa Volksfesten, Markt-, Kino- oder Diskobesuchen.
Der Gesetzgeber fügt nun ein Führverbot für Messer als § 42 Abs. 4 a WaffG ein, wodurch auch Messer vom o. g. Verbot erfasst werden, die bisher nicht als Waffe i. S. d. § 1 Abs. 2 WaffG über § 42 Abs. 1 WaffG einbezogen waren. Auch das Mitführen sog. „Alltagsmesser” ist demnach im benannten Kontext künftig grundsätzlich untersagt. Verstöße werden als Ordnungswidrigkeit gem. § 53 WaffG geahndet. Dieser zunächst klare Verbotsansatz wird über eine umfassende Auflistung von Ausnahmeinteressen zugleich teilweise infrage gestellt. Verhältnismäßigkeitserwägungen gebieten es, gewisse berechtigte Interessen zu berücksichtigen;15 der zehn Nummern enthaltende Ausnahmekatalog – vom Anlieferverkehr über die Jäger bis hin zum Kunden von Gastronomiebetrieben – ist jedoch so ausgiebig geraten, dass die Kontur der Stoßrichtung partiell zu verschwimmen droht. Wenn das Messerverbot schon auf öffentliche Veranstaltungen beschränkt wird,16 könnten die Ausnahmen in der Risikoabwägung enger gezogen werden,17 zumal die generalklauselartige Formulierung in Nr. 10 „Personen, die Messer im Zusammenhang mit einem allgemein anerkannten Zweck führen” die Kontrollerfassung nochmals mindert.
b)Verbot des Führens von Waffen und Messern im öffentlichen Personenfernverkehr
Durch einen neuen § 42 b WaffG wird das rechtspolitisch überfällige Signal18 zur Gefahrenprävention im gefahrgeneigten ÖPNV gesetzt.19 Das Führen von Waffen und Messern20 ist künftig zumindest im Personenfernverkehr verboten. Damit soll dem dortigen (Affekt-)Risiko in Enge und eingeschränkten Ausweich- und Rückzugsmöglichkeiten Rechnung getragen werden.21 Auch hier werden die berechtigten Ausnahmeinteressen als Regelbeispiele gelistet, wenig übersichtlich als Verweiskette auf § 42 WaffG;22 entsprechend gilt die Kritik zu II. 1. a). Zudem umfasst die Regelung zunächst nicht den örtlichen ÖPNV; vielmehr müssen die Länder über eine erweiterte Verordnungsmöglichkeit in § 42 Abs. 5 Nr. 3 WaffG tätig werden, soll für die gleichgelagerte Gefährdung im örtlichen Personenverkehr der gleiche Präventionsstandard gelten. Hier droht eine Zersplitterung der Regelungslage, zumindest jedoch ein merklicher Zeitverzug in der Umsetzung.
c)Erweiterte Ermächtigung für Waffenverbotszonen
In Zusammenfassung der bisherigen Ermächtigung in § 42 Abs. 5 und 6 WaffG wird eine einheitliche, inhaltlich erweiterte Grundlage zur landesseitigen Einrichtung für Waffenverbotszonen, auch für jegliche „Alltagsmesser”, in § 42 Abs. 5 WaffG geschaffen. „Zur Eindämmung von Gewalttaten mit dem Tatmittel Messer, werden die Landesregierungen für kriminalitätsbelastete Orte und Orte, an denen sich besonders viele Menschen aufhalten und die Fluchtmöglichkeiten begrenzt sind (was die Wahrscheinlichkeit für tödliche Tatfolgen erhöht) ermächtigt, das Führen jeglicher Messer zu verbieten.”23 Von der Möglichkeit zur Ausweisung von Waffenverbotszonen wird in Baden-Württemberg zunehmend Gebrauch gemacht, jüngst etwa in Ulm24.
d)Verbot von Springmessern
Das Waffenrecht kennt im abstrakten25 Waffenverbot einen weiteren Verbotsstrang: Danach sind manche Waffen von vornherein verboten, § 2 Abs. 3 WaffG i. V. m. der Waffenliste in Anlage 2 Abschnitt 1. Dieser Waffenliste werden nun jegliche Springmesser26, deren schnelle Einsatzfähigkeit durch einhändige Bedienung besonders gefährlich ist, hinzugefügt.27 Ausnahmen von diesem Verbot bestehen hingegen erneut bei einem berechtigten Interesse, das eine einhändige Nutzung eines Springmessers erforderlich macht, wie dies etwa für Jäger angenommen wird.
Über eine bundesweite Amnestie bis zum ersten Oktober 2025 soll zudem die Anzahl der in Umlauf befindlichen illegalen Springmesser reduziert werden.28 Weiterhin soll bei Abgabe von unerlaubt besessenen Springmessern die betreffende Person nicht automatisch als waffenrechtlich unzuverlässig erachtet werden, um keinen kontraproduktiven Abschreckungseffekt zu erzeugen.29 Die Wirkung solcher Amnestien blieb in der Vergangenheit überschaubar.30
e)Kontrollbefugnisse zum Verbot des Führens von Waffen und Messern bei öffentlichen Veranstaltungen, im öffentlichen Personenfernverkehr und in Verbotszonen
Über die bestehenden polizeirechtlichen Befugnisse hinaus werden o. g. Rechtsverschärfungen über eine erhöhte Kontrollermächtigung im neuen § 42 c WaffG flankiert. Der Gesetzgeber erkennt, dass „Führensverbote von Waffen- und Messern sowie die Einrichtung von Waffen- und Messerverbotszonen […] nur eine Wirkung entfalten, wenn sie durchgesetzt werden können”.31 Entsprechend können die zuständigen (Polizei-)Behörden der Länder in diesen Bereichen künftig strichprobenartige und anlasslose Kontrollen durchführen.32
Eine entsprechende Ermächtigungsgrundlage für die Bundespolizei kann zunächst aufgrund der Gesetzesverknüpfung mit dem vom Bundesrat abgelehnten „Gesetz zur Verbesserung der Terrorismusbekämpfung” keine Wirkung entfalten.33
2.Fokus Zuverlässigkeit
Das Waffengesetz normiert für Waffen ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, § 2 Abs. 2 WaffG. Bevor eine Privatperson in Deutschland eine (Schuss-)Waffe legal erwerben und nutzen kann, erfolgt grundsätzlich eine Kontrolle durch die Waffenbehörde.34 Der Gesetzgeber steuert diese Vorabkontrolle insbesondere über zwei Nadelöhre: Für das Ziel „so wenig Waffen wie möglich ins Volk”35 zu bringen, bedarf es erstens eines Grundes, genauer eines waffenrechtlichen Bedürfnisses nach § 8 WaffG, um das Privileg des Waffenbesitzes zu erlangen.
Zweitens soll sich nur der Zuverlässige für dieses Sonderrecht qualifizieren, bei dem also die „tatsächlichen Umstände keinen vernünftigen Zweifel zulassen, dass er mit Waffen und Munition jederzeit und in jeder Hinsicht ordnungsgemäß umgehen wird”;36 der Waffenbehörde obliegt diese Prognosebeurteilung auf Tatsachenbasis. Die Risikominimierungshürde konkretisiert der Gesetzgeber in § 5 WaffG umfangreicher,37 als er dies in anderen Materien der Gefahrenabwehr38 für nötig erachtet.39 Das Waffengesetz unterscheidet zwischen der absoluten40 Unzuverlässigkeit nach § 5 Abs. 1 WaffG und der Regelunzuverlässigkeit41 nach § 5 Abs. 2 WaffG.
Die absoluten Unzuverlässigkeitsgründe nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 WaffG für die Erteilung und Aufrechterhaltung von Erlaubnissen im Waffengesetz42 werden mit dem „Sicherheitspaket” durch einen Straftatenkatalog erweitert, der insbesondere staatsgefährdende Straftaten beinhaltet. Dies folgt dem Bestreben, „einen rechtmäßigen Zugang von Personen, die sich in der Vergangenheit extremistisch oder staatsgefährdend betätigt haben und wegen einer entsprechenden Straftat rechtskräftig verurteilt worden sind, zu erlaubnispflichtigen Waffen zu unterbinden”43. „Der Staat soll nicht das Risiko tragen, weitere extremistische oder staatsgefährdende Bestrebungen durch die Erteilung waffenrechtlicher Erlaubnisse zu fördern.”44 Die Einstufung als absoluten Unzuverlässigkeitsgrund entbindet die Waffenbehörden von Einzelfallabwägungen und stärkt den staatlichen Anspruch, Gefährder von Waffen fernzuhalten.
Darüber hinaus werden über § 4 Abs. 6 WaffG die Erkenntnisquellen der Prognoseentscheidung gesichert, indem künftig normiert ist, dass die Waffenbehörde zur Prüfung der waffenrechtlichen Erlaubnisvoraussetzungen in öffentlich zugänglichen Quellen recherchieren darf. Diese Klarstellung untermauert den Grundsatz, dass es keine Beschränkung für die Quellen der waffenrechtlichen Prognoseentscheidung gibt, solange die Information rechtmäßig eingebracht werden kann.
Zudem wird die persönliche Inaugenscheinnahme des (potenziellen) Waffenbesitzers durch die Waffenbehörde gestärkt. Es wird klargestellt, dass sich Anhaltspunkte, welche für die Anordnung des persönlichen Erscheinens zur Prüfung der Erlaubnisvoraussetzungen herangezogen werden können, bspw. aus dem Schriftverkehr oder Telefonaten der betroffenen Person mit der Waffenbehörde oder aus öffentlich zugänglichen Quellen, ergeben können, § 4 Abs. 5 WaffG.45
3.Fokus Informationsaustausch
Um eine fundierte Prognoseentscheidung treffen zu können, bedarf es der möglichst umfassenden Informationsgrundlage. Diese ergänzt der Gesetzgeber, indem er die Waffenbehörde über § 5 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 und § 6 Abs. 1 Satz 3 WaffG künftig verpflichtet, zur Bewertung der Zuverlässigkeit46 und Eignung auch die Erkenntnislage der Bundespolizei und des Zollkriminalamtes abzufragen47.48 Zur Eignungsbewertung sind neben der aktuell zuständigen Landespolizei ferner etwaige polizeiliche Feststellungen entlang der Wohnsitze der letzten zehn Jahre zu erheben.49
Ferner wird das Bundeskriminalamt als Bedarfsabfragebehörde ergänzt. An der bisherigen Praxis, nach der die angefragte Landespolizei den Waffenbehörden mitteilt, falls es zu einer Person einen Datenbestand beim BKA gibt, und die Waffenbehörden daraufhin ihrerseits eine Abfrage beim BKA initiieren, ändert die explizite Schaffung dieser Rechtsgrundlage nichts.50
Darüber hinaus wird für die benannten Behörden und den Verfassungsschutz über einen neuen § 6 a WaffG eine strukturierte Nachberichtspflicht zu relevanten Erkenntnissen eingeführt, sodass die Waffenbehörde als Bündelungsort der Entscheidungsgrundlage gestärkt wird.
Zuletzt wird der praktisch bedeutsame Austausch zwischen Waffen- und Jagdbehörde ertüchtigt: Wo diese nicht ohnehin strukturell zusammengefasst sind, um eine einheitliche und reibungslose Bewertung des Waffen tragenden Jägers zu festigen,51 ist die Gewährleistung des Informationsflusses zwischen den Verwaltungseinheiten essenziell. Entsprechend verpflichtet ein neuer § 6 b WaffG die Waffenbehörde bei Bewertungsänderung der Zuverlässigkeit oder Eignung zur Meldung an die Jagdbehörde.52 Spiegelbildlich sichert § 18 a BJagdG künftig, dass die Waffenbehörde von der Jagdbehörde über die für sie bedeutsame Information der Verlängerung jagdrechtlicher Erlaubnisse informiert wird.
Ein funktionierender Informationsfluss ist eine tragende Säule der waffenrechtlichen Gefahrenabwehr.53 Die vorgenommenen Ergänzungen sind zu begrüßen: Hierdurch wird der staatliche Erkenntnisstand zu einer Person, die das Sonderrecht des Umgangs mit Waffen sucht oder behalten will, zur Entscheidungsbehörde gelenkt.
4.Fokus Gefährder
Für die Waffenbehörde besonders anspruchsvoll ist die Behandlung von potenziell gefährlichen Problempersonen. Gerade diese Gefährder, von denen jede Waffenbehörde zumindest einige im Zuständigkeitsbereich weiß, gilt es zu erkennen und entsprechend intensiv in die Informationsbeschaffung, auch über Fallbesprechungen mit anderen (Sicherheits-)Behörden54, einzusteigen, um über die Nutzung des gesamten rechtlichen Instrumentenkastens den Waffenbesitz zu vermeiden oder zu entziehen. Hierbei stärkt der Gesetzgeber die Waffenbehörde, indem einerseits das individuelle Waffenverbotsspektrum des § 41 Abs. 1 WaffG geschärft und andererseits eine vorläufige Sicherstellungsmöglichkeit für Waffen während eines waffenrechtlichen Aufhebungsverfahren installiert wird, § 45 Abs. 4 Satz 2 WaffG.
Ein individuelles Waffenverbot sperrt präventiv auch den legalen Erwerb von Waffen, die an sich keiner Erlaubnis bedürfen, § 2 Abs. 4 WaffG, wie etwa gewisse Dolche oder Kampfmesser. „Dadurch soll sichergestellt werden, dass diejenigen Personen erfasst werden, bei denen wegen ihres Verhalts anzunehmen ist, dass diese missbräuchlich mit erlaubnisfreien Waffen umgehen werden und mit deren Verwendung entsprechende Gefahren verbunden sein werden.”55 Zur Erleichterung der Anwendung werden die Voraussetzungen zur Verhängung von Verboten des Erwerbs und Besitzes von erlaubnisfreien Waffen durch die Einfügung von Regelbeispielen in § 41 Abs. 1 Satz 2 WaffG konkretisiert.
Zudem wird es den Waffenbehörden künftig über den neuen § 45 Abs. 4 Satz 2 WaffG möglich sein, einer Gefährdung noch während des laufenden Aufhebungsverfahrens durch eine bis zu sechsmonatige Sicherstellung der Waffen zu begegnen, wenn Zuverlässigkeits- oder Eignungsmängel konkret eine besondere Bedrohungslage nahelegen; die Regelung ergänzt die sofortige Sicherstellung über § 46 Abs. 4 Satz 1 WaffG. Die neue Befugnis ist anzuwenden, wenn sich „aus der Gesamtbewertung aller der Waffenbehörde bekannten Tatsachen der Schluss ergibt, dass eine konkrete Wahrscheinlichkeit besteht, dass während der Dauer der Prüfung des Widerrufs oder der Rücknahme ein Schaden für die geschützten Rechtsgüter entsteht”.56 Gerade ein laufendes Aufhebungsverfahren kann Gefährder zusätzlich zu Gewalttaten, etwa gegen Amtsträger des Staates, emotionalisieren. „Bei der Ausübung des behördlichen Ermessens wird insbesondere zu berücksichtigen sein, dass der Umgang mit Waffen und Munition nach der Grundkonzeption des Waffenrechts einem präventiven Verbot mit Erlaubnisvorbehalt unterliegt. Zudem verfolgt das Waffenrecht einen risikointoleranten Ansatz. Darüber hinaus besteht eine staatliche Schutzpflicht für das Leben und die körperliche Unversehrtheit, Art. 2 Abs. 2 GG.”57 Gerade bei Extremisten ist es regelmäßig angezeigt, zeitnah – gemeinsam mit der Polizei – die waffenrechtliche Sicherstellung vorzunehmen.
Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die wichtigen Umsetzungsmaßnahmen des § 46 WaffG (Abgabe von Erlaubnisurkunden und Waffen sowie die Sicherstellung) haben künftig ferner bereits kraft Gesetzes keine aufschiebende Wirkung, § 46 Abs. 6 WaffG, sodass eine rasche Vollstreckung im Gefahrkontext fundiert ist.58
III.Was fehlt?
1.Messerverbot im öffentlichen Raum
Der Gesetzgeber geht, wie unter II 1. gezeigt, richtige Schritte zur verstärkten Messerprävention im öffentlichen Raum. Dabei bedient er sich weiterhin partieller Ansätze, vorrangig der Erleichterung von Waffenverbotszonen sowie der Ausweitung eines Führverbots bei öffentlichen Veranstaltungen und im Personen(fern)verkehr.
Das Waffenrecht krankt jedoch, wie mach anderes Rechtsgebiet59, an der Unübersichtlichkeit im Detail: Selbst waffenrechtliche Experten60 und erst recht „einfache” Normadressaten oder -kontrolleure verlieren den ordnenden Überblick;61 gerade im Gefahrenabwehrrecht schwinden dabei mit anwachsender Komplexität die Vollzugsdeutlichkeit und die Akzeptanz der Regelung. Hier wäre die Messerprävention im gesamten öffentlichen Raum, geregelt über ein entsprechendes Messerführverbot samt einer knappen Ausnahmebeschreibung anhand berechtigter Interessen, ein beherzter Schritt zur Vereinfachung mit klarer Signalwirkung.
2.Referentenentwurf des BMI 2023
Die jetzigen Anpassungen fußen teilweise auf dem „Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung waffenrechtlicher Personenüberprüfungen und zur Änderung weiterer Gesetze” v. 09.01.2023. So wurden etwa die dort empfohlenen62 Regelabfragen bei der Bundespolizei und dem Zollkriminalamt sowie umfassende Nachberichtspflichten und Infoflüsse aufgenommen, siehe II. 3. Hingegen sind drei praxisrelevante Nichtumsetzungen auffällig:
Erstens wird auf die Regelabfrage von Eignungserkenntnissen bei den Gesundheitsbehörden verzichtet. Im Referentenentwurf war noch vorgesehen, zur „Prüfung der persönlichen Eignung zusätzlich die zuständigen Gesundheitsbehörden einzubeziehen. Auch hier erfolgt zudem eine Abfrage der Gesundheitsbehörden der Wohnsitze der vergangenen fünf Jahre vor Prüfung der persönlichen Eignung. Dabei übermitteln die Gesundheitsbehörden, zu denen auch die sozialpsychiatrischen Dienste, die Teil des öffentlichen Gesundheitsdienstes und damit bei den Gesundheitsbehörden organisatorisch verortet sind, an die Waffenbehörden, ob Erkenntnisse vorliegen.”63 Vermutlich spielen personelle und datenschutzrechtliche Erwägungen eine Rolle, weshalb diese praxisrelevante Erkenntnisquelle weiterhin strukturell versiegelt bleibt.
Zweitens führen wohl ebensolche Überlegungen dazu, dass die verpflichtende fachärztliche/-psychologische Vorbegutachtung von Antragstellern einer Waffenerlaubnis64 keine Aufnahme in das Änderungsgesetz gefunden hat, obwohl der Referentenentwurf dies für erforderlich hielt, um „die Eignung der antragstellenden Personen bestmöglich bewerten zu können”.65
Das relevante Risikopotenzial psychisch kranker oder traumatisierter Waffeninteressierter wird somit nicht professionell vermindert.
Drittens bleibt es unergründlich, warum das angedachte Verbot kriegswaffenähnlicher, halbautomatischer Feuerwaffen66 nicht verfügt wurde, obwohl „diese Waffen […] besonders anziehend auf bestimmte Personenkreise und Tätergruppen [wirken], welche für Amok- und Terrortaten eine hohe Relevanz aufweisen. Die terroristischen Anschläge von Utoya, Norwegen sowie Christchurch, Neuseeland, wurden mit solchen Waffen verübt. Wegen der Manifeste der Täter im Internet ist eine Nachahmung nicht auszuschließen.”67
3.Konkretisierung der Waffenleihe
§ 12 Abs. 1 Nr. 1 a) WaffG regelt die Ausleihe von Waffen zwischen Berechtigten, etwa Jägern, § 13 Abs. 1, 4 WaffG. Diese Leihe, etwa zur Probe einer Waffe, ist auf einen Monat ausgelegt, § 12 Abs. 1 Nr. 1 a) WaffG und unterliegt einer Dokumentationspflicht nach § 38 Satz 1 Nr. 1 e) WaffG, die besonders für die Kontrollsituation des Führens relevant wird.
Diese Leihe erfolgt unterhalb der Monatsfrist ohne Kenntnis der Waffenbehörde und ohne einheitliche Dokumentationsvorgabe, etwa eines amtlichen Vordrucks68, der klar die Berechtigten ausweist und die Leihfrist für eine konkrete Waffe festschreibt. Ferner ist zwar anerkannt, dass es keine unbeschränkte „Kettenausleihe” geben darf;69 jedoch fehlt der transparente gesetzliche Rahmen sowie ein konkreter Kontrolldruck.
Hier sollte der Gesetzgeber, sofern er die Leihe als erforderliches Risiko im Waffenrecht belassen will, klare materielle wie formale Vorgaben machen,70 um ein Diffundieren von Waffen abseits der ursprünglichen Zuordnung zu vermeiden.
4.Klarstellung der Unzuverlässigkeitsanknüpfung vor Verurteilung
Der Gesetzgeber nutzt die aktuelle Novellierung teilweise zur normierenden Klarstellung, siehe II. 2. Praxisrelevant wird im Gesetzesvollzug teilweise verkannt, dass die Waffenbehörde auch während eines laufenden Strafverfahrens bzw. aufgrund polizeilicher Ermittlungsberichte/Gefährdungsbeurteilungen Gefahr abwehrend wirken kann. Dies erfolgt über die Generalklausel der Zuverlässigkeitsprüfung in § 5 Abs. 1 Nr. 2 WaffG, die ein (potenziell) unsachgemäßes oder leichtfertiges Verwenden/Verwahren von Waffen oder Munition aufgreift,71 auch wenn noch keine strafrechtliche Verurteilung vorliegt.
Normiert ist, dass die Behörde das Erlaubnisverfahren aussetzen kann, solange ein Strafverfahren anhängig ist, § 5 Abs. 4 WaffG. Eine entsprechende Klarstellung für die Konstellation der Aufhebung der Erlaubnis während eines Strafverfahrens wäre zu begrüßen. Dies entbindet die Waffenbehörde nicht von der Betrachtung des konkreten Falles, belegt jedoch, dass die Einleitung eines (einschlägigen) Strafverfahrens regelmäßig ein Indiz für die Nachprüfung der Zuverlässigkeit darstellt.72 Das würde den Fokus der Waffen- als Gefahrenabwehrbehörde stärken, die weder ein Restrisiko des Zweifels tragen noch ein – oft jahrelanges – Strafverfahren zuwarten muss, um gegenwärtigen Bedrohungslagen zu begegnen.
5.Regelaufbewahrungskontrolle
Die behördliche Aufbewahrungskontrolle nach § 36 Abs. 3 WaffG ist zentrales Überwachungsinstrument der waffenrechtlichen Gefahrvermeidung. Der Verstoß gegen Aufbewahrungspflichten ist beständiger Anknüpfungspunkt der Aufhebung einer waffenrechtlichen Erlaubnis.73 „Verstößt ein Waffenbesitzer gegen diese Vorgaben, ist allein das ein gewichtiges Indiz dafür, dass er das in ihn gesetzte Vertrauen nicht mehr verdient.”74
Hinsichtlich der Kontrolldichte existiert, anders als bei der nochmals ausgeweiteten Regelüberprüfung nach § 4 Abs. 3, 4 WaffG, keine normierte Vorgabe. Entsprechend ist der Vollzug durch die Bundesländer und vielfach auch innerhalb eines Bundeslandes sehr uneinheitlich. Maßgeblich sind nicht selten die Personalausstattung75 sowie das Organisationsverständnis76 vor Ort. Mithin empfiehlt sich ein bundeseinheitlicher Rahmen77, hilfsweise eine Mindestkontrollvorgabe auf Landesebene.78
6.Personal und Professionalisierung
Die erweiterten Befugnisse des „Sicherheitspakets” fordern die Waffenbehörden zusätzlich; der Gesetzgeber legt zu Recht seinen Fokus auf den Informationsfluss zwischen den Behörden, siehe II. 3. Aktive Informationsbeschaffung sowie das zusätzliche Informationshandling beanspruchen Zeit. Die Waffenbehörden sind vielerorts indes bereits durch das „Alltagsmanagement” zwischen Aufbewahrungskontrolle sowie Antrags- und Aufhebungsbearbeitung aus- bzw. überlastet. Diesen „Erfüllungsaufwand” verkennt das Änderungsgesetz79, anders als noch der Referentenentwurf 2023, der zumindest für die zusätzlichen Abfragen samt deren Verarbeitung erhöhte Personalanteile auswies.80
Insgesamt erhöht das „Sicherheitspaket” erneut den rechtlichen Differenzierungsgrad des Waffenrechts; die Umsetzung erfordert mitwachsende Expertise. Dies gilt es in den Ländern strukturell anzuerkennen, indem waffenrechtliche81 Sachbearbeitung in höheren Verwaltungsebenen gebündelt wird, um professionelle Sachbearbeitungsressourcen zu stärken. Zwar gilt es, diese Anpassung mit örtlicher Bürgernähe auszubalancieren;82 mit Blick auf das Schutzgewicht der Vollzugsweichenstellungen sollte eine Ansiedlung unterhalb der Kreisebene83 jedoch unterbleiben.84
Waffenrechtliche Sicherheit wird im Ergebnis freilich nur durch ausreichenden, qualifizierten Personaleinsatz fassbar. Allein aus der kommunalen Kraft85 wird dieser Ressourceneinsatz vielfach kaum zu stemmen sein. Hier wäre ein personeller Pakt des Bundes und der Länder zur Verstärkung der Waffenbehörden als Teil des „sicheren Rechtsstaats”86 angezeigt.
IV.Fazit
Das Wirken im Waffenrecht ist kein risikotoleranter Tätigkeitsbereich; fehlerhaftes Tun oder Unterlassen können tödliche Folgen haben. In diesem besonderen Gefahrenabwehrbewusstsein gilt die Handlungsmaxime: im Zweifel für die Sicherheit. Wie der Rechtsrahmen muss auch der Vollzug eine effektive Erlaubnis- und Kontrollpraxis verkörpern, um die waffentypischen Risiken zu minimieren.
Der Gesetzgeber verbessert in diesem Sinne den waffenrechtlichen Rahmen auf mehreren Ebenen. Sowohl Inhalt als auch Informationsfluss werden angegangen; gerade Letzteres sollte einen praktischen Mehrwert entfalten.
Es verbleiben dennoch wesentliche Verbesserungsstränge zur wirksamen Gefahrenabwehr vor Waffenmissbrauch; besonders der strukturelle Austausch mit den Gesundheitsämtern sollte schnellstmöglich im WaffG verankert werden. Es bleibt jedoch zu befürchten, dass weitere Korrekturen erst nach erneuten, einschneidenden Gewalttaten angegangen werden.87
Umso wichtiger ist der parallele Fokus auf dem Vollzugsrahmen des Waffenrechts: Ein restriktiver Rechtsrahmen nutzt nichts, wenn Verständnis und Kontrolldichte minimiert sind. Die Zeit bis zur nächsten Reform sollte genutzt werden, um insgesamt eine Bereinigung der waffenrechtlichen Systematik als Gesetzesentwurf zu formen.88 Weniger differenzierende Komplexität, mehr Klarheit des Verbots mit Erlaubnisvorbehalt.
Die Fassbarkeit des Sicherheitsgewinns wird jedoch über den personellen Ressourceneinsatz entschieden: Ohne eine entschlossene Ausstattung der Waffenbehörden89 bleibt der Fortschritt dieses Sicherheitspakets eine Schnecke.90



