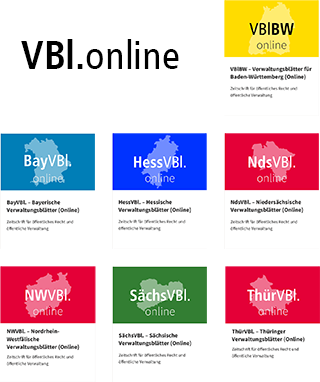Parlamentarisches Fragerecht und rechtsstaatskonformes Strafverfahren
Ein unauflösbarer Widerspruch? - Teil 2
Parlamentarisches Fragerecht und rechtsstaatskonformes Strafverfahren
Ein unauflösbarer Widerspruch? - Teil 2

Das parlamentarische Fragerecht ist in der Bayerischen Verfassung (BV) nicht ausdrücklich geregelt, über die Art. 13 Abs. 2 Satz 1 und 16a Abs. 1, 2 Satz 1 der Bayerischen Verfassung jedoch geschützt. Nichts anderes gilt für ein effektives, faires und rechtskonformes Strafverfahren als integraler Bestandteil des Rechtsstaats, Art. 3 Abs. 1 der Bayerischen Verfassung. Treffen parlamentarische Anfragen und (laufende) strafrechtliche Ermittlungen beziehungsweise Gerichtsverfahren aufeinander, ergeben sich zahlreiche Fragestellungen. Ob und gegebenenfalls wie diese verfassungskonform aufzulösen sind, soll im folgenden Beitrag näher beleuchtet werden.
III. Antwortpflicht der Staatsregierung
Der Bayerische Verfassungsgerichthof hat in mehreren Entscheidungen die hohe Bedeutung des parlamentarischen Fragerechts betont und herausgearbeitet, dass das Fragerecht als subjektives Abgeordnetenrecht unmittelbar aus der Verfassung abzuleiten ist1VerfGHE 54, 62/74; 59, 144/178; 64, 70/81; 67, 216/225.. Entsprechend dieser verfassungsrechtlichen Begründung sowie dem Sinn und Zweck dieses Fragerechts ist die Exekutive grundsätzlich dazu verpflichtet, die Fragen eines Abgeordneten zu beantworten2VerfGHE 54, 62/74; 59, 144/178; 64, 70/81; 67, 216/225.. In all diesen Entscheidungen betont der Bayerische Verfassungsgerichtshof jedoch, dass diese Pflicht nicht grenzenlos besteht. So wird in der Entscheidung vom 17. Juli 20013VerfGHE 54, 62/74. wie folgt ausgeführt:
 Die Antwortpflicht unterliegt allerdings bestimmten Grenzen. Diese können nicht für alle in Betracht kommenden Fälle abstrakt im vorhinein bestimmt werden. Sie ergeben sich in erster Linie aus der Verfassung und verfassungsrechtlichen Grundsätzen. Zur Bestimmung der Grenzen im Einzelnen ist die Antwortpflicht nach dem „Ob” und dem „Wie” einer Antwort zu differenzieren, also danach, ob überhaupt eine Antwort gegeben werden muss und – gegebenenfalls – in welcher Art und Weise die Antwort zu erfolgen hat. Angesichts der Verankerung des Fragerechts und damit auch der Antwortpflicht der Staatsregierung in der Verfassung selbst besteht nur ein enger Entscheidungsspielraum über das „Ob” einer Antwort; die Ablehnung, eine Frage überhaupt (materiell) zu beantworten, muss danach die Ausnahme sein. Dabei sind die Gründe für die Ablehnung anzugeben, damit diese nachvollziehbar wird und damit es dem anfragenden Abgeordneten möglich ist, gegebenenfalls in eine politische Auseinandersetzung über die Ablehnung einzutreten.
Die Antwortpflicht unterliegt allerdings bestimmten Grenzen. Diese können nicht für alle in Betracht kommenden Fälle abstrakt im vorhinein bestimmt werden. Sie ergeben sich in erster Linie aus der Verfassung und verfassungsrechtlichen Grundsätzen. Zur Bestimmung der Grenzen im Einzelnen ist die Antwortpflicht nach dem „Ob” und dem „Wie” einer Antwort zu differenzieren, also danach, ob überhaupt eine Antwort gegeben werden muss und – gegebenenfalls – in welcher Art und Weise die Antwort zu erfolgen hat. Angesichts der Verankerung des Fragerechts und damit auch der Antwortpflicht der Staatsregierung in der Verfassung selbst besteht nur ein enger Entscheidungsspielraum über das „Ob” einer Antwort; die Ablehnung, eine Frage überhaupt (materiell) zu beantworten, muss danach die Ausnahme sein. Dabei sind die Gründe für die Ablehnung anzugeben, damit diese nachvollziehbar wird und damit es dem anfragenden Abgeordneten möglich ist, gegebenenfalls in eine politische Auseinandersetzung über die Ablehnung einzutreten.
Aus dieser eher knappen Entscheidungspassage ergeben sich jedoch bereits ganz wesentliche Erkenntnisse und verfassungsrechtliche Vorgaben.
Erstens: Die verfassungsrechtlich gebotene und mit dem Fragerecht korrespondierende Antwortpflicht der Staatsregierung ist nicht grenzenlos.
Zweitens: Die bestehenden Grenzen können nicht abstrakt festgelegt werden, sondern bedürfen einer Einzelfallbetrachtung.
Drittens: Grenzen ergeben sich insbesondere („in erster Linie“) aus der Verfassung und verfassungsrechtlichen Grundsätzen.
Viertens: Es ist zwischen dem „Ob“ und „Wie“ der Antwort zu differenzieren, wobei die Verweigerung einer Antwort die Ausnahme bleiben muss. Antwortpflicht und Antwortverweigerung stehen dabei in einem Regel-Ausnahme-Verhältnis4Lennartz/Kiefer, a. a. O., 186..
Fünftens: Im Falle einer Antwortverweigerung ist die Staatsregierung gehalten, eine substanziierte und nachvollziehbare Begründung abzugeben, um dem Abgeordneten in letzter Konsequenz eine rechtliche Überprüfung vor dem Verfassungsgericht zu ermöglichen.
Hinsichtlich dieser Begründungspflicht ist anerkannt, dass die Staatsregierung ihre Verweigerungsgründe plausibel, substanziiert und nicht lediglich formelhaft darzulegen hat5StRspr: VerfGHE 54, 62/74; 64, 70/82; 67, 216/227 sowie Huber, a.a.O., Art. 13 Rn. 20; Möstl, a. a. O., § 13 Rn. 25..Der pauschale Hinweis auf einen der verfassungsrechtlichen Gründe, die dem parlamentarischen Fragerecht Grenzen setzen, genügt hierfür nicht6VerfGHE 64, 70/82; 67, 216/226.. Eine Ausnahme ist nur dann denkbar, wenn und soweit die der Antwortverweigerung zugrunde liegenden Gesichtspunkte evident sind7VerfGHE 67, 216/227.. Mit Blick auf diese restriktive Rechtsprechung und die Unzulässigkeit des Nachschiebens von Gründen im verfassungsgerichtlichen Verfahren8Glauben, a. a. O., 755; Huber, a. a. O., Art. 13 Rn. 22 sowie VerfGHE 67, 216/227. ist die Staatsregierung gut beraten, sowohl bei der Auswahl etwaiger Verweigerungsgründe als auch bei deren Begründung selbst größtmögliche Sorgfalt walten zu lassen.
Entsprechend der aufgezeigten verfassungsrechtlichen Leitplanken sollen im Folgenden die Grenzen der Antwortpflicht der Staatsregierung bei parlamentarischen Anfragen näher beleuchtet werden. Etwaige Besonderheiten im Zusammenhang mit (laufenden) strafrechtlichen Ermittlungen beziehungsweise Gerichtsverfahren werden dabei anhand von Praxisbeispielen vertieft.
IV. Grenzen der Antwortpflicht – Verantwortungsbereich der Staatsregierung
Für die gänzliche Verweigerung einer Antwort (Frage des „Ob“) ist mit Blick auf die verfassungsrechtliche Lage nur wenig Raum. Ein solcher Fall ist nur dann denkbar, wenn sich die Frage auf einen Bereich bezieht, für den die Staatsregierung weder unmittelbar noch mittelbar zuständig ist9VerfGHE 54, 62/74.. Die Staatsregierung ist dem Abgeordneten lediglich für die Bereiche rechenschaftspflichtig, für die sie die Verantwortung trägt, das heißt die Verbandskompetenz des Landes und die Organkompetenz der Staatsregierung bestehen10Lennartz/Kiefer, a. a. O., 187; zutreffend und plakativ für die Bundesregierung auch Harks, a. a. O., S. 980 „Antwortpflicht nur für Bereiche, zu denen sie „etwas zu sagen hat““.. Die Geschäftsordnung des Bayerischen Landtags greift diese verfassungsimmanente Beschränkung des Fragerechts selbst auf, wie die Formulierungen in den §§ 67 ff. BayLTGeschO zeigen11Vgl. dazu oben unter II. „Angelegenheiten, für die die Staatsregierung un- mittelbar oder mittelbar zuständig/verantwortlich ist“..
Der Verantwortungsbereich der Staatsregierung ist dabei sowohl personell als auch sachlich abzugrenzen12Huber, a. a. O., Art. 13 Rn. 17.. Personell erstreckt sich der Verantwortungsbereich auf die Mitglieder der Staatsregierung13Art. 43 Abs. 2 BV; zur Besonderheit bei Handlungen von Regierungsmitgliedern, die keinen unmittelbaren Bezug zum Amt haben (Beschäftigung von Familienangehörigen in der Eigenschaft als MdL) vgl. ausführlich VerfGHE 67, 153/165 ff. und alle Personen, die ihrer Aufsicht oder Weisungsbefugnis unterliegen14Huber, a. a. O., Art. 13 Rn. 17.. Sachlich wird jeder Bereich erfasst, in dem die Staatsregierung tätig geworden ist oder kraft rechtlicher Vorschriften tätig werden kann15Huber, a. a. O., Art. 13 Rn. 17 mit zutreffendem Hinweis, dass rein privateBereiche, wie etwa die Verhältnisse bei allein privat getragenen Unterneh-men, nur dann Gegenstand von parlamentarischen Anfragen sein kön-nen, wenn im Einzelfall ausnahmsweise ein Bezug zur Verantwortlichkeit der Staatsregierung besteht..
Praxisbeispiele:
Unter diesen Prämissen ist die Staatsregierung beispielsweise nicht verpflichtet und auch nicht befugt, zu Ermittlungsverfahren Auskunft zu geben, die vom Generalbundesanwalt geführt werden. Der Generalbundesanwalt ist Bundesbeamter16§§ 148 f. GVG. und unterliegt der Aufsicht und Leitung des Bundesministers der Justiz und für Verbraucherschutz17§ 147 Nr. 1 GVG.. Die entsprechende Sachverhaltskonstellation entfaltet durchaus praktische Relevanz, da parlamentarische Anfragen nicht selten Bezüge zu extremistischen Straftaten aufweisen, für die die Verfolgungskompetenz auf Bundesebene18Vgl. hierzu auch § 142a GVG. liegen kann.
Ähnliches gilt für parlamentarische Anfragen, die nähere Auskünfte zu Änderungen im materiellen Strafrecht oder im Strafprozessrecht wünschen, die in einem Koalitionsvertrag auf Bundesebene verabredet wurden. Koalitionsverträge sind politische Vereinbarungen ohne unmittelbare Bindungswirkung im Rechtssinne19Zur umstrittenen Rechtsnatur Kloepfer, Koalitionsvereinbarungen – unver- bindlich, aber rechtlich relevant, NJW 2018, 1799 ff.. Partner von Koalitionsvereinbarungen sind Parteien und eventuell auch die Parlamentsfraktionen dieser Parteien20Kloepfer, a. a. O., 1800.. Soweit es sich um Koalitionsverträge auf Bundesebene handelt, ist die Bayerische Staatsregierung keine „Vertragspartei“ und damit dem Bayerischen Landtag auch nicht auskunftspflichtig. Ein allzu formalistischer Maßstab ist hierbei jedoch nicht anzulegen. Es ist anerkannt, dass die Exekutive verpflichtet ist, den wesentlichen Inhalt der Frage aufzugreifen und den Kern des Informationsverlangens der Anfrage wahrheitsgemäß zu erfüllen21VerfGHE 54, 62/77.. Insoweit ist die Fragestellung genau in den Blick zu nehmen. Wird daher nur im Zusammenhang mit einem Koalitionsvertrag auf Bundesebene angefragt, ob die Staatsregierung ebenfalls rechtspolitischen Handlungsbedarf sieht und eine eigene Bundesratsinitiative plant, so ist diese Frage selbstverständlich zu beantworten.
Eine sorgsame Prüfung des Verantwortungsbereiches der Staatsregierung ist auch immer dann angezeigt, wenn das parlamentarische Fragerecht und das kommunale Selbstverwaltungsrecht aufeinandertreffen. Das Selbstverwaltungsrecht ist eines der tragenden Grundprinzipien unseres demokratischen Gemeinwesens und verfassungsrechtlich abgesichert22Art. 10 und 11 BV sowie auf Bundesebene Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG.. Die Staatsregierung ist daher bei entsprechenden Anfragen stets gehalten, ihre (eingeschränkten) aufsichtlichen Möglichkeiten im Blick zu behalten und zu prüfen, ob überhaupt fach- oder rechtsaufsichtlicher Handlungsspielraum besteht23Zu der notwendigen Differenzierung bei der Aufgabenwahrnehmung von Gemeinden im übertragenen und eigenen Wirkungskreis ausführlich und überzeugend VerfGHE 59, 144/180 f.. Ist ein solcher von vornherein nicht ersichtlich und auch nicht vorgetragen, ist der Verantwortungsbereich der Staatsregierung nicht eröffnet. In derartigen Sachverhaltskonstellationen sollte von einer bayernweiten Datenerhebung bei Gemeinden, Landkreisen oder Bezirken nicht nur mit Blick auf den erheblichen Arbeitsaufwand24Vgl. hierzu gesondert unter VIII., sondern auch und gerade angesichts der verfassungsrechtlichen Bedeutung des Selbstverwaltungsrechts Abstand genommen werden. Gegenüber dem Anfragenden hat die Staatsregierung spiegelbildlich ihre fehlende Verantwortlichkeit anhand der konkreten Anfrage entsprechend den üblichen Vorgaben nachvollziehbar zu begründen25Zum Begründungserfordernis s. o. unter III..
V. Grenzen der Antwortpflicht – Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung
Das parlamentarische Fragerecht muss auch dann zurücktreten, sofern der so genannte Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung unmittelbar betroffen ist26Vgl. hierzu schon VerfGHE 54, 62/74 m. w. N.; Möstl, a. a. O., Art. 13 Rn. 22; Huber, a. a. O., Art. 13 Rn. 18, Art. 43 Rn. 10; Lennartz/Kiefer, a. a. O., 191..
Die Eigenständigkeit sowie die Unabhängigkeit der internen Willensbildung der Regierung und damit die Aufgabenerfüllung im Rahmen der Staatsleitung darf durch das Fragerecht nicht beeinträchtigt werden27 VerfGHE 64, 70/81.. Dies ist Grundbedingung dafür, dass die Staatsregierung ihrer Verantwortung gegenüber Parlament und Volk gerecht werden kann28VerfGHE 64, 70/81.. Die Wahrnehmung dieser Aufgabe setzt notwendigerweise einen Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung voraus, der einen Initiativ-, Beratungs- und Handlungsbereich umfasst, auf den sich die parlamentarische Kontrolle nicht erstreckt29VerfGHE 64, 70/81.. Dazu gehört die Willensbildung der Regierung selbst, sowohl hinsichtlich der Erörterungen im Kabinett als auch bei der Vorbereitung von Kabinetts- und Ressortentscheidungen, die sich vornehmlich in ressortübergreifen-den und -internen Abstimmungsprozessen vollzieht30VerfGHE 64, 70/81..
Ein „Mitregieren“ des Parlaments oder sonstiger Dritter31So wörtlich VerfGHE 64, 70/82. ist in der Verfassung nicht vorgesehen und muss ausgeschlossen werden32So auch Möstl, a. a. O., Art. 13 Rn. 22.. Besonders stark ist der Schutz, solange die Willensbildung noch nicht abgeschlossen ist und andauert33Möstl, a. a. O., Art. 13 Rn. 22..Laufende Verhandlungen und Entscheidungsvorbereitungen genießen zur Wahrung eigenverantwortlicher Kompetenzausübung der Regierung hohen Schutz34Huber, a. a. O., Art. 43 Rn. 10.. Die Kontrollkompetenz des Parlaments umfasst nicht die Befugnis, laufende Verhandlungen und Entscheidungsvorbereitungen auszuforschen, um die interne Regierungsarbeit gleichsam von außen zu begleiten35VerfGHE 64, 70/85..
Sofern es sich um abgeschlossene Vorgänge handelt, soll ein weiterhin unantastbarer Bereich verbleiben, der „Spielraum“36So wörtlich Möstl, a. a. O., Art. 13 Rn. 22. jedoch größer werden, mit anderen Worten: Das parlamentarische Kontrollrecht kann wieder greifen. Die entsprechende Grenzziehung ist im Einzelfall freilich schwierig. In der so genannten Resonanzstudienentscheidung37VerfGHE 64, 70 ff., bei der es um die Offenlegung bestimmter Umfrageergebnisse und Unterlagen ging, wurde dabei zwischen den Unterlagen selbst (allenfalls Entscheidungsgrundlage) und dem eigentlichen, dem Kernbereichsschutz unterliegenden Entscheidungsprozess unterschieden38Möstl, a. a. O., Art. 13 Rn. 22; kritisch zur entsprechenden Differenzie- rung Schwarz, Grund und Grenzen der parlamentarischen Kontrolle der Regierung, BayVBl. 2012, 161/165 f..
Um die Thematik im Einzelfall aufzulösen, bedarf es nach hiesiger Auffassung auch hier einer Abwägung39Ebenso Huber, a. a. O., Art. 13 Rn. 18; Harks, a. a. O., S. 981; Möstl, a. a. O., Art. 13 Rn. 22.. Der Kernbereichsschutz sollte nicht als absoluter Schutzbereich missverstanden werden40Zutreffend Möstl, a. a. O., Art. 13 Fn. 76.. Ein in der Einleitung provokant erwähnter umfassender „anfragefreier Raum“ besteht nicht. Erforderlich ist vielmehr, in jedem Einzelfall das parlamentarische Informationsinteresse mit dem Kernbereichsschutzerfordernis abzuwägen. Je stärker der Willensbildungsprozess und die Entscheidungsfindung selbst betroffen ist, umso schutzwürdiger sind die entsprechenden Informationen, und eine Antwort kann verweigert werden41Huber, a. a. O., Art. 13 Rn. 18.. Geht es inhaltlich lediglich um vorbereitende Vorgänge wie beispielsweise Datenerhebungen, dürfte dem parlamentarischen Fragerecht hingegen der Vorrang zukommen.
Praxisbeispiel:
Ausgehend von diesen Grundsätzen dürfte die Staatsregierung die Antwort auf eine Anfrage, die auf eine konkrete Mitteilung von Einzelheiten aus einer Ministerratsvorlage abzielt, die eine Bundesratsinitiative zur Änderung einer StGB-Vorschrift zum Inhalt hat, jedenfalls so lange verweigern, bis ein Kabinettsbeschluss zur Frage der Einbringung vorliegt.
Der Beitrag stammt aus den BayVBl. Heft 3/2024, Seite 73.
----------
- 1VerfGHE 54, 62/74; 59, 144/178; 64, 70/81; 67, 216/225.
- 2VerfGHE 54, 62/74; 59, 144/178; 64, 70/81; 67, 216/225.
- 3VerfGHE 54, 62/74.
- 4Lennartz/Kiefer, a. a. O., 186.
- 5StRspr: VerfGHE 54, 62/74; 64, 70/82; 67, 216/227 sowie Huber, a.a.O., Art. 13 Rn. 20; Möstl, a. a. O., § 13 Rn. 25.
- 6VerfGHE 64, 70/82; 67, 216/226.
- 7VerfGHE 67, 216/227.
- 8Glauben, a. a. O., 755; Huber, a. a. O., Art. 13 Rn. 22 sowie VerfGHE 67, 216/227.
- 9VerfGHE 54, 62/74.
- 10Lennartz/Kiefer, a. a. O., 187; zutreffend und plakativ für die Bundesregierung auch Harks, a. a. O., S. 980 „Antwortpflicht nur für Bereiche, zu denen sie „etwas zu sagen hat““.
- 11Vgl. dazu oben unter II. „Angelegenheiten, für die die Staatsregierung un- mittelbar oder mittelbar zuständig/verantwortlich ist“.
- 12Huber, a. a. O., Art. 13 Rn. 17.
- 13Art. 43 Abs. 2 BV; zur Besonderheit bei Handlungen von Regierungsmitgliedern, die keinen unmittelbaren Bezug zum Amt haben (Beschäftigung von Familienangehörigen in der Eigenschaft als MdL) vgl. ausführlich VerfGHE 67, 153/165 ff.
- 14Huber, a. a. O., Art. 13 Rn. 17.
- 15Huber, a. a. O., Art. 13 Rn. 17 mit zutreffendem Hinweis, dass rein privateBereiche, wie etwa die Verhältnisse bei allein privat getragenen Unterneh-men, nur dann Gegenstand von parlamentarischen Anfragen sein kön-nen, wenn im Einzelfall ausnahmsweise ein Bezug zur Verantwortlichkeit der Staatsregierung besteht.
- 16§§ 148 f. GVG.
- 17§ 147 Nr. 1 GVG.
- 18Vgl. hierzu auch § 142a GVG.
- 19Zur umstrittenen Rechtsnatur Kloepfer, Koalitionsvereinbarungen – unver- bindlich, aber rechtlich relevant, NJW 2018, 1799 ff.
- 20Kloepfer, a. a. O., 1800.
- 21VerfGHE 54, 62/77.
- 22Art. 10 und 11 BV sowie auf Bundesebene Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG.
- 23Zu der notwendigen Differenzierung bei der Aufgabenwahrnehmung von Gemeinden im übertragenen und eigenen Wirkungskreis ausführlich und überzeugend VerfGHE 59, 144/180 f.
- 24Vgl. hierzu gesondert unter VIII.
- 25Zum Begründungserfordernis s. o. unter III.
- 26Vgl. hierzu schon VerfGHE 54, 62/74 m. w. N.; Möstl, a. a. O., Art. 13 Rn. 22; Huber, a. a. O., Art. 13 Rn. 18, Art. 43 Rn. 10; Lennartz/Kiefer, a. a. O., 191.
- 27VerfGHE 64, 70/81.
- 28VerfGHE 64, 70/81.
- 29VerfGHE 64, 70/81.
- 30VerfGHE 64, 70/81.
- 31So wörtlich VerfGHE 64, 70/82.
- 32So auch Möstl, a. a. O., Art. 13 Rn. 22.
- 33Möstl, a. a. O., Art. 13 Rn. 22.
- 34Huber, a. a. O., Art. 43 Rn. 10.
- 35VerfGHE 64, 70/85.
- 36So wörtlich Möstl, a. a. O., Art. 13 Rn. 22.
- 37VerfGHE 64, 70 ff.
- 38Möstl, a. a. O., Art. 13 Rn. 22; kritisch zur entsprechenden Differenzie- rung Schwarz, Grund und Grenzen der parlamentarischen Kontrolle der Regierung, BayVBl. 2012, 161/165 f.
- 39Ebenso Huber, a. a. O., Art. 13 Rn. 18; Harks, a. a. O., S. 981; Möstl, a. a. O., Art. 13 Rn. 22.
- 40Zutreffend Möstl, a. a. O., Art. 13 Fn. 76.
- 41Huber, a. a. O., Art. 13 Rn. 18.