Neutralität im Amt
Kommunale Demokratie zwischen politischer Verantwortung und rechtlicher Zurückhaltung
Neutralität im Amt
Kommunale Demokratie zwischen politischer Verantwortung und rechtlicher Zurückhaltung
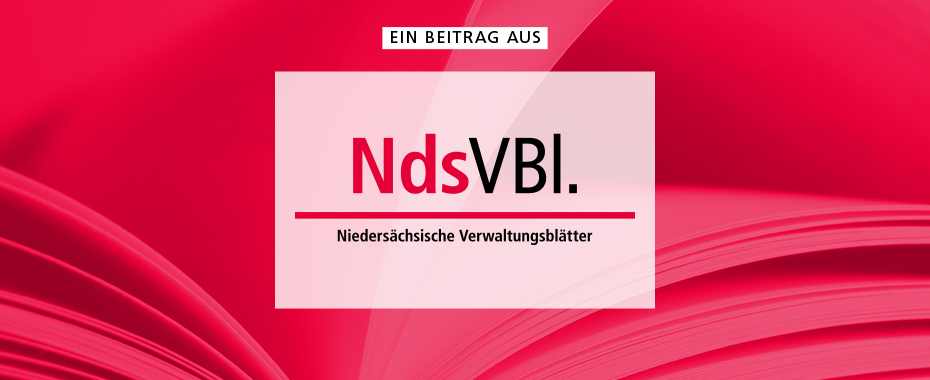
Krisenzeiten stellen auch die Kommunen vor große Herausforderungen. Dies gilt nicht nur mit Blick auf ihre Verwaltungsstrukturen, Partizipationsprozesse und Finanzierungsgrundlagen, sondern auch und gerade hinsichtlich der demokratischen Auseinandersetzung mit verfassungsfeindlichen Parteien, Positionen und Personen. Zu oft hat sich die kommunale Ebene in der jüngeren Vergangenheit auf einen offenen Schlagabtausch mit den „Feinden der Freiheit” eingelassen und wurde hierfür gerichtlich in die Schranken gewiesen sowie an ihre Neutralitätsverpflichtung erinnert. Die lokale Demokratie erweist sich demgegenüber vor allem dann als resilient, wenn sie demokratische Grundregeln beachtet, den politischen Wettbewerb nicht verzerrt, nicht in kalkulierten Rechtsungehorsam flüchtet und auf die Kraft der freien politischen Auseinandersetzung vertraut.
I. Kommunalpolitik als Krisenpolitik
Zum Wesen einer vitalen Demokratie gehört der Austausch von Argumenten in einem offenen, d. h. machtfreien Diskurs. Das gilt gerade dann, wenn existenzielle Fragen für das Gemeinwesen und seine Zukunft auf dem Spiel stehen. Wir leben in einer Zeit großer gesellschaftspolitischer Unsicherheit. Dabei entspricht es den Eigengesetzlichkeiten der Globalisierung, dass die betreffenden Krisenphänomene und Bedrohungsszenarien nicht an Landesgrenzen oder Stadtmauern haltmachen, sondern über kurz oder lang vor der eigenen Haustür, in den Kreisen und Gemeinden, ankommen. Kommunalpolitik ist im Ergebnis zunehmend Krisenpolitik. Nach der Finanz- und Wirtschaftskrise,1 der Flüchtlingskrise2 und der Corona-Krise,3 deren Nachwirkungen bis heute nachhallen, wird das politische Handeln auf allen föderalen Ebenen mittlerweile durch den Krieg in der Ukraine4 und den Nahostkonflikt5 mit ihren jeweiligen wirtschaftlichen und sozialen Verwerfungen geprägt. Jede dieser Krisen hat Engpässe, Schwachstellen und zum Teil erhebliche Finanzierungsbedarfe in der öffentlichen Daseinsvorsorge aufgezeigt. Hinzu treten die sozial-ökologischen Herausforderungen durch den demografischen Wandel,6 den Klimawandel7 sowie die damit verbundene Energie- und Mobilitätswende.8
Krisen sind – und waren schon immer – Treiber von Radikalisierung und Extremismus.9 Sie spielen denjenigen in die Karten, die sich als „Alternative” zum politischen „Mainstream” inszenieren, einfache Antworten auf komplexe Fragen in Zeiten großer Herausforderungen proklamieren und Sündenböcke wie Feindbilder präsentieren. Wie aktuell und bedeutsam dieses Thema ist, zeigt sich zum einen daran, dass Hass, Bedrohungen und Anfeindungen im analogen wie digitalen Raum gegenüber kommunalen Amts- und Mandatsträgern ein besorgniserregendes Ausmaß erreicht haben, mit fatalen Folgen für die lokale Demokratie.10 Zum anderen ringen die demokratischen Parteien auf kommunaler Ebene noch immer um den richtigen Umgang mit dem politischen Gegner aus dem rechten Spektrum und seinen bisweilen unverhohlen verfassungsfeindlichen Positionen.11
II. Dimensionen (partei-)politischer Neutralität auf kommunaler Ebene
Von kommunalen Amtsträgerinnen und Amtsträgern wird erwartet, dass sie demokratische Grundregeln beachten, um den politischen Wettbewerb nicht zu gefährden. Insbesondere dürfen sie die Autorität ihres Amtes und die Ressourcen der Gemeinde nicht einsetzen, um den freien politischen Wettstreit zu behindern oder zu beeinflussen, und sei es auch in wohlmeinender, die Werte des Grundgesetzes vermeintlich schützender Absicht. Dieses Anliegen wird allgemein unter dem Begriff staatlicher „Neutralitätsverpflichtung” verhandelt, wobei die Pflicht zu (partei-)politischer Neutralität keine eigenständige Verfassungsverpflichtung begründet,12 sondern als Hintergrundnorm sowohl bei der Chancengleichheit der Parteien als auch beim freien Mandat der Abgeordneten sowie den politischen Grundrechten (insbesondere der Gleichheit der Wahl) von Bürgerinnen und Bürger begegnet.13 Das Gebot (partei-)politischer Neutralität ist damit gleichermaßen „Baugesetz eines freien demokratischen Prozesses”, „Garant chancengleichen Wettbewerbs” und „liberale[s] Versprechen”.14 Es wird flankiert von allgemeinen Grundsätzen für rechtsstaatliches Verhalten in der Ausprägung des Willkürverbots und des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes sowie von spezifischen Komponenten zur Sicherung eines demokratischen Diskurses.15 Dies schlägt sich vor allem in den Geboten der Sachlichkeit und inhaltlichen Richtigkeit nieder.16
Dass der Zweck die Mittel nicht heiligt, ist ein Gemeinplatz, der eigentlich keiner Erklärung bedarf. Gerichtliche Entscheidungen aus jüngerer Zeit belegen jedoch, dass diese selbstverständlich erscheinenden Vorgaben immer wieder – und immer häufiger – auf gerichtliche Durchsetzung angewiesen sind. Werden die Spielregeln des demokratischen Prozesses dabei seitens der verantwortlichen Entscheidungsträger gezielt unterlaufen und wird mehr oder weniger offen mit einem moralisch motivierten Rechtsungehorsam kalkuliert und kokettiert,17 beschädigt dies nicht nur das Grundvertrauen in die demokratischen Institutionen, sondern bestärkt den Populisten auch noch in seiner Opferrolle.
Im Folgenden soll das Thema der „Neutralität im Amt” auf kommunaler Ebene in drei Schritten beleuchtet werden: Zunächst wird ein Blick auf die demokratischen Grundregeln im kommunalen Inter- und Intraorganverhältnis geworfen (1.). Dabei sollen mit der Gleichbehandlung der Fraktionen und dem freien Mandat der Ratsmitglieder zwei Grundpfeiler des Kommunalverfassungsrechts im Vordergrund stehen. Im Anschluss daran wendet sich der Beitrag dem freien Wettbewerb der Parteien auf kommunaler Ebene zu und widmet sich u. a. mit dem Zugang zu öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde einem veritablen „Dauerbrenner” des Verwaltungsrechts (2.). Zum Abschluss sollen die Anforderungen beleuchtet werden, durch die ein offener und staatlich unbeeinflusster Diskurs unter den Kommunalbürgerinnen und Kommunalbürgern gewährleistet werden soll (3.).
1. Neutralität im Inter- und Intraorganverhältnis
Zum Kern des in Art. 20 Abs. 1 und 2 GG verankerten Demokratieprinzips gehört der freie und offene Wettbewerb um die Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger in Streitfragen des Gemeinwesens.18 Das Recht der politischen Parteien auf Chancengleichheit nach Art. 21 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 GG hat seinen Grund im demokratischen Recht der Bürgerinnen und Bürger auf gleiche Teilhabe an der politischen Willensbildung.19 Auch in Gemeinden und Kreisen gilt es, den Streit um die beste Lösung offen und nach demokratischen Regeln auszutragen.20 Stellvertretend hierfür normiert Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG, dass die Wahl einer Vertretung in den Gemeinden und Kreisen nach den anerkannten Wahlrechtsgrundsätzen zu erfolgen hat.21
Darüber hinaus sind die Gemeinden und Kreise bzw. deren Organe in umfassender Weise verpflichtet, die sich aus dem Demokratieprinzip ergebenden, mitunter grundrechtlich radizierten Maßgaben im Wettbewerb um das bessere Argument einzuhalten. Dies gilt hinsichtlich der offenen und freien Meinungsbildung innerhalb der Bürgerschaft wie auch für die körperschaftsinternen Prozesse der Entscheidungsfindung etwa in Gemeinderat und Kreistag. Mit Gemeinde- und Kreisordnung steht ein normativer Rahmen bereit, innerhalb dessen sich nach näher definierten Zuständigkeiten die Entscheidungsfindung zwischen den widerstreitenden politischen Positionen vollziehen soll. Die normierten Kompetenzen sind eingeräumt, um den offenen Prozess der Meinungsbildung in einem geordneten Verfahren zu ermöglichen und dieses mit einer Entscheidung abzuschließen.22
a) Gleichbehandlung der Fraktionen
Damit der Wettbewerb um die beste Lösung gelingen kann, gilt es, nicht nur die in Gemeinde- und Kreisordnung ausdrücklich normierten Vorgaben zu beachten, sondern auch darüberhinausgehende Regeln des politischen Wettbewerbs einzuhalten. Diese sind indes – das sei hier vorangestellt – von unterschiedlicher Verbindlichkeit. Zum Teil handelt es sich mehr um Fragen des demokratischen Stils als um „harte”, sprich rechtsverbindliche und justitiable Vorgaben. Zu solchen Stilfragen gehört etwa die beharrliche Weigerung, einen AfD-Abgeordneten zu einem der Vizepräsidenten des Deutschen Bundes- oder eines Landtags zu wählen. Wie der nordrhein-westfälische Verfassungsgerichtshof23 und das Bundesverfassungsgericht24 übereinstimmend festgestellt haben, ist ein solches Vorgehen mit höherrangigem Recht vereinbar: Weder aus Art. 40 Abs. 1 Satz 1 GG noch aus Art. 18 Abs. 1 der niedersächsischen Landesverfassung folgt ein Anspruch der Fraktionen, aus ihren Reihen eine Vizepräsidentin bzw. einen Vizepräsidenten zu stellen. Es entspricht vielmehr der Freiheit der Abgeordneten, mit Mehrheit sowohl über die Zahl der Stellvertreterinnen und Stellvertreter im Parlamentspräsidium als auch über die jeweils zur Wahl stehenden Personen zu bestimmen.25
aa) Fraktionsmindeststärke
So klar die Verfassungsrechtslage in diesem Punkt auch sein mag, so offenkundig ist indes das Unbehagen, welches eine solche Handhabung der parlamentarischen Usancen mit Blick auf die Rechts- und Verfassungskultur auslöst.26 In dieselbe Kategorie gehört es, wenn in der Geschäftsordnung eines neu gewählten Stadtrats die notwendige Zahl von Stadträten für eine Fraktion – anlassbezogen – von zwei auf drei erhöht wird, namentlich um den beiden jüngst gewählten AfD-Ratsmitgliedern den Fraktionsstatus und die damit verbundenen Privilegien wie die Mitgliedschaft in Ausschüssen, das Recht der Fraktion auf Einberufung der Vertretung durch den Bürgermeister bzw. Landrat und das Vorschlagsrecht für die Tagesordnung vorzuenthalten.27 Auf ein solches Vorgehen hatte sich eine Mehrheit im Regensburger Stadtrat im März 2020 geeinigt.28
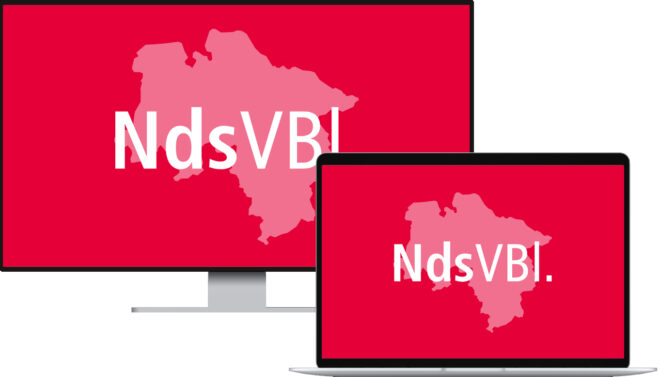 Von derartigen Stilfragen der Demokratie sind verbindliche demokratische Grundregeln zu unterscheiden. Während in Bayern29 und anderen Ländern die Voraussetzungen für die Entstehung und den Bestand einer Fraktion gesetzlich nicht oder nur ansatzweise unter Verweis auf nähere Bestimmungen in den jeweiligen Geschäftsordnungen geregelt sind – aus diesem Grund war die Erhöhung der notwendigen Mitgliederzahl in Regensburg formal-juristisch einwandfrei –,30 sind die Gemeindeordnungen und Kommunalverfassungen der Mehrzahl der Länder – Niedersachsen eingeschlossen – verbindlicher gefasst und sehen eine Fraktionsmindeststärke von zwei oder drei Ratsmitgliedern, bisweilen differenziert nach Einwohnerstärke, vor.31
Von derartigen Stilfragen der Demokratie sind verbindliche demokratische Grundregeln zu unterscheiden. Während in Bayern29 und anderen Ländern die Voraussetzungen für die Entstehung und den Bestand einer Fraktion gesetzlich nicht oder nur ansatzweise unter Verweis auf nähere Bestimmungen in den jeweiligen Geschäftsordnungen geregelt sind – aus diesem Grund war die Erhöhung der notwendigen Mitgliederzahl in Regensburg formal-juristisch einwandfrei –,30 sind die Gemeindeordnungen und Kommunalverfassungen der Mehrzahl der Länder – Niedersachsen eingeschlossen – verbindlicher gefasst und sehen eine Fraktionsmindeststärke von zwei oder drei Ratsmitgliedern, bisweilen differenziert nach Einwohnerstärke, vor.31
bb) Fraktionsanerkennung
Für die Fraktionsbildung bedarf es grundsätzlich keines konstitutiven, anerkennenden Aktes seitens des Bürgermeisters oder der Gesamtvertretung. Ein entsprechender Anerkennungsakt ist auch nicht vorgesehen, wenn sich Ratsmitglieder unterschiedlicher Parteizugehörigkeit zu einer Fraktion in der Kommunalvertretung zusammenschließen. Praktisch relevant werden solche Zusammenschlüsse, wenn die einer Partei angehörenden Ratsmitglieder allein die (gesetzlich) geforderte Mindestgröße für die Fraktionsbildung nicht erreichen. Wenn ein Oberbürgermeister in dieser Situation die Gewährung der im Gesetz vorgesehenen Fraktionsrechte verweigert, weil er die vermeintlich erforderliche Anerkennung noch nicht ausgesprochen habe, entbehrt diese Ungleichbehandlung mit den anderen Fraktionen jeder Rechtfertigung und kann nur als Versuch angesehen werden, in undemokratischer Weise und unter Verletzung des Neutralitätsprinzips den politischen Gegner zu benachteiligen.32 Bedarf es daher keiner konstitutiven Anerkennung, so besteht in Fällen politisch extrem heterogener Zusammensetzung gleichwohl besonderer Anlass, festzustellen, ob die erforderliche grundsätzliche politische Übereinstimmung gegeben ist oder ob lediglich ein formaler Zusammenschluss zur Erlangung finanzieller Vorteile oder einer stärkeren Rechtsposition für die Verfolgung der uneinheitlichen individuellen politischen Ziele der einzelnen Mitglieder vorliegt.33 Demgegenüber ergibt sich bei einem Zusammenschluss aus Personen, die für ein und dieselbe Partei oder Wählergruppe angetreten sind, bereits aus dem Parteizusammenschluss bzw. dem mitgliedschaftlich organisierten Zusammenschluss der Wahlberechtigten zum Zwecke gemeinsamer Wahlvorschläge, dass auf der Grundlage grundsätzlicher politischer Übereinstimmung ein möglichst gleichgerichtetes Wirken erfolgen soll. Weiterer Indizien bedarf es im letztgenannten Fall regelmäßig nicht.34
cc) Fraktionsfinanzierung
Erfolgreiche Fraktionsarbeit hängt zudem nicht nur von Engagement und Geschick ihrer Mitglieder, sondern auch von gewissen materiellen Rahmenbedingungen ab.35 Aus diesem Grund haben die Fraktionen einen kommunalverfassungsrechtlich begründeten Anspruch auf Zuwendungen aus gemeindlichen Haushaltsmitteln.36 Die Bestimmung der Höhe der Zuwendungen steht im pflichtgemäßen Ermessen der Gemeinde. Ermessensgrenzen bilden das Willkürverbot, der Grundsatz der Chancengleichheit und das daraus folgende Neutralitätsgebot.37 Hier mag sich aus gemeindlicher Perspektive die Frage aufdrängen, ob nicht Fraktionen aus Vertretern erkennbar verfassungsfeindlicher Parteien bzw. (Wähler-)Vereinigungen von der Fraktionsfinanzierung ausgenommen werden können. Warum sollte der freiheitlich-demokratische Verfassungsstaat die Negierung seiner Werte und Bekämpfung seiner Strukturen auch noch finanzieren, und sei es „nur” auf der kommunalen Ebene? Dieselbe Frage hatte man sich wohl im hessischen Büdingen gestellt und im Jahr 2017 einen Vorstoß vor dem Hintergrund gewagt, dass das Bundesverfassungsgericht die NPD zwar nicht für verfassungswidrig erklärt, aber einen Ausschluss von der staatlichen Parteienfinanzierung angeregt hatte.38 Hier dachten sich die Kämmerer offenbar: Gehen wir mit gutem Beispiel voran!
Das Bundesverwaltungsgericht fand diesen Vorstoß weniger gelungen und erklärte die entsprechende Satzungsänderung im Normenkontrollverfahren für unwirksam.39 Sie sei mit dem Parteienprivileg des Grundgesetzes und der Chancengleichheit der Parteien (Art. 21 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 GG) offensichtlich unvereinbar. Das Gleiche gilt für eine satzungsrechtliche Ungleichbehandlung von Fraktionen aus Vertretern verfassungsfeindlicher (Wähler-)Vereinigungen. Ebenso wie Art. 21 Abs. 2 und 4 GG schließt Art. 9 Abs. 2 GG jede Benachteiligung von Fraktionen wegen einer Zugehörigkeit ihrer Mitglieder zu verfassungsfeindlichen Vereinigungen so lange aus, bis in einem förmlichen Verfahren (vgl. § 3 VereinsG) festgestellt wird, dass die Vereinigung verboten ist.40
Nun mag man fragen, ob nicht die zwischenzeitliche Einführung des Finanzierungsausschlussverfahrens in Art. 21 Abs. 3 GG,41 § 46 a BVerfGG42 und die konstitutive Feststellung der Verfassungsfeindlichkeit der NPD-Nachfolgepartei „Die Heimat” durch das Bundesverfassungsgericht43 hieran etwas geändert haben könnte. Können also zumindest nach gegenwärtiger Rechtslage Fraktionen aus Vertretern verfassungsfeindlicher Parteien – namentlich solcher, die das Bundesverfassungsgericht von der staatlichen Finanzierung ausgeschlossen hat – auch von gemeindlichen Zuwendungen ausgenommen werden? Die Antwort ist Nein: Ein „kommunalpolitisches Mandat zum Verfassungsschutz”44 gibt es nicht, jedenfalls nicht in dieser Form.45 Art. 21 Abs. 3 GG ermächtigt nur zum bundesgesetzlichen Ausschluss von der Parteienfinanzierung i. S. d. Parteiengesetzes.46 Diese bezieht sich auf die Mitwirkung der Parteien an der politischen Willensbildung des Volkes, die dem gesellschaftlichen Bereich zuzuordnen ist.47 Sie hat die Beteiligung an Wahlen und das Erringen von Mandaten zum Ziel. Der Ausschluss von Fraktionszuwendungen betrifft demgegenüber die Finanzierung der Arbeit einer Untergliederung der demokratisch gewählten Volksvertretung, die als Tätigkeit eines staatlichen Organs oder Organteils von vornherein dem staatlichen Bereich zuzuordnen ist.48 Das gilt auch für die Tätigkeit der kommunalen Fraktionen als Untergliederungen der Gemeindevertretung. Fraktionszuwendungen sind auch nicht zur Finanzierung der „hinter” den Fraktionen stehenden Parteien bestimmt und dürfen nicht entsprechend zweckentfremdet werden.49 Wenngleich eine Abgrenzung im Einzelfall schwierig sein mag und in der Praxis vielfach unterlaufen wird, vorschnell aufgegeben werden sollte sie nicht.50 Die Ablehnung eines materiellen Durchgriffs auf die Partei bei der Entscheidung über Fraktionszuwendungen mag man bedauerlich finden, die politischen Erwartungen an das Recht und seine Leistungsfähigkeit im politischen Wettbewerb sollten jedoch nicht überdehnt werden.51
dd) Sonstige Fraktionsrechte
Zu den typischen Mitwirkungsrechten52 der Fraktionen auf Gemeinde- und Landkreisebene gehört es ferner, dass sie Beratungsgegenstände auf die Tagesordnung bringen können.53 Dem Bürgermeister bzw. der Landrätin steht es dabei grundsätzlich nicht zu, ein von ihm oder ihr nicht für sinnhaft erachtetes Begehren abzulehnen. Dies gilt zumal dann, wenn sie auf einer politischen Bewertung oder inhaltlichen Vorwegnahme der Entscheidung der Vertretung beruht.54 Nicht zuletzt im Zusammenhang mit Migration und Flüchtlingsunterbringung kam es in der jüngeren Vergangenheit zu einer bemerkenswerten Häufung rechtswidriger Beschneidungen des Vorschlagsrechts, die von der Rechtsprechung korrigiert werden mussten. So haben unter anderem die Verwaltungsgerichte in Düsseldorf55, Karlsruhe56 und Gera57 die betreffenden Gemeinden und Kreise dazu verpflichtet, Tagungsordnungspunkte zu Themen wie „Erarbeitung einer adäquaten Reaktion auf den ungebremsten Zustrom von Asylbewerbern” oder „Bereitstellung hinreichenden Personals, um nicht asylberechtigte Personen im Stadtgebiet ihrer rechtmäßigen Abschiebung in die Heimat zuzuführen” nachträglich zuzulassen.58
b) Freies Mandat der Ratsmitglieder
Für den demokratischen Wettbewerb im Inter- bzw. Intraorganverhältnis ist neben dem Fraktionsstatus vor allem das freie Mandat der Ratsmitglieder von Bedeutung.59 Zum Zwecke der sachgerechten Ausübung dieses Mandats stehen den Ratsmitgliedern verschiedene Statusrechte in Form spezifischer Mitwirkungsrechte zu, namentlich das Rederecht, das Recht auf Teilnahme an den Ratssitzungen, das Antrags-, Beratungs- und Stimmrecht sowie das Recht auf Information.60 Diese Rechte werden ergänzt durch ein Statusrecht auf Intraorgantreue, welches nach ständiger Rechtsprechung aus dem freien Mandat in Verbindung mit dem Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB analog) sowie in Verbindung mit dem verfassungsrechtlichen Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme hergeleitet wird.61 Wenngleich die dogmatische Herleitung durchaus gewagt erscheint, überzeugt sie im Ergebnis mit Blick auf das Binnenverhältnis in den Räten, das insbesondere von einem rechtsmissbräuchlichen Verhalten freigehalten werden muss.
Aus dem Grundsatz der Organtreue folgt ein Recht jedes Ratsmitglieds, von unsachlichen und herabwürdigenden Äußerungen verschont zu bleiben. Dieses Recht kann verletzt sein, wenn einem Ratsmitglied in öffentlicher Ratssitzung durch den sitzungsleitenden Oberbürgermeister bescheinigt wird, dass es „lediglich über ein eingeschränktes Demokratieverständnis” verfüge. Mit recht zweifelhafter Argumentation hat der VGH Baden-Württemberg die Feststellungsklage in dem betreffenden Kommunalverfassungsstreit unter Verweis darauf abgewiesen, der Oberbürgermeister habe die Äußerung aus Sicht einer verständigen Bürgerin bzw. eines verständigen Bürgers nicht in amtlicher Funktion, sondern in Wahrnehmung seines Rederechts als einfaches und zum politischen Schlagabtausch befugtes Mitglied des Gemeinderates getätigt.62 Man kann tunlichst bezweifeln, ob der objektive Empfängerhorizont eines mündigen und verständigen Bürgers als Maßstab für die Abgrenzung zwischen Amtsausübung und davon zu trennender Stellungnahme als Parteipolitiker überhaupt taugt.63 Zieht man diesen objektivierten Maßstab mit der herrschenden Rechtsprechung gleichwohl heran, hätte dieser in dem vorliegenden Fall – bei allen Abgrenzungsschwierigkeiten im Detail – indes eine gegenteilige Entscheidung nahegelegt. Denn dass der Oberbürgermeister die Äußerung von seinem besonderen Sitzplatz als Ratsvorsitzender aus gehalten hat,64 spielte für den Senat genauso wenig eine Rolle wie der Umstand, dass er unmittelbar im Anschluss in amtlicher Funktion über einen Antrag des Ratsmitglieds abstimmen ließ.65 Ausgehend von der Süddeutschen Ratsverfassung kennt die baden-württembergische Gemeindeordnung zwei Organe mit einer jeweils starken Stellung: „Rat” und „Bürgermeister”.66 Auch unter Berücksichtigung der anspruchsvollen Doppelrolle des Bürgermeisters als oberster Repräsentant und Vertreter der Gemeinde einerseits und bloßes Mitglied des Gemeinderats andererseits dürfte die Annahme einer Äußerung als schlichtes Ratsmitglied eher auf eine Fiktion denn auf eine realistische Einschätzung der Perspektive eines verständigen Durchschnittsbürgers hinauslaufen. So betont auch der VGH Baden-Württemberg zutreffend, dass der verständige Bürger den Bürgermeister im Zweifel als Amtsträger und nicht als bloßes Mitglied des Gemeinderats wahrnehme.67
So schwierig die Abgrenzung zwischen Amt und Mandat im Einzelfall nicht zuletzt in der kommunalen Praxis auch sein mag,68 so eindeutig ist der Fall demgegenüber, wenn ein Oberbürgermeister bei einer städtischen Veranstaltung im Rahmen einer Laudatio – geschmückt mit der Amtskette und unter Verleihung des Goldenen Ehrenrings der Stadt – die AfD als „Feinde der Demokratie” bezeichnet.69 Aufgrund der Gesamtumstände war in dieser Konstellation offensichtlich, dass die Äußerung nicht als Privatperson, sondern als Amtsträger getätigt wurde.70 Als solcher hat der Oberbürgermeister das – nicht nur in Wahlkampfzeiten71 – geltende Neutralitätsgebot zu beachten, das zur Wahrung des Rechts auf Chancengleichheit im politischen Wettbewerb diskriminierende Äußerungen über politische Parteien verbietet. Zwar kann ein Oberbürgermeister, der als Stadtoberhaupt die Gemeinde nach außen repräsentiert, auch als solcher in politischen Debatten Stellung beziehen.72 Dies rechtfertigt aber nicht eine gezielte und tendenziöse Herabsetzung des politischen Gegners.73
Entnommen aus den NdsVBl. Heft 3/2025.


