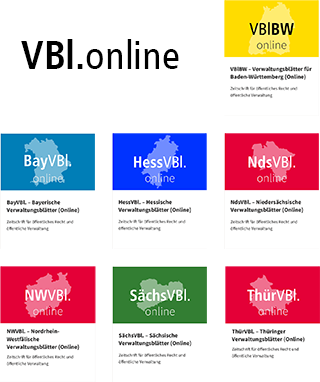Grundsteuerreform
Warum kompliziert und unfair, wenn es auch einfach und fair geht?
Grundsteuerreform
Warum kompliziert und unfair, wenn es auch einfach und fair geht?

Das vom Bundesgesetzgeber beschlossene Grundsteuermodell ist kompliziert und unfair. Die beschlossene Grundsteuerreform eröffnet aber jedem Bundesland die Möglichkeit, stattdessen ein eigenes einfaches und zugleich faires Grundsteuermodell zu beschließen.
1 Das beschlossene Grundsteuermodell ist kompliziert und unfair
Der Bundestag hat am 18. Oktober 2019 die Grundsteuerreform ohne nennenswerte Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Gesetzentwurf beschlossen, die erforderliche Zustimmung des Bundesrats gilt als sicher. Damit wird die Grundsteuerreform – wie vom Bundesverfassungsgericht gefordert – noch 2019 in Kraft treten.
Das beschlossene Grundsteuermodell (im Folgenden als BMF-Modell bezeichnet) ist unnötig kompliziert und unfair. Grundsteuerberechnungen für ein Einfamilienhaus mit 150 m2 Wohnfläche im Vergleich zu einer gleich großen Wohnung mit gleich großem (anteiligem) Grundstück und gleichem Bodenrichtwert zeigen (Betriebsberater 31/2019):
- Bei hohem Bodenrichtwert ist die Grundsteuer für ein Neubau-Einfamilienhaus mehr als doppelt so hoch wie für eine Neubau-Wohnung.
- Bei niedrigem Bodenrichtwert ist die Grundsteuer für ein Altbau-Einfamilienhaus ein Viertel niedriger als für eine Altbau-Wohnung.
- Bei einem Neubau-Einfamilienhaus ist die Grundsteuer in den meisten Fällen deutlich höher als bei einem Altbau-Einfamilienhaus, nicht hingegen bei einem Neubau-Einfamilienhaus auf großem Grundstück mit hohem Bodenrichtwert.
- Bei einem Neubau-Einfamilienhaus auf großem Grundstück mit hohem Bodenrichtwert ist die Grundsteuer gut 2-mal so hoch wie auf kleinem Grundstück mit niedrigem Bodenrichtwert, hingegen bei einem Altbau-Einfamilienhaus knapp 5-mal so hoch.
- Bei einem Neubau-Einfamilienhaus gehen bei niedrigem Bodenrichtwert nur 14% des Bodenwerts in den Grundsteuerwert ein, bei hohem Bodenrichtwert 30%. Hingegen gehen bei einem Altbau-Einfamilienhaus bei niedrigem Bodenrichtwert 55% des Bodenwerts in den Grundsteuerwert ein, bei hohem Bodenrichtwert 70%.
- Ganz anders bei Wohnungen in nicht aufgeteilten Häusern: Bei einer Neubau-Wohnung gehen unabhängig vom Bodenrichtwert nur 3% des Bodenwerts in den Grundsteuerwert ein, bei einer Altbau-Wohnung 35%.
- Damit ist in diesem Beispiel trotz gleicher Grundstücksfläche und gleichem Bodenrichtwert (und unabhängig von der Wohnfläche) die bodenbezogene Grundsteuer für das Neubau-Einfamilienhaus rund zehnmal so groß wie für die Neubau-Wohnung, hingegen für das Altbau-Einfamilienhaus nur rund doppelt so groß wie für die Altbau-Wohnung.
2 Vom einfachen Flächenmodell zum fairen Einfachmodell
Die beschlossene Grundsteuerreform eröffnet jedem Bundesland die Möglichkeit, bis spätestens Ende 2024 ein eigenes Grundsteuermodell zu beschließen.
Tab. 1 zeigt drei Grundsteuermodelle:
- Das beschlossene BMF-Modell, das Grundstücksfläche, Bodenrichtwert, Gebäudefläche und Ertrag der Immobilie berücksichtigt. Wie gezeigt, führt das BMF-Modell zu unsystematischen und widersprüchlichen Grundsteuern.
- Faires Einfachmodell, das wie das BMF-Modell Grundstücksfläche, Bodenrichtwert und Gebäudefläche berücksichtigt, aber den Ertrag der Immobilie außer Acht lässt.
- Flächenmodell, das nur Grundstücksfläche und Gebäudefläche berücksichtigt.
Tab. 1: BMF-Modell (Gesetz), faires Einfachmodell und Flächenmodell
| (1) BMF-Modell (Gesetz) |
(2) Faires Einfachmodell |
(3) Flächen- modell |
|
| (1a) Grundstücksfläche | x | x | x |
| (1b) Bodenrichtwert | x | x | |
| (2a) Gebäudefläche | x | x | x |
| (2b) Ertrag | x |
2.1 Flächenmodell ist einfach
„Die Reform der Grundsteuer sollte die Einfachheit der Besteuerung in den Mittelpunkt stellen. Die einfachste Lösung wäre eine rein flächenbasierte Grundsteuer“, so Prof. FUEST in seiner Stellungnahme zur Grundsteuerreform von September 2019. Dies sieht das von Bayern vorgeschlagene Flächenmodell vor:
Grundsteuerwert = Grundstücksfläche * a + Gebäudefläche * b (1)
a und b sind vorzugebende Gewichtungsfaktoren. Im von Bayern vorgeschlagenen Flächenmodell wird die Grundstücksfläche mit 0,02 €/m2 gewichtet und die Gebäudefläche von Wohnimmobilien mit 0,20 €/m2, die Gebäudefläche von Gewerbeimmobilien doppelt so hoch mit 0,40 €/m2.
2.2 Flächenmodell ist aber nicht fair
Das Flächenmodell besteuert hochpreisige und geringwertige Lagen gleich hoch. Vor dem Hintergrund der angestrebten Aufkommensneutralität der Reform ist dies gleichheitsrechtlich besonders problematisch, schreibt Prof. HEY in ihrer Stellungnahme zur Grundsteuerreform. Die systematische Verschonung besonders leistungsfähiger Grundstückseigentümer geht unmittelbar zulasten der weniger leistungsfähigen Grundstückseigentümer, weil aufgrund der Unterbewertung der hochpreisigen Grundstücke die Hebesätze gar nicht oder weniger stark sinken werden, als sie es täten, wenn für alle Grundstücke statt der heutigen niedrigen Einheitswerte verkehrsnahe Grundsteuerwerte angesetzt würden. Die Eigentümer mit Grundstücken in geringwertigen Lagen zahlen folglich laut Prof. HEY die Verschonung der Eigentümer in hochpreisigen Lagen mit.
2.3 Vorschlag für ein faires Einfachmodell
Eine Grundsteuer nach diesem Flächenmodell wäre eine einfache Steuer, aber sie wäre nicht fair, weil hochpreisige und geringwertige Lagen gleich hoch besteuert würden. „Die Grundsteuer sollte so gestaltet werden, dass diejenigen, die aus kommunalen Leistungen größere Vorteile ziehen, zur Finanzierung der kommunalen Haushalte stärker herangezogen werden, wobei sich die kommunalen Leistungen in den Grundstückswerten ausdrücken“, so der Kompromissvorschlag des wissenschaftlichen Beirats beim BMF von September 2019. „Wertunterschiede zwischen Immobilien innerhalb von Städten (bei gegebener Gebäudefläche) resultieren vor allem aus Unterschieden in den Bodenpreisen. In der Bemessungsgrundlage der Grundsteuer könnten die nach Bodenrichtwerten gemessenen Grundstückswerte dann mit den Gebäudeflächen kombiniert und mit Gewichtungsfaktoren zusammengeführt werden“, so Prof. FUEST.
Entsprechend sollte das einfache Grundsteuermodell modifiziert werden, indem die Grundstücksfläche mit dem Bodenrichtwert gewichtet wird und die Gebäudefläche pauschal mit den durchschnittlichen Normalherstellungskosten. Dieses Grundsteuermodell hat der wissenschaftliche Beirat beim Bundesfinanzministerium im September 2019 vorgeschlagen. Dadurch würde aus dem einfachen Grundsteuermodell ein einfaches und zugleich faires Grundsteuermodell:
Grundsteuerwert = Grundstücksfläche * Bodenrichtwert + Gebäudefläche * A (2)
A ist ein vorzugebender Gewichtungsfaktor, der zur Vermeidung von Abgrenzungsproblemen möglichst einheitlich für Wohn- und Gewerbeimmobilien angesetzt werden sollte. Der wissenschaftliche Beirat beim BMF schlägt hierfür Pauschalwerte für Normalherstellungskosten vor. Das wären derzeit rund 1.500 €/m2.
Die jeweilige Grundsteuer ergibt sich dann wie bisher durch Multiplikation mit der Grundsteuer-Messzahl und dem örtlichen Grundsteuer-Hebesatz.
3 Vergleich der Grundsteuer beim BMF-Modell, beim Flächenmodell und beim fairen Einfachmodell
Für die drei Modelle wurde die Grundsteuer beispielhaft für Wiesbaden für vier Wohnimmobilienarten berechnet (siehe Betriebsberater, Heft 31/2019):
- Einfamilienhaus mit 150 m2 Wohnfläche,
- Wohnung mit 150 m2 Wohnfläche in einem nicht aufgeteilten Wohnhaus,
- Wohnung mit 50 m2 Wohnfläche in einem nicht aufgeteilten Wohnhaus,
- Eigentumswohnung mit 50 m2 Wohnfläche.
Für jede der vier Wohnimmobilienarten werden zwei unterschiedliche Grundstücksgrößen, zwei unterschiedliche Bodenrichtwerte sowie Neubau versus Altbau berücksichtigt, insgesamt also 8 Bewertungsfälle pro Immobilienart und damit insgesamt 32 Bewertungsfälle. Durch geeignete Normierung wird sichergestellt, dass die Summe des Grundsteueraufkommens aus den 32 Bewertungsfällen in allen Modellen gleich groß ist.
Tab. 2 zeigt beispielhaft für die drei Modelle die Grundsteuer für ein Einfamilienhaus mit 150 m2 Wohnfläche. Das Alter ist beim BMF-Modell für die Grundsteuer von Einfamilienhäusern von großer Bedeutung. Hingegen ist beim Flächenmodell und beim fairen Einfachmodell das Alter für die Grundsteuer irrelevant. Für die Grundsteuer von Einfamilienhäusern ist beim fairen Einfachmodell die Grundsteuer für kleine Grundstücke mit niedrigem Bodenrichtwert am niedrigsten und im Gegenzug für große Grundstücke mit hohem Bodenrichtwert am höchsten.
Tab. 2: Vergleich der Grundsteuer für ein Einfamilienhaus mit 150 m2 Wohnfläche
| Grundsteuer bei den drei Modellen für ein Einfamilienhaus mit 150 m2 Wohnfläche | |||||||||
| (1.1a) | (1.1b) | (1.2a) | (1.2b) | (2.1a) | (2.1b) | (2.2a) | (2.2b) | ||
| (1) | Varianten für Grundstücksgröße, Bodenrichtwert, Wohnfläche und Alter | ||||||||
| (1.1) | Grundstücksgröße [m2] | 200 | 200 | 200 | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| (1.2) | Bodenrichtwert [€/m2] | 300 | 300 | 1.500 | 1.500 | 300 | 300 | 1.500 | 1.500 |
| (1.3) | Alter [Jahre] | Neubau | ≥56 | Neubau | ≥56 | Neubau | ≥56 | Neubau | ≥56 |
| (2) | Grundsteuer | ||||||||
| (2.1) | BMF-Modell (Gesetz) | 693 | 369 | 1.094 | 759 | 733 | 528 | 1.530 | 1.762 |
| (2.2) | Flächenmodell | 635 | 635 | 635 | 635 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| (2.3) | Faires Einfachmodell | 388 | 388 | 714 | 714 | 714 | 714 | 2.347 | 2.347 |
Tab. 3 zeigt beispielhaft für die drei Modelle die Grundsteuer für eine Wohnung mit 150 m2 Wohnfläche. Für die Grundsteuer von großen Wohnungen ist beim fairen Einfachmodell die Grundsteuer für kleine Grundstücke unabhängig vom Bodenrichtwert und für große Grundstücke mit niedrigem Bodenrichtwert am niedrigsten, für große Grundstücke mit hohem Bodenrichtwert am höchsten.
Tab. 3: Grundsteuer für eine Wohnung mit 150 m2 Wohnfläche
| (1.1a) | (1.1b) | (1.2a) | (1.2b) | (2.1a) | (2.1b) | (2.2a) | (2.2b) | ||
| (1) | Varianten für Grundstücksgröße, Bodenrichtwert, Wohnfläche und Alter | ||||||||
| (1.1) | Grundstücksgröße [m2] | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| (1.2) | Bodenrichtwert [€/m2] | 300 | 300 | 1.500 | 1.500 | 300 | 300 | 1.500 | 1.500 |
| (1.3) | Alter [Jahre] | Neubau | ≥56 | Neubau | ≥56 | Neubau | ≥56 | Neubau | ≥56 |
| (2) | Grundsteuer | ||||||||
| (2.1) | BMF-Modell (Gesetz) | 474 | 465 | 477 | 499 | 476 | 490 | 488 | 625 |
| (2.2) | Flächenmodell | 579 | 579 | 579 | 579 | 635 | 635 | 635 | 635 |
| (2.3) | Faires Einfachmodell | 327 | 327 | 408 | 408 | 388 | 388 | 714 | 714 |
Tab. 4 zeigt beispielhaft für die drei Modelle die Grundsteuer für eine Wohnung mit 50 m2 Wohnfläche statt 150 m2 Wohnfläche wie in Tab. 3. Die Grundsteuer von kleinen Wohnungen ist beim fairen Einfachmodell bei niedrigen Grundstückswerten besonders niedrig, bei größeren Grundstücken und höheren Bodenrichtwerten ähnlich hoch wie beim BMF-Modell und beim Flächenmodell.
Tab. 4: Grundsteuer für eine Wohnung mit 50 m2 Wohnfläche
| (1.1a) | (1.1b) | (1.2a) | (1.2b) | (2.1a) | (2.1b) | (2.2a) | (2.2b) | ||
| (1) | Varianten für Grundstücksgröße, Bodenrichtwert, Wohnfläche und Alter | ||||||||
| (1.1) | Grundstücksgröße [m2] | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| (1.2) | Bodenrichtwert [€/m2] | 300 | 300 | 1.500 | 1.500 | 300 | 300 | 1.500 | 1.500 |
| (1.3) | Alter [Jahre] | Neubau | ≥56 | Neubau | ≥56 | Neubau | ≥56 | Neubau | ≥56 |
| (2) | Grundsteuer | ||||||||
| (2.1) | BMF-Modell (Gesetz) | 192 | 115 | 193 | 129 | 192 | 120 | 195 | 154 |
| (2.2) | Flächenmodell | 194 | 194 | 194 | 194 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| (2.3) | Faires Einfachmodell | 110 | 110 | 143 | 143 | 122 | 122 | 204 | 204 |
Fazit:
- Nur beim BMF-Modell ist das Alter der Gebäude von Bedeutung, nicht hingegen beim Flächenmodell und beim fairen Einfachmodell.
- Im Gegensatz zum BMF-Modell werden beim Flächenmodell und beim fairen Einfachmodell Einfamilienhäuser und Wohnungen mit gleicher Wohnfläche, Grundstücksgröße und Bodenrichtwert gleich besteuert.
4 Weitere Verbesserungsmöglichkeiten
4.1 Faires Einfachmodell auch für Grundsteuer A verwenden
Das im BMF-Modell für land- und forstwirtschaftliches Vermögen (Grundsteuer A) vorgesehene Grundsteuerbewertungsverfahren (§ 232 ff. BewG-E) ist unnötig kompliziert: Es umfasst 6 eng bedruckte Seiten mit 11 umfänglichen Paragrafen zzgl. 9 Anlagen, in denen z.B. auf drei eng bedruckten Seiten Bewertungsfaktoren für die forstwirtschaftliche Nutzung pauschal vorgegeben werden.
Statt dieses komplizierten und undurchschaubaren Systems könnte auch hier das faire Einfachmodell angewendet werden. Dabei sollte für die Grundsteuer A wie derzeit eine eigene Grundsteuermesszahl angesetzt werden.
4.2 Erhöhungen der Grundsteuerbelastung vorübergehend begrenzen
Durch die Reform der Grundsteuer könnte es in Einzelfällen zumindest prozentual zu massiven Erhöhungen der Grundsteuerbelastung kommen. Deshalb könnte in Erwägung gezogen werden, in den ersten Jahren die Änderung der Grundsteuerbelastung zu begrenzen, z. B. auf maximal 20% pro Jahr. Schlagartige Erhöhungen der Grundsteuerbelastung könnten dadurch vermieden werden. Der hierfür festzulegende maximale Änderungssatz könnte jeweils von den Bundesländern oder von den Gemeinden festgelegt werden.
4.3 Länderspezifische Messzahlen erleichtern die Hebesatzanpassungen
Durch die Grundsteuerreform soll das innerhalb einer Gemeinde erzielte Grundsteueraufkommen unverändert bleiben. Hierfür müssen die lokalen Hebesätze geeignet angepasst werden.
Bei einer bundeseinheitlichen Grundsteuermesszahl müssen in manchen Gemeinden die Hebesätze massiv gesenkt werden, in anderen massiv erhöht werden. Massive Änderungen der Hebesätze sind vor Ort nur sehr schwer umzusetzen. Zur Verringerung der erforderlichen Hebesatzänderungen sollte den Ländern die Setzung von länderspezifischen Grundsteuermesszahlen erlaubt werden.