Aktuelle Rechtsprechung zum Flüchtlingsrecht
Teil I
Aktuelle Rechtsprechung zum Flüchtlingsrecht
Teil I
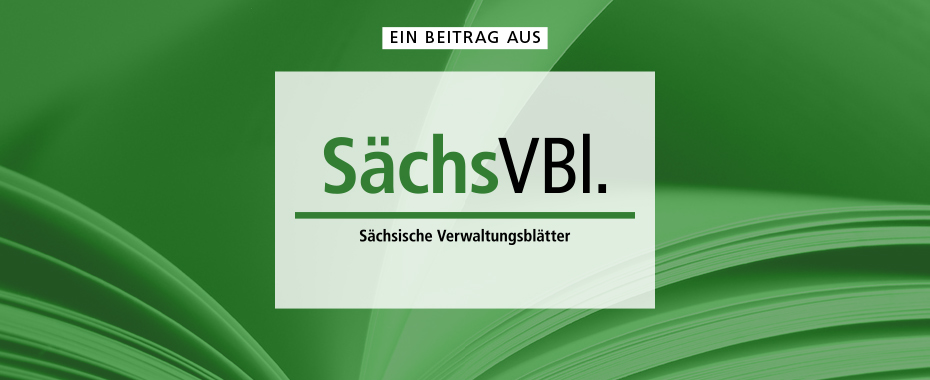
Der Beitrag stellt ausgewählte neuere Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) und der nationalen Gerichte zum Flüchtlingsrecht vor und unternimmt es, diese einzuordnen. Ausgeblendet bleiben die großen rechtspolitischen Fragen und die Umbrüche, die sich mit der Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems ergeben (sollen).
I.Einleitung
Wenige Wochen vor einer Landtagswahl, in der die nationalen Optionen in der Migrationspolitik voraussichtlich eine mitentscheidende Rolle spielen werden, und wenige Monate nach der Annahme des Migrations- und Asylpakets der EU auch durch den Rat der Europäischen Union ist die Versuchung groß, sich den großen Linien der Migrationspolitik und den Lösungsansätzen zuzuwenden, die das Migrations- und Asylpaket der EU1 bietet. Einer kritischen Reflexion wert und würdig wäre auch die Ende 2023 aufgenommene2 und Mitte 2024 in der Ministerpräsidentenkonferenz bekräftigte3 Suche nach einer Lösung der Asylprobleme in Deutschland durch deren Externalisierung nach dem – dort inzwischen wieder aufgegebenen – britischen „Ruandamodell.”
Der Versuchung, die großen rechtspolitischen Linien des Flüchtlingsrechts nachzuzeichnen und zu analysieren, wird der Vortrag zugunsten einer Fokussierung auf die vielfältigen Auslegungs- und Anwendungsprobleme widerstehen, die neben den oft vorrangigen Tatsachenfragen zu den einzelnen Herkunftsländern4 den asylrichterlichen Alltag prägen, zumal die Vorarbeiten zur nationalen Umsetzung der GEAS-Reform noch nicht öffentlich diskussionsreif vorliegen und auch die Auslagerung von Asylverfahren an Drittstaaten noch mehr Vision denn umsetzungsreif ist. Der nationale Gesetzgeber und der EuGH haben zudem auch in der jüngeren Vergangenheit ihre Beiträge zur Erhaltung der Problemvielfalt in den kleinteiligeren Fragen der Auslegung des geltenden Rechts geleistet. Der Vortrag konzentriert sich so auf den Versuch, die hieran anknüpfenden, im Vorfeld eingereichten Fragen im Kontext zu beantworten (II. bis VI.), und wird dies durch einige zusätzliche „Impressionen”5 zur flüchtlingsrechtlichen Rechtsprechung (vor allem) im Jahr 20246 (VII.) ergänzen.
Das Asylprozessrecht im engeren Sinne wird weitgehend ausgeblendet. Die Unwucht im verwaltungsprozessualen Rechtsmittelrecht – und damit auch die strukturelle Uneinheitlichkeit der asylgerichtlichen Rechtsprechung – wird durch die jüngst erfolgte Erweiterung des Beschwerdeausschlusses (§ 80 AsylG)7 vergrößert und weiter dadurch verstärkt werden, dass das BMJ-Eckpunktepapier zu einer VwGO-Novelle8 zwar eine Erweiterung des Rechtsmittelzulassungsgrundes der Divergenz vorsieht, die Rechtsmittelbeschränkungen des § 78 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und 3 AsylG aber unangetastet lässt.9
II.Folgeantrag
Einen Schwerpunkt bilden aus gutem Grund Fragen rund um den Folgeantrag. In den letzten Jahren lag der Anteil der Folgeanträge (bei gewissen Schwankungen) immerhin bei ca. 10 v.H.
1.Neuere Rechtsprechung des EuGH
Das Folgeantragsverfahren ist nicht zuletzt durch die Rechtsprechung des EuGH in Bewegung geraten.10 Dies hat mit der Verwerfung der Dreimonatsfrist des § 51 Abs. 3 Satz 1 VwVfG11 begonnen und mit der (neuerlichen) Entscheidung zum Prüfungsumfang nach zulässigem Folgeantrag12 sein bislang vorläufiges Ende gefunden. Mit der Novellierung des § 71 AsylG im Rahmen des Rückführungsverbesserungsgesetzes hat der nationale Gesetzgeber auf diese Rechtsprechung reagiert und es nicht nur sprachlich, sondern auch inhaltlich unternommen, die EuGH-Rechtsprechung in das nationale Recht umzusetzen. Auch wenn der Regierungsentwurf zum Rückführungsverbesserungsgesetz davon ausgeht, dass es keinen relevanten Unterschied zur bisherigen Anwendung des § 51 VwVfG gäbe,13 hat dies teils alte Fragen neu gestellt und neue Fragen aufgeworfen, insbesondere im Bereich der Abschiebungsandrohung/-ordnung und des hiergegen eröffneten Rechtsschutzes.
Schwerpunkt des EuGH-Urteils vom 09. September 202114 war die Frage, ob/unter welchen Voraussetzungen ein Folgeantrag (Art. 40 Abs. 2 RL 2013/32/EU) für die Geltendmachung neuer Umstände (Änderung der Sach- oder Rechtslage i. S. d. § 51 Abs. 1 VwVfG) innerhalb einer bestimmten Frist gestellt werden muss und ob „neue Elemente oder Erkenntnisse” auch solche umfassen, die bereits vor Abschluss des Erstverfahrens existierten, aber vom Antragsteller nicht geltend gemacht wurden. Bereits in einer vorangehenden Entscheidung15 hatte sich eine weite Auslegung des Begriffs der „neuen” Erkenntnisse angebahnt, in dem der EuGH ausdrücklich auch dem Grunde nach solche Dokumente zur Stützung eines Folgeantrages zugelassen hat, deren Echtheit nicht feststellbar oder deren Quelle nicht objektiv überprüfbar ist. Die Beweiswürdigung von Unterlagen sei im Erst- wie im Folgeantragsverfahren nach Maßgabe des Art. 4 RL 2011/95/EU vorzunehmen.
Nach Wortlaut, Kontext und Zielsetzung bezeichnet – so der EuGH – die Wendung „neue Elemente oder Erkenntnisse”, die „zutage getreten oder vom Antragsteller vorgebracht worden sind”, im Sinne dieser Bestimmung sowohl Elemente oder Erkenntnisse, die nach rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens über den früheren Antrag auf internationalen Schutz eingetreten sind, als auch Elemente oder Erkenntnisse, die bereits vor Abschluss des Verfahrens existierten, aber vom Antragsteller nicht geltend gemacht wurden. Die dogmatisch feinsinnigen Differenzierungen zu „echten” und „unechten” Nova war damit zwar nicht vollständig obsolet. Denn ob die „neue” Erkenntnis bei der Beurteilung der Zulässigkeit eines Folgeantrages zu berücksichtigen ist, richtet sich im nächsten Schritt der Prüfung danach, ob das nationale Recht eine Regelung zur Frage enthält, ob/in welchem Umfange „unechte Nova” bei der Zulässigkeitsprüfung unbeachtet bleiben können, weil der Antragsteller sie nicht ohne eigenes Verschulden im Erstverfahren vorgetragen hatte.
Wegen des bloßen Verweises des § 71 AsylG (a. F.) auf § 51 VwVfG auch für das bundesrepublikanische Recht von Bedeutung war, dass Art. 40 Abs. 4 RL 2013/32/EU es nicht gestattet, in Anwendung der allgemeinen Vorschriften über das nationale Verwaltungsverfahren die Prüfung eines Folgeantrages in der Sache allein deswegen abzulehnen, weil die „neuen Elemente oder Erkenntnisse” bereits zur Zeit des Verfahrens über den früheren Antrag existierten und in diesem Verfahren durch Verschulden des Antragstellers nicht vorgebracht wurden. Zu Recht hat die nationale Rechtsprechung16 hieraus den Schluss gezogen, dass Unionsrecht zumindest der Dreimonatsfrist des § 51 Abs. 3 Satz 1 VwVfG entgegensteht. Damit war jedenfalls auch die nationale Rechtsprechung überholt, dass für jeden geltend gemachten Wiederaufnahmegrund eine gesonderte Dreimonatsfrist zu prüfen sei. In Bezug auf die schuldhafte Nichtgeltendmachung im früheren Asylverfahren ging die wohl überwiegende Auffassung der Sache nach dahin, dass es sich bei dem Verweis auf § 51 VwVfG um keine Rechtsgrund-, sondern eine Rechtsfolgenverweisung handelte und insoweit die unionsrechtlich geforderte Sondernorm zur Umsetzung des Art. 40 Abs. 4 RL 2013/32/EU in § 71 Abs. 1 Satz 1 AsylG (a. F.) vorlag.17
Eine Änderung der dem Erstverfahren zugrunde liegenden „Sach- oder Rechtslage” zugunsten des Betroffenen klingt ähnlich, ist aber nicht identisch mit den unionsrechtlich geforderten „neuen Elementen oder Erkenntnissen”, die „zutage getreten oder vom Antragsteller vorgebracht worden sind”. Bei beiden kann der Gesichtspunkt hinzutreten, dass die „Neuerungen” eine vom Ergebnis des Erstverfahrens abweichende, dem Antragsteller günstige Bewertung des Schutzgesuches als zumindest möglich erscheinen lassen müssen. Dies ist als (mögliche) Zulässigkeitsvoraussetzung für den Antrag unbestritten und war über den Verweis in § 51 Abs. 1 VwVfG als Tatbestandsvoraussetzung normiert. Nach Unionsrecht müssen die neuen Elemente oder Erkenntnisse dabei „erheblich zu der Wahrscheinlichkeit beitragen”, dass es zur Schutzgewähr kommt. Die Mitgliedstaaten dürfen diesen Maßstab nicht verschärfen, wohl aber weitere Gründe für die Sachprüfung eines Folgeantrages vorsehen. Die moderate sprachliche Änderung der Voraussetzungen in § 71 Abs. 1 Satz 1 AsylG ist nicht als sachliche Divergenz zum Unionsrecht zu werten.
2.EuGH-Rechtsprechung als „Änderung der Rechtslage”?
Umstritten war zunächst, ob die im nationalen Rechtsraum zu § 51 Abs. 1 VwVfG entwickelte Judikatur auf das Asylrecht übertragbar war, dass Änderungen der Rechtsprechung keine Änderungen i. S. d. § 51 Abs. 1 Nr. 1 VwVfG bildeten. Diskutiert wurde dies vor allem mit Blick auf die EuGH-Entscheidung zu Wehrdienstentziehern aus Syrien, für die der Gerichtshof eine „starke Vermutung formuliert hatte”, dass eine hieran anknüpfende Verfolgungshandlung auch auf einen Verfolgungsgrund zurückzuführen, also statt lediglich subsidiärem Schutz Flüchtlingsschutz zu gewähren sei.18 Eine „starke Vermutung” sprach zumindest dafür, dass der EuGH im Interesse einer effektiven Umsetzung des Unionsrechts und dessen Ort qualitativer Auslegung durch ihn selbst auch zumindest Rechtsprechungsänderungen als Wiederaufnahmegrund qualifizieren werde.19
In der gebotenen Klarheit hat der EuGH dies auf Vorlage des VG Sigmaringen in seinem Urteil vom 08.02.202420 ausgesprochen. Die Voraussetzungen für die Beurteilung der Zulässigkeit eines Folgeantrages seien wegen der abschließenden Aufzählung von Unzulässigkeitsgründen in Art. 33 Abs. 2 RL 2013/32/EU weit auszulegen und umfassten neben Änderungen der Sachlage hinsichtlich der persönlichen Situation eines Antragstellers oder der seines Herkunftslandes auch neue rechtliche Umstände. Im besonderen Kontext der RL 2013/32/EU kann – so der EuGH – danach ein Urteil des EuGH unter den Begriff „neuer Umstand” bzw. „neues Element” i. S. v. Art. 33 Abs. 2 lit. d, Art. 40 Abs. 2 und 3 RL 2013/32/EU fallen. Dies sollte unabhängig davon gelten, ob
- – das Urteil vor oder nach dem Erlass der Entscheidung über den Erstantrag ergangen ist,
- – in dem Urteil die Unvereinbarkeit einer nationalen Bestimmung, auf die die Erstentscheidung gestützt war, mit dem Unionsrecht festgestellt wird oder ob
- – das Urteil sich auf die Auslegung des Unionsrechts einschließlich des Rechts, das bereits bei Erlass dieser Entscheidung in Kraft war, beschränkt.
In diesem Urteil überlässt es der EuGH ausdrücklich den Mitgliedstaaten, ob bei einer fehlerhaften behördlichen Unzulässigkeitsentscheidung diese lediglich aufgehoben („für nichtig”) erklärt und die Sache zur Prüfung und Sachentscheidung an die nationale Asylbehörde zurückverwiesen wird oder ob die Gerichte ermächtigt werden, selbst über diesen Antrag zu entscheiden.21 Die hierauf bezogenen Erwägungen gehen aber nicht darauf ein, inwieweit für das Folgeantragsverfahren etwaige Anhörungs-/besondere behördliche Verfahrenspflichten gelten, die im gerichtlichen Verfahren nicht (oder nicht vollständig) abgebildet werden können. Hier besteht u. a. ein Spannungsverhältnis zu der Rechtsprechung, nach der bestimmte behördliche Verfahrenshandlungen im gerichtlichen Verfahren nicht oder nur eingeschränkt nachgeholt werden können.22
Unklar bleibt auch die Reichweite des – zunächst einmal auf das neuerliche Verfahren bezogenen – „Beschleunigungsgebots”, nach dem die Mitgliedstaaten ihr nationales Recht so zu gestalten haben, dass „im Anschluss an eine Nichtigerklärung dieser früheren Entscheidung und im Falle der Rücksendung der Akten an die Asylbehörde innerhalb kurzer Zeit eine neue Entscheidung erlassen wird, die mit der im Nichtigkeitsurteil erhaltenen Beurteilung im Einklang steht”. Angesichts der Herleitung nicht allein aus dem Sekundärrecht (Art. 46 Abs. 3 RL 2013/32/EU), sondern auch aus dem Primärrecht (Art. 47 GRC) ist eine Erstreckung des besonderen Beschleunigungsgebotes auch auf das einer neuerlichen negativen Entscheidung folgende gerichtliche Verfahren zumindest zu erwägen.
3.Prüfungsumfang beim Folgeantrag
Zum Prüfungsumfang bei einem Folgeantrag hat der EuGH dann in seinem Urteil zum Wegfall des UNRWA-Schutzes23 nochmals klargestellt, dass Art. 40 Abs. 3 RL 2023/32/EU im Hinblick auf die Natur der Elemente oder Erkenntnisse, die für die Beurteilung eines Anspruches auf internationalen Schutz heranzuziehen sind, nicht zwischen einem ersten Antrag auf internationalen Schutz und einem Folgeantrag unterscheidet.
Dies bestätigt die „Zweistufigkeit” des Folgeantragsverfahrens, die das Bundesverwaltungsgericht 2016 i. V. m. der Zusammenführung der Unzulässigkeitsgründe in § 29 AsylG und der wachsenden Bedeutung von Verfahren für die materielle Entscheidungsfindung dazu geführt hatten, die frühere Rechtsprechung zum gerichtlichen „Durchentscheiden” bei rechtswidriger behördlicher Unzulässigkeitsentscheidung aufzugeben.24 Nur im Stadium der Prüfung der Zulässigkeit des Folgeantrages ist die Prüfung darauf beschränkt, ob im Rahmen der bestandskräftigen Erstentscheidung nicht geprüfte Elemente oder Erkenntnisse zur Stützung des neuerlichen Schutzbegehrens vorliegen und ob diese neuen Elemente/Erkenntnisse allein erheblich zu der Wahrscheinlichkeit beitragen, dass dem Antragsteller internationaler Schutz zuerkannt wird.25 Ist die Zulässigkeitshürde erst einmal übersprungen, ist eine umfassende Prüfung des Schutzgesuches unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles zum individuellen Verfolgungsschicksal und zur Lage im Herkunftsstaat geboten.
In diese Prüfung sind auch solche Tatsachen (Elemente/Erkenntnisse) einzubeziehen, die bereits in einem früheren Verfahren geprüft und gewürdigt worden sind, zumal die bisherigen Entscheidungsgrundlagen im Lichte neuer Elemente oder Erkenntnisse zu einer anderen Entscheidung führen können. Insoweit gibt es keine Prüfungsbeschränkung oder (materielle) Präklusion.
4.Änderung des § 71 AsylG durch RückführVerbessG
Die Änderung des § 71 Abs. 1 AsylG durch das Rückführungsverbesserungsgesetz greift die neue Rechtsprechung des EuGH zum Folgeantrag inhaltlich und teils im Wortlaut auf und überführt sie – wegen des Gebotes der unionsrechtskonformen Auslegung und des Anwendungsvorranges des Unionrechts insoweit deklaratorisch – in nationales Recht. Dies ändert nichts daran, dass diese Begrifflichkeiten dem Unionsrecht entlehnt sind und ihrer Umsetzung dienen, mithin auch im unionsrechtlichen Sinne auszulegen sind.
a)Partieller Rückgriff auf § 51 VwVfG?
Dies hindert nicht grundsätzlich einen Rückgriff auf die Grundsätze der früheren Rechtsprechung zu § 51 VwVfG. Ob bei verfassungs- und unionsrechtskonformer Auslegung des Verschuldens die Maßstäbe im Verhältnis zu dem von § 51 Abs. 2 VwVfG geforderten „groben Verschulden” abgesenkt worden sind, lässt sich abstrakt-generell schwer beurteilen. Das Unionsrecht kennt keine die einzelnen sekundärrechtlichen Regelungen übergreifende „Verschuldensdogmatik”. Aus der nationalen, verfassungsrechtlichen Perspektive war die Beschränkung auf Vorsatz und lediglich grobes Verschulden im Rahmen einer rechtsstaatlichen unverhältnismäßigen Handhabung gefordert.26
Weil Art. 40 Abs. 4 RL 2013/32/EU eine Präklusion verschuldet nicht eingeführter Elemente/Erkenntnisse den Mitgliedstaaten lediglich eröffnet, aber nicht von ihnen fordert, sind bei der Anwendung und Auslegung des (auf den ersten Blick: abgesenkten) Verschuldensmaßstabes die bisherigen verfassungsrechtlichen Begrenzungen des § 71 Abs. 1 AsylG weiter anzuwenden. Es ist daher ein qualifizierter Verschuldensvorwurf Voraussetzung, bei dem eine mehr als erhebliche Verpflichtung der Obliegenheit erforderlich ist, an der Feststellung der Asylgründe mitzuwirken und „so schnell wie möglich alle zur Begründung des Antrags auf internationalen Schutz erforderlichen Anhaltspunkte darzulegen” (Art. 4 Abs. 1 Satz 1 RL 2011/95/EU). Umstände, die nach einer aktuellen Rechtslage nicht relevant sein können, brauchen dabei nicht vorgetragen zu werden.27 Auch in Bezug auf Erkenntnisse zur allgemeinen Verfolgungslage im Herkunftsstaat, die sorgsam aufzuklären vorrangig Aufgabe des Bundesamtes ist, ist regelmäßig kein umfassender Vortrag abzuverlangen.28 Anderes gilt für Informationen in Bezug auf das persönliche Verfolgungsschicksal.
b)Rechtsschutz bei aufenthaltsbeendenden Maßnahmen in den Fällen des § 71 Abs. 5 Satz 3 AsylG
Auf den ersten Blick neuen Auftrieb gibt § 71 Abs. 5 Satz 3 AsylG dem alten Streit um die Frage, in welcher Form Rechtsschutz gegen eine Entscheidung des Bundesamtes eröffnet ist, durch die der Folgeantrag als unzulässig verworfen wird, ohne dass eine erneute Fristsetzung und Abschiebungsandrohung/-anordnung ergeht. Dies gilt namentlich in den Fällen, in denen sich das Bundesamt auf die bloße Mitteilung an die Ausländerbehörde beschränken kann, dass die Voraussetzungen des § 71 Abs. 1 Satz 1 AsylG nicht vorliegen.
Nach dem neuen Satz 3 darf eine Abschiebung im Übrigen (also außer zweitem Folgeantrag; Verzögerungsfolgeantrag) erst nach Ablauf der Frist des § 74 Absatz 1 Halbs. 2 AsylG und im Fall eines innerhalb der Frist gestellten Antrags nach § 80 Abs. 5 VwGO erst nach der gerichtlichen Ablehnung dieses Antrages vollzogen werden. Die einleitenden Worte „im Übrigen” lassen die Deutung zu, dass in Verfahren, in denen tatsächlich eine neuerliche Abschiebungsandrohung/-anordnung bei Ablehnung der Eröffnung eines weiteren Verfahrens ergangen ist, ein Fall des § 71 Abs. 5 Satz 1 oder 2 AsylG gerade nicht vorliegt. Der entstehungsgeschichtliche Hinweis, dass der neue Absatz 5 Satz 2 der Umsetzung des Art. 41 Abs. 1 RL 2013/32/EU (Ausnahmen vom Recht auf Verbleib bei Folgeanträgen), der neue Satz 3 der Umsetzung von Art. 46 Abs. 8 RL 2013/32/EU (Aufenthaltssicherung während des Verfahrens gegen eine den Folgeantrag als unzulässig ablehnenden Entscheidung) diene,29 verhält sich jedenfalls nicht ausdrücklich zu der Frage einer neuerlichen Abschiebungsandrohung/-anordnung.
Die Frage des zutreffenden Rechtsschutzes in Bezug auf eine Unzulässigkeitsentscheidung ohne neuerliche Abschiebungsandrohung/-anordnung mit dem Ziel, Rechtsschutz gegenüber einer drohenden Abschiebung zu erlangen, hatte bereits das VG Leipzig30 aufgeworfen. In Kenntnis des Streites um die richtige Rechtsschutzform, den zu entscheiden das Bundesverfassungsgericht31 selbst in Fällen des Verbotes der Mitteilung eines Termins der Abschiebung (§ 59 Abs. 1 Satz 8 AufenthG) keinen Anlass gesehen hatte, solange nur im Ergebnis effektiver Rechtsschutz gewährt wird, hat es den Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO mit Blick auf die Rechtsfolgen der quasi rechtsgestaltenden Wirkung der Ablehnung eines Folgeantrages als unzulässig als vorrangig gesehen. Das VG Karlsruhe32 hat demgegenüber an der aus seiner Sicht wohl überwiegenden Auffassung von Rechtsprechung und Literatur33 festgehalten, dass mangels gesetzlicher Rechtspflicht des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, die Ausländerbehörde von dem Ausgang eines Verfahrens nach § 80 Abs. 5 VwGO zu unterrichten, effektiver Rechtsschutz nur dadurch garantiert sei, dass dem Bundesamt im Wege der einstweiligen Anordnung nach § 123 Abs. 1 VwGO aufgegeben wird, der für die Abschiebung zuständigen Ausländerbehörde mitzuteilen, dass die Abschiebung nicht vor dem rechtskräftigen Abschluss des Folgeverfahrens erfolgen darf. Konsens besteht (wohl) darin, dass eine Mitteilung nach § 71 Abs. 5 Satz 2 AsylG für sich allein kein Verwaltungsakt ist, sondern dem Informationsaustausch zwischen zwei Trägern öffentlicher Gewalt dient.34
Für beide Auffassungen sprechen systematisch jeweils gewichtige Gründe. Allerdings sind Rechtsfolgen nicht notwendig mit Rechtswirkungen gleichzusetzen. Es erscheint auf den ersten Blick auch befremdlich, den verwaltungsaktgebundenen vorläufigen Rechtsschutz nach § 80 Abs. 5 VwGO auch dann heranzuziehen, wenn ein (neuerlicher) Verwaltungsakt nur zur Zulässigkeit des Antrages, nicht zur Rückführung ergangen ist und auf die weitere Vollziehbarkeit einer vor längerem ergangenen Abschiebungsandrohung/-anordnung abgestellt wird. Dass das Bundesamt die Ausländerbehörde nicht kraft ausdrücklicher gesetzlicher Anordnung von einem erfolgreichen Eilverfahren zu unterrichten hat, steht verfahrensrechtlichen Nebenpflichten aus dem Verwaltungsrechtsverhältnis nicht entgegen.35 Aber: „§ 80 Abs. 5 VwGO” lautetet es nun einmal im Gesetz.
Andererseits bedeutet der Umstand der Verortung der Entscheidung über die Unzulässigkeit eines Asylantrages in § 29 Abs. 1 Nr. 5 AsylG und dem Übergang zur Anfechtungsklage als der (allein) zulässigen Klage36 noch nicht, dass die Rechtsschutzform für die (vorläufige) Beseitigung der Rechtsfolgen einer negativen Antragsbescheidung bereits vorgeprägt wäre. Auch „hinkt” der vordergründig überzeugende Vergleich mit der Ablehnung eines Antrages auf Erteilung/Verlängerung eines Aufenthaltstitels, weil dort die Rechtsfolgen (Wegfall der Fiktionswirkung des Titelfortbestandes) direkter mit der eigentlichen Sachentscheidung gekoppelt sind. Im Ergebnis kann der Streit offenbleiben, solange nur – effektiv – Rechtsschutz gewährt wird.
c)Fortwirken der Abschiebungsandrohung bei zwischenzeitlicher Ausreise (§ 71 Abs. 6 AsylG)?
Durch die Novellierung des § 71 AsylG unberührt geblieben ist die lediglich redaktionell marginal geänderte Regelung des § 71 Abs. 6 AsylG, dass es auch bei einer zwischenzeitlichen Ausreise aus dem Bundesgebiet bei unzulässigem Folgeantrag keiner neuerlichen Abschiebungsandrohung/-anordnung bedarf und in Fällen einer unerlaubten Einreise aus einem sicheren Drittstaat (§ 26 a AsylG) eine Zurückschiebung des Ausländers in diesen Drittstaat möglich ist, ohne dass es der vorherigen Mitteilung des Bundesamtes bedarf.
Die Fortwirkung einer Ausreiseaufforderung und Abschiebungsandrohung, welcher der Ausländer in den Fällen des § 71 Abs. 6 Satz 2 AsylG durch Verlassen auch des Unionsgebietes nachgekommen ist (ansonsten ist keine Einreise aus einem sicheren Drittstaat denkbar), ist unionsrechtlich so nicht ausdrücklich vorgesehen. Sie bewirkt in Fällen, in denen ein Folgeantrag gestellt worden ist, eine Zurückverweisungsbefugnis allein durch die Ausländerbehörde, die zur Prüfung eines gestellten Folgeantrages aber weder aufgerufen noch berufen ist.
Kernproblem ist aber, ob sich mit der Ausreise/Abschiebung in den Herkunftsstaat in Reaktion auf die bei der Ablehnung des Erstschutzersuchens ergangene Abschiebungsandrohung/-anordnung diese durch „Verbrauch” erledigt hat oder fortbesteht.37 Auch dies ist zwischen dem VG Leipzig38 und dem VG Karlsruhe39 umstritten. Letztlich wird die Frage der Unionsrechtskonformität der EuGH entscheiden müssen; mir sympathischer ist der Verweis des VG Karlsuhe auf die nationale Verfahrensautonomie.
III.Abschiebungsanordnung/-drohung durch das Bundesamt
1.Ergänzung des § 34 Abs. 1 Satz 1 AsylG
Mit der Ergänzung des § 34 Abs. 1 Satz 1 AsylG um die Prüfung, ob der Abschiebung das Kindeswohl oder familiäre Bindungen40 oder der Gesundheitszustand des Ausländers entgegenstehen (Nr. 4), hat die vom EuGH induzierte Erosion der Aufteilung der Prüfungspflichten bei den Abschiebungshindernissen zwischen den vom Bundesamt zu prüfenden auslandsbezogenen und den von der Ausländerbehörde zu prüfenden inlandsbezogenen Abschiebungshindernissen sichtbare Spuren im Asylgesetz selbst hinterlassen. Zum Verständnis der Reichweite dieser Ergänzung ist ein kurzer Rückblick in die Rechtsprechungsentwicklung angezeigt.
Im nationalen Rechtsraum war wegen der Arbeitsteilung zwischen der Beurteilung des herkunftslandbezogenen Schutzes durch das Bundesamt und den u. a. für den Vollzug von Abschiebungen zuständigen Ausländerbehörden bei der Prüfungszuständigkeit eine Trennung von zielstaatsbezogenen und inlandsbezogenen Abschiebungshindernissen anerkannt, wobei Letztere auch bei deren Bestandskraft im Rahmen der Durchsetzung einer vom Bundesamt erlassenen Abschiebungsandrohung/-anordnung zu prüfen waren („vollstreckungsrechtliche Lösung”). Ungeachtet gewisser Unschärfen41 hatte sich diese „Arbeitsteilung” bewährt, ohne dass im Ergebnis eine Verletzung schutzwürdiger familiärer oder gesundheitlicher Belange Schutzsuchender bekannt geworden wäre.
Auf Vorlage des Bundesverwaltungsgerichts,42 die in Reaktion auf neuere Rechtsprechung des EuGH43 zum Schutz des Kindeswohles und der familiären Bindungen im Migrationsrecht erfolgt ist, hat der EuGH im Februar 202344 im Falle eines minderjährigen Drittstaatsangehörigen die „Vollstreckungslösung” verworfen. Bei der Abschiebungsandrohung/-anordnung als Rückkehrentscheidung i. S. d. RL 2008/115/EG ist das Wohl des Kindes und seiner familiären Bindungen bereits bei der Rückkehrentscheidung selbst zu schützen; es genügt nicht, wenn der Schutz im Rahmen eines nachfolgenden Verfahrens zum Vollzug dieser Rückkehrentscheidung organisiert wird. Art. 5 RL 2008/115/EG darf – so der EuGH – nicht eng ausgelegt werden und gebietet i. V. m. Art. 24 Abs. 2 GRC, das Wohl des Kindes in allen Stadien des Verfahrens zu berücksichtigen. In der Sache bedeutete dies, dass § 59 Abs. 1 Satz 3 AufenthG und § 34 Abs. 1 Satz 1 AsylG mit Unionsrecht unvereinbar und unionsrechtskonform auszulegen waren. Bei Vorliegen schutzwürdiger Belange ist eine gleichwohl ergehende Abschiebungsandrohung/-anordnung rechtswidrig; sie darf vom Bundesamt nicht erlassen werden.
2.Aufenthaltsrechtliche Folgen bei Vorliegen von Gründen des Kindeswohls
In der EuGH-Entscheidung nicht angesprochen waren die aufenthaltsrechtlichen Rechtsfolgen, insbesondere die Frage, ob bei Vorliegen (schutzwürdiger) Kindeswohlinteressen über den Verzicht auf eine Rückkehrentscheidung hinaus auch ein Aufenthaltstitel zu erteilen sei. Dahinter steht die Frage, ob/in welchem Umfang bei an sich nach nationalem materiellem Recht ausreisepflichtigen Personen von einer Rückkehrentscheidung abgesehen werden darf, ohne den weiteren Aufenthalt durch einen Aufenthaltstitel zu legalisieren.
Hier stehen sich widersprüchliche Entscheidungen des EuGH gegenüber. Das EuGH-Urteil vom 14.01.202145 mag dahin verstanden werden, dass Unionsrecht einen längeren „Schwebezustand” zwischen Erlass einer dann auch zu vollstreckenden Rückkehrentscheidung und Legalisierung des Aufenthalts bei materiell nicht bleibeberechtigten Personen nicht duldet. In seinem Urteil vom 15.02.202246 hat der EuGH indes klar ausgeführt, „dass keine Bestimmung der Richtlinie 2008/115 dahin ausgelegt werden kann, dass sie verlangte, dass ein Mitgliedstaat einem illegal in seinem Hoheitsgebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen einen Aufenthaltstitel gewährt, wenn gegen diesen Drittstaatsangehörigen weder eine Rückkehrentscheidung noch eine aufenthaltsbeendende Maßnahme ergehen kann, weil ernsthafte und durch Tatsachen bestätigte Gründe für die Annahme vorliegen, dass der Betroffene im Zielland der tatsächlichen Gefahr einer raschen, erheblichen und unumkehrbaren Zunahme der durch seine Krankheit verursachten Schmerzen ausgesetzt wäre”.
Der daraus entstandene instanzgerichtliche Streit, ob das Bundesamt in diesen Fällen in unionsrechtskonformer Auslegung ein inlandsbezogenes Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 5 AufenthG festzustellen hat47 oder lediglich – bei unzureichender Berücksichtigung der familiären Belange – die Abschiebungsandrohung/-anordnung aufzuheben ist,48 ist durch die Ergänzung des § 34 Abs. 1 AsylG entschärft, aber nicht aufgehoben. Die besseren Gründe sprechen dafür, in diesen Fällen kein generelles unionsrechtliches Gebot anzunehmen, einen Aufenthaltstitel nach § 25 Abs. 5 Satz 1 AufenthG zu erteilen oder ein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 5 AufenthG i. V. m. Art. 8 EMRK festzustellen.49
Die zu Art. 5 RL 2008/115/EG gefundene Auslegung des EuGH bindet nach vorzugswürdiger, durch § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 AsylG vom Gesetzgeber bekräftigter Ansicht50 unmittelbar das Bundesamt und die zur Prüfung verpflichteten Verwaltungsgerichte, sodass im Asylrechtsstreit ggf. von Amts wegen Hinweisen auf „inlandsbezogene Abschiebungshindernisse” nachzugehen ist; die Mindermeinung,51 dass nur das Bundesamt zur Einzelfallprüfung verpflichtet sei, die das Verwaltungsgericht nicht selbst ersetzen dürfe, hätte allerdings einer faktischen Aufgabenverlagerung vom Bundesamt auf das Gericht bei unterlassener Prüfung entgegengewirkt.
3.Insbesondere: Altfälle vor dem 15.02.2023 ergangener Rückkehrentscheidungen
Für Altfälle vor dem 15.02.202352 ergangener Rückkehrentscheidungen spiegelt sich dies in der Frage, ob auch insoweit (gegebenenfalls im Folgeantragsverfahren) Rechtsschutz gegenüber dem Bundesamt eröffnet ist53 oder jedenfalls insoweit ein Duldungsanspruch (gerichtet gegen die Ausländerbehörde) ausreicht.54 Für das Rückkehrverbesserungsgesetz geht die Gesetzesbegründung55 davon aus, dass nach einer ersten Entscheidung des Bundesamtes (die möglicherweise auch in einer unterlassenen Berücksichtigung von Abschiebungshinderungsgründen bestehen kann), für die weiteren aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen nach wie vor die Ausländerbehörden zuständig sind, also auch für die Prüfung, ob die Voraussetzungen für den Erlass einer Abschiebungsandrohung nach Abschluss des Asylverfahrens vorliegen oder entfallen sind. Systematisch konsequenter scheint mir bei einem ausreisepflichtigen Drittstaatler, zu dessen Lasten bereits eine bestandskräftige Abschiebungsandrohung des Bundesamtes auf der Grundlage des § 34 AsylG ergangen ist, die Möglichkeit eines auf Aufhebung der ergangenen Abschiebungsandrohung gerichteten Rechtsschutzes gegen das Bundesamt zu eröffnen.
Sind nur die Aspekte des Art. 5 RL 2008/115/EU betroffen, ist das Folgen-/Zweitantragsverfahren beim Bundesamt jedenfalls dann nicht zwingend das Mittel der Wahl, wenn diese – nach vorzugswürdiger Ansicht – nicht § 60 Abs. 5, 7 AufenthG bzw. Art. 15 RL 2011/95/EU zugeordnet werden. § 71 Abs. 4 AsylG regelt allein das Prüfprogramm nach unzulässigem Folgeantrag, keine exklusive Prüfungskompetenz des Bundesamtes. § 42 AsylG bewirkt insoweit ebenfalls keine Bindungs- oder Sperrwirkung.56 Bei Änderung der Sach- oder Rechtslage in Bezug auf „inlandsbezogene” Abschiebungshindernisse, die für sich allein keinen Folgeantrag rechtfertigten, kommt allerdings ein Wiederaufnahmeantrag nach § 51 Abs. 1 bis 5 VwVfG in Betracht.
4.Insbesondere: Reichweite der Prüfpflichten des Bundesamtes
Die Reichweite der Prüfpflichten des Bundesamtes hat sich sukzessive entwickelt: vom Ausgangspunkt des Kindeswohles, das auch die Auswirkungen der Abschiebung eines Elternteils auf das Kindeswohl umfasst,57 über die familiären Bindungen auch zwischen Erwachsenen,58 insbesondere Ehepaaren,59 innerhalb der Kernfamilie60 bis hin zum Gesundheitszustand des Drittstaatsangehörigen, und zwar während des Abschiebungsvorgangs61 und auch nach dessen Beendigung.62
Im Bereich der familiären Beziehungen muss dabei die erhebliche Beeinträchtigung einer „gelebten” familiären Lebensgemeinschaft mit im Bundesgebiet bleibeberechtigten Personen im Raum stehen.63 Dies schließt für einen zumutbaren Zeitraum eine Unterbrechung familiärer Beziehungen, etwa für die Dauer eines Visumsverfahrens,64 nicht aus. Bei besonders „trennungsempfindlichen” Kleinkindern bedarf es dann aber einer konkreten Prognose der voraussichtlichen Trennungsdauer und der Zumutbarkeit.65
5.Insbesondere: Anwendung bei noch offenen Asylverfahren anderer Familienmitglieder
Der asylrechtliche Schutzanspruch ist – auch im Rahmen des Familienasyls – ein individueller Schutzanspruch. Auch die Schutzwürdigkeit gelebter familiärer Beziehungen außerhalb des Herkunftsstaates ist grundsätzlich nicht für den Schutzstatus selbst, sondern erst bei der Rückkehrentscheidung maßgeblich. Die Entscheidungspraxis des Bundesamtes, in solchen Fällen über die Asylanträge der verschiedenen Mitglieder der Kernfamilie zumindest mitunter nicht zeitgleich zu entscheiden, führt zur Frage, ob eine Abschiebungsandrohung/-anordnung auch dann nicht möglich ist, wenn der weitere Verbleib naher Familienangehöriger im Bundesgebiet noch unklar ist, also ein „Auseinanderreißen” der Kernfamilie möglich, zumindest nicht ausgeschlossen ist, oder hiervon nur abzusehen ist, wenn ein Mitglied der Kernfamilie zumindest ein asylverfahrenunabhängiges Bleiberecht66 hat (so wohl das Bundesamt).67
Der effektive Schutz des Kindeswohls legt eine Auslegung nahe, bei der – vor allem im Rahmen des vorläufigen Rechtsschutzes – nicht auf ein bereits festgestelltes, sondern auf ein mögliches, zumindest nicht ausgeschlossenes Abschiebungshindernis abgestellt wird.68 So sieht es auch das VG Leipzig.69 Bestehen relevante Aspekte des Familienlebens, die zur Wahrung der Unionsgrundrechte und des Kindeswohls geeignet sind, gegen eine drohende abschiebungsbedingte Trennung durch Vollzug einer Rückkehrentscheidung zu streiten, sind sie vor Erlass der Rückkehrentscheidung aufzuklären und zu berücksichtigen. Bei anhängigen Schutzanträgen der Mitglieder der Kernfamilie ist dies grundsätzlich – zumindest bis zur Erstentscheidung – wegen des asylverfahrensabhängigen Bleiberechts, das einen rechtmäßigen Aufenthalt vermittelt, der Fall; zu erwägen sein mag allenfalls eine Ausnahme in Fällen (nach Inzidentprüfung) offenkundig erfolgloser, aber noch offener Asylanträge. Es ist Sache des Bundesamtes, die Entscheidung in den Verfahren der Familienmitglieder so aufeinander abzustimmen, dass bei allen vom schutzwürdigen Familienverband umfassten Personen kein Bleiberecht entstehen kann, und so lange von einer – vollzugsfähigen oder der Bestandskraft zugänglichen – Rückkehrentscheidung abzusehen.
Wird dagegen ein bestehendes, asylverfahrensabhängiges Bleiberecht gefordert, wird der nach Art. 5 Halbs. 1 Buchst. b RL 2008/115/EG gebotene Schutz nicht durch das Bundesamt selbst, sondern erst durch einen Aufhebungsantrag/Antrag nach § 80 Abs. 7 VwGO70 bewirkt – was auch nicht in allen Fällen greift. So kann der Eingriff durch den Vollzug einer (vollziehbar gewordenen) Abschiebungsandrohung bereits bewirkt worden sein, bevor der (nachgelagerte) Rechtsschutz greift. Durch eine – gezielte oder ungezielte – zeitliche Streckung der Verbescheidung werden mithin Rechtsschutzlücken vorprogrammiert, welche durch das Gebot der umfassenden Prüfung der Abschiebungshindernisse durch das Bundesamt gerade vermieden werden sollen. Das bis zum unanfechtbaren Abschluss des Asylverfahrens71 verantwortliche Bundesamt wird durch eine entsprechende Vorabprüfung auch nicht überfordert. Es hat die potenziell relevanten Familienverhältnisse ohnehin aufzuklären und verfügt auch sonst über die Mittel und Möglichkeiten einer wirksamen Koordination bei den Rückkehrentscheidungen. Bedenkenswert und auf die rechtliche wie fachliche Tragfähigkeit hin zu prüfen ist eine Lösung, bei der das Bundesamt eine Abschiebungsandrohung erlässt, deren Wirksamkeit an die Vollziehbarkeit der gegen die anderen Mitglieder des familiären Verbundes gerichteten Abschiebungsandrohung geknüpft wird, deren Bekanntgabe aber die Frist des § 36 Abs. 3 Satz 1 AsylG auslöst.72
6.Anwendung neben „gesundheitlichen Gründen” auch auf sonstige Duldungsgründe?
§ 34 Abs. 1 Nr. 4 AsylG weist dem Bundesamt in Bezug auf den Gesundheitszustand neben dem zielstaatsbezogenen Abschiebungsverbot, das sich nach § 60 Abs. 7 AufenthG bei (mehr oder minder dauerhaften) gesundheitlichen Gründen ergeben kann, auch die Fälle eines bislang (auch) als inlandsbezogenes Vollstreckungshindernis (§ 60 a Abs. 2 AufenthG) eingeordneten (mehr als kurzzeitigen) gesundheitsbezogenen Abschiebungshindernisse zu. Die Prüfungs- und Darlegungsanforderungen (§ 60 a Abs. 2 c, 2 d AufenthG) werden dadurch nicht qualitativ verändert und sind auch im Verfahren vor dem Bundesamt zu beachten. Dies gilt auch für die Anforderungen an die Amtsermittlungspflichten, die sich bei substanziellen Hinweisen auf eine potenziell rückführungshindernde Erkrankung und unverschuldetem Unvermögen zur Vorlage qualifizierter Atteste73 aus der Rechtsprechung zu § 60 a Abs. 2 c, 2 d AufenthG ergeben.74
Wegen der Herleitung aus der (abschließenden) Aufzählung in Art. 5 RL 2008/115/EG, die § 34 Abs. 1 Nr. 4 AsylG in der Sache übernimmt, sind sonstige, im nationalen Recht gründende Duldungsgründe oder Bleibeinteressen, z. B. das Bestehen oder die berechtigte Erwartung einer Ausbildungsduldung,75 grundsätzlich als solche nicht erfasst.76 Nicht zurückzugreifen sein soll auch auf die Figur des faktischen Inländers.77
Keine ausdrücklichen Regelungen enthält das Rückkehrverbesserungsgesetz zu dem Verhältnis des Art. 5 RL 2008/115/EG zu Art. 6 Abs. 4, Art. 9 RL 2008/115/EG und deren Erwägungsgrund 12, nach dem die Situation von Drittstaatsangehörigen, die sich unrechtmäßig im Land aufhalten, aber noch nicht abgeschoben werden können, geregelt werden sollte, und zwar durch eine entsprechende schriftliche Bescheinigung.78 Neben dem Verzicht auf eine Rückkehrentscheidung oder deren Aussetzung (Art. 6 Abs. 4 Satz 3 RL 2008/115/EU) ist in der Richtlinie noch der „Aufschub” der Abschiebung geregelt (Art. 9 RL 2008/115/EG), der außer in den obligatorischen Fällen der aufschiebenden Wirkung eines Rechtsbehelfs (Art. 13 Abs. 2 RL 2008/115/EU) sowie eines Verstoßes gegen den Grundsatz der Nichtzurückweisung fakultativ für einen „angemessenen Zeitraum” auch aus Gründen der körperlichen oder physischen Verfassung des betreffenden Drittstaatsangehörigen oder bei fehlenden Beförderungskapazitäten bzw. unklarer Identität möglich ist. Für die Abgrenzung zu den Fällen, in denen nach Art. 5 RL 2011/115/EG von der Rückkehrentscheidung (durch das Bundesamt) abzusehen ist, kann neben dem Zeitpunkt des Auftretens des Abschiebungshindernisses vor allem auf dessen (voraussichtliche) Dauer abgestellt werden;79 lediglich vorübergehende Duldungsgründe sind nicht schon bei der Rückkehrentscheidung selbst zu berücksichtigen.
7.Anwendung auf Überstellungsentscheidung nach § 34 a AsylG
a) Auf Überstellungsentscheidungen nach § 34 a AsylG ist die Rückkehrrichtlinie nicht anzuwenden. Auch insoweit bilden die Art. 26 ff. VO (EU) 604/2013 lex specialis;80 die Überstellung in einen anderen Mitgliedstaat bewirkt keine Rückkehr in den Herkunfts- oder Drittstaatstaat.81 Die Beachtung an den Gesundheitszustand anknüpfender Überstellungshindernisse folgt hier unmittelbar aus Art. 4 GRC/Art. 3 EMRK.82 In Fällen der Schutzgewähr durch einen anderen Mitgliedstaat stellt sich für die Abschiebungsandrohung nach § 35 AsylG ebenfalls die Frage einer Berücksichtigung der in Art. 5 RL 2008/115/EG bezeichneten Gesichtspunkte. Auch hier gilt, dass die Abschiebung in einen anderen Mitgliedstaat keine Rückkehrentscheidung i. S. d. RL 2008/115/EG bildet,83 die Betroffenen aber nicht schutzlos gestellt werden dürfen.84
b) Bei der Entscheidung über Folgeanträge wird die neuere EuGH-Rechtsprechung (nur) in den Fällen zum Problem, in denen keine erneute Abschiebungsandrohung ergeht. Ein Teil der Rechtsprechung85 sieht hier Art. 5 RL 2008/115/EG mangels (neuerlicher) Rückkehrentscheidung als nicht anwendbar. Ein anderer Teil86 sieht die Umgehung der RL 2008/115/EG als wesentlichen Grund für die Unionsrechtswidrigkeit des Art. 71 Abs. 6 AsylG.
Schon wegen des Kausalitätserfordernisses87 bietet für das Asylverfahren die Optout-Regelung keine Lösung, nach der die Mitgliedstaaten bei einer Rückkehrpflicht aufgrund einer strafrechtlichen Sanktion oder infolge einer strafrechtlichen Sanktion (Art. 2 RL 2008/115/EG) von der Anwendung der Richtlinie absehen können, die die Bundesrepublik Deutschland jedenfalls bis zum Inkrafttreten des Rückkehrverbesserungsgesetzes aber ohnehin nicht in Anspruch genommen hatte.88 Nicht zu vertiefen ist daher, ob der neu eingefügte § 59 Abs. 3 Satz 1 AufenthG mit der von Art. 2 Abs. 2 RL 2008/115/EG geforderten Normenklarheit89 – wie von der Gesetzesbegründung angenommen – wirksam von der Optout-Regelung Gebrauch gemacht hat und – dies unterstellt – über den Hinweis auf §§ 59, 60 in § 34 AsylG überhaupt zur Anwendung gelangte.


