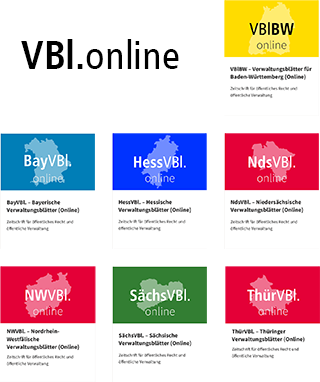Resilienz des Rechtsstaats
Warum der Rechtsstaat unsere stärkste Waffe ist
Resilienz des Rechtsstaats
Warum der Rechtsstaat unsere stärkste Waffe ist
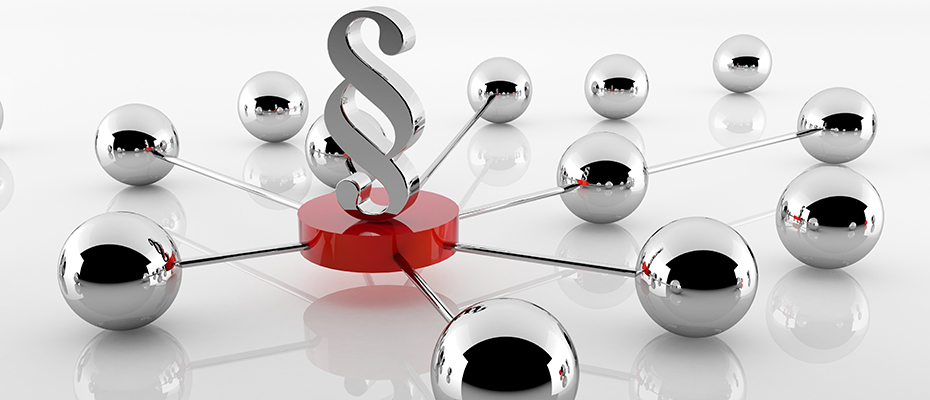
Politisch besetzte Verfassungsgerichte, die Entlassung unliebsamer Richter:innen, willkürliche Maßnahmen der Regierungen, die keiner gerichtlichen Kontrolle unterzogen werden, oder Regierungen, die sich bewusst und willentlich nicht an geltendes Recht oder Gerichtsurteile halten. Warum es notwendig ist, den Rechtsstaat zu schützen.
Was ist „der Rechtsstaat“?
Der Rechtsstaat – was ist dieses theoretische Konzept überhaupt? Oft benennen Politiker:innen diesen als essenzielle Grundlage unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die es zu schützen und
zu fördern gilt. Doch anders als die Demokratie – die Herrschaft des Volkes – ist der Rechtsstaat nicht so einfach zu greifen. Die Rechtsstaatlichkeit ist eine der fünf Staatsstrukturprinzipien aus Art. 20 Abs. 3 des Grundgesetzes. Es drückt sich vor allem dadurch aus, dass in Deutschland eine Gewaltenteilung besteht und dass die individuellen Grundrechte eines:r jeden Einzelnen zu achten und zu schützen sind. Aber auch die Bindung der drei Gewalten an Recht und Gesetz und das Recht auf effektiven rechtlichen Schutz gehören zu den Garantien eines Rechtsstaats. Sie alle sind im Grundgesetz vorgegeben und dadurch rein formell nur sehr schwer zu beseitigen. Doch eine Rechtsstaatskrise kann sich auch anders, viel niedrigschwelliger andeuten.
Dann zum Beispiel, wenn ein Bundesverfassungsgericht gezielt überlastet wird, beispielsweise, indem es gesetzlich verpflichtet ist, alle eingehenden Verfahren chronologisch zu behandeln und bedeutendere bzw. relevantere Verfahren nicht nach vorne ziehen kann. Das wurde glücklicherweise mit den überfraktionellen Grundgesetzänderungen zum Schutz des Bundesverfassungsgerichts im Dezember 2024 verhindert.
Oder dann, wenn der Staat dem Anspruch nicht mehr gerecht werden kann, jedem Menschen Rechtsschutz gewähren und Zugang zu schnellen, effektiven gerichtlichen Verfahren bieten zu können. Dann kann geltendes Recht nicht durchgesetzt und es kann ihm nicht zur vollen Geltung verholfen werden, und das Vertrauen der Menschen in einen fairen staatlichen Konfliktlösungsmechanismus wird erschüttert. Zum Beispiel, wenn die Staatsanwaltschaft aufgrund von Überlastung Verfahren von Diebstahl oder Betrug einstellt oder wenn aufgrund zu weniger Richter:innen im regionalen Amtsgericht einfache Nachbarschaftsstreitigkeiten nicht mehr geklärt werden können oder wenn man keinen Termin bei Arbeitsrechtsanwält:innen bekommt, sodass die Kündigungsschutzklage längst verfristet wäre.
Der Rechtsstaat in Deutschland in Gefahr
Das droht in Deutschland tatsächlich, denn unsere Gerichte sind immer mehr überlastet und es fehlt der juristische Nachwuchs, gerade im ländlichen Raum. Fehlende Digitalisierung, veraltete bürokratische Prozesse und eine unattraktive juristische Ausbildung sind einige der Ursachen für die Probleme. Vieles ist selbst verschuldet oder Resultat ewiger Streitigkeiten zwischen Bund und Ländern. So sind die Investitionen des Pakts für den Rechtsstaat laut dem Deutschen Richterbund viel zu gering, um die Digitalisierung der Justiz voranzutreiben. Papierakten sind nach wie vor Realität in deutschen Gerichten und das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA) hatte große Anlaufschwierigkeiten und wird nach wie vor stark kritisiert. Doch im fehlenden juristischen Nachwuchs zeigt sich exemplarisch, was in den letzten Jahrzehnten verschlafen wurde. In den nächsten Jahren gehen große Teile der sog. „Baby-Boomer“ in Pension. Beispielsweise in Thüringen werden bis 2030 fast 60 % der Richter:innen pensioniert, im Schnitt sind es bundesweit über 40 %. Und mit den aktuellen Absolvent:innen sind diese Plätze kaum auszufüllen oder die Notenanforderungen müssen deutlich nach unten geschraubt werden.
Das ganze Problem ist deshalb entstanden, da über Jahrzehnte nur wenig neu eingestellt wurde, keine neuen Stellen geschaffen wurden und die Stellen in der Justiz oft unattraktiv für Berufseinsteiger:innen sind. Es liegt aber auch daran, dass die juristische Ausbildung nach wie vor enorm unattraktiv ist und sich immer öfter am Recht interessierte Menschen für andere juristische Studiengänge und Berufswege entscheiden als den volljuristischen. Allein das ist ein Grund, die juristische Ausbil-dung strukturell zu reformieren und attraktiv zu machen. Der psychische Druck, die mangelnde Digitalisierung, aber auch die Studien- und Ausbildungsbedingungen im Referendariat sind hier zu nennen. Ein Rechtsstaat erhält sich nicht von allein, man muss auch in ihn investieren.
Jurist:innen, die sich für den Rechtsstaat starkmachen
Allerdings hängt die Zukunft des Rechtsstaates nicht nur von seiner Funktionsfähigkeit und der ausreichenden Besetzung von Richter:innen oder dem Vorhandensein von Anwält:innen ab, sondern auch von der Überzeugung derjenigen, die ihn verteidigen sollen. Wenn die Jurist:innen selbst nicht an den Rechtsstaat glauben und seine Prinzipien und Grundsätze verteidigen, dann ist er seiner Grundlage beraubt. So wurde der NS-Unrechtsstaat im Dritten Reich ermöglicht: Viele Ju-rist:innen, ob Anhänger:innen, Mitläufer:innen oder Opportunist:innen, verwarfen diese in der Weimarer Republik erlernten Prinzipien nach der Machtergreifung 1933 – teils aus Überzeugung, teils, um den Job zu behalten. Grundrechte galten für viele Menschen nicht mehr, gerichtliche Entscheidungen bis hin zu Todesurteilen wurden teilweise in Schauprozessen und Sondergerichten immer willkürlicher getroffen und das Wort des Führers wurde zur absoluten, alles überlagernden Rechtsquelle.
Dass das nie wieder passieren darf, muss 80 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz und dem Ende des Zweiten Weltkriegs eines der zentralen Ziele der juristischen Ausbildung in Deutschland sein. Angehende Jurist:innen sollten in diesem Geiste in der Ausbildung zum kritischen Denken und Hinterfragen der Normen und der Rechtsordnungen, die sie anwenden, befähigt werden. Jurist:innen in Machtpositionen müssen immer hinterfragen, ob das Recht, das sie schaffen, sprechen oder anwenden, tatsächlich Recht und kein (Un-)Recht ist. Frei nach Fritz Bauer ist der:die Jurist:in mit Freiheitssinn die Vorbeugung eines Polizei- und Ordnungsstaates, den wir gesellschaftlich viel zu oft herbeirufen. Ein Recht zum passiven Widerstand, nicht jeden Befehl und nicht jedes Gesetz unhinterfragt anwenden zu müssen, ist die Folge dieses Anspruches. Das muss auch Teil der Ausbildung sein, sodass ein Rechtsstaat auch materiell überlebt. Mit der Novellierung des Deutschen Richtergesetzes 2021 müssen sich angehende Jurist:innen mit dem nationalsozialistischen Unrecht und dem Unrecht der SED-Diktatur auseinandersetzen. Das war und ist ein wichtiger Schritt hin zu einer kritischen Befassung mit dem Recht, der auch mehr und mehr in die Praxis überführt werden muss.
Doch es ist darüber hinaus die kritische Reflexion strukturell in die Ausbildung einzuweben. Das gelingt durch die frühzeitige Vermittlung von Methodenlehre, die historische und kritische Betrachtung der erlernten Rechtsgebiete in den Pflichtfächern sowie das aktive Herausfordern zum kritischen Denken. Und über die ganze Ausbildungslaufbahn hinweg muss es uns um die Vermittlung eines Berufsethos als Verteidiger:innen des Rechtsstaats gehen.
Insofern sind neben den gesetzlichen Anpassungen der letzten Jahre noch vielfältige Maßnahmen zur Stärkung des Rechtsstaates notwendig. Das sollte es uns wert sein: Denn ein funktionsfähiger Rechtsstaat ist resilient gegen autoritäre Bestrebungen, antidemokratische Handlungen und politischen Populismus. Nicht umsonst wird dieser von Autokrat:innen oft als Erstes ausgehöhlt. Ein resilienter Rechtsstaat ist also unbedingte Voraussetzung für unsere Demokratie.
Entnommen aus Recht Reloaded 1/2025, S. 23.