Unbekanntes Kirchenrecht und die Subsidiarität des staatlichen Rechtsschutzes
Eine einheitliche Rechtsprechung der höchsten deutschen Gerichte
Unbekanntes Kirchenrecht und die Subsidiarität des staatlichen Rechtsschutzes
Eine einheitliche Rechtsprechung der höchsten deutschen Gerichte
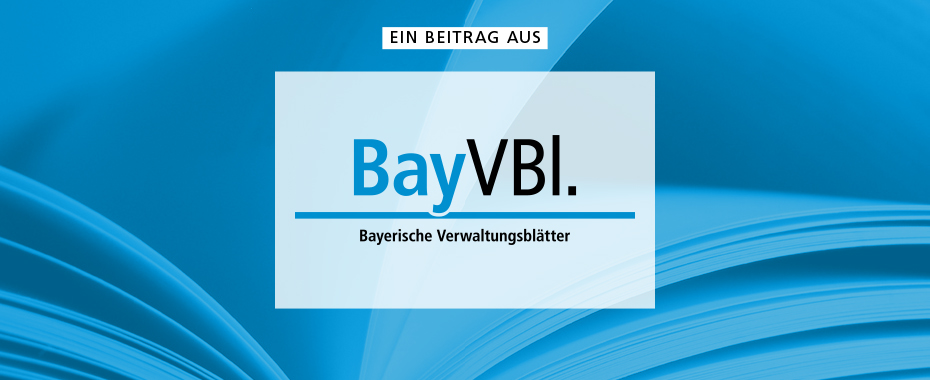
BVerfG, BVerwG, BGH und BAG sind sich einig: Die Inanspruchnahme staatlichen Rechtsschutzes in religionsgemeinschaftlichen Angelegenheiten ist allenfalls subsidiär, nämlich erst nach fruchtloser Erschöpfung eines etwaig eröffneten religionsgemeinschaftsinternen Rechtswegs möglich. Der Subsidiaritätstopos spielt eine Rolle nicht nur im Dienst- und Mitgliedschaftswesen, sondern potenziell bei allen innerreligionsgemeinschaftlichen Angelegenheiten, also jedes Mal, wenn ein Mitglied einer Religionsgemeinschaft gegen diese einen Anspruch geltend macht, für den es eine Grundlage (auch) im religionsgemeinschaftlichen Recht gibt. Das ist häufiger der Fall als gedacht – so auch bei Akteneinsichtsverlangen Missbrauchsbetroffener. Dies wurde unlängst vom VG Bayreuth verkannt.
I. Der Subsidiaritätstopos in der Judikatur
Den Auftakt machte kurz vor der Jahrtausendwende das BVerfG:
„Wenn und soweit die Kirchen die Möglichkeit geschaffen haben, Rechtsstreitigkeiten von einem kirchlichen Gericht beurteilen zu lassen, und somit die Gelegenheit besteht, die Streitigkeit im Einklang mit dem kirchlichen Selbstverständnis beizulegen, gebietet die [aufgrund Art. 140 GG i. V. m. Art. 137 Abs. 3 Satz 1 WRV] verfassungsrechtlich geschuldete Rücksichtnahme gegenüber diesem Selbstverständnis den staatlichen Gerichten, über Fragen des kirchlichen Amtsrechts nach Maßgabe der allgemeinen Gesetze [Art. 140 GG i. V. m. Art. 137 Abs. 3 Satz 1 WRV] und in Erfüllung des Justizgewährungsanspruchs jedenfalls nicht vor Erschöpfung des insoweit gegebenen kirchlichen Rechtswegs zu entscheiden“1.
Daran anknüpfend konstatierte der BGH wenige Jahre später (und gleichfalls in einer kirchendienstrechtlichen Streitigkeit):
„Ist ein derartiger [nämlich kirchlicher] Rechtsweg geschaffen und von ihm ein effektiver Rechtsschutz auch zu erwarten, dürfen staatliche Gerichte nicht vor Erschöpfung des kirchlichen Rechtswegs entscheiden. Der Klage fehlt dann das Rechtsschutzbedürfnis. Der innerkirchliche Rechtsschutz ist vorrangig und die staatliche Justizgewährung insoweit subsidiär“2.
Nach einiger Zeit schlossen sich weitere Bundesgerichte dieser Sichtweise an. So judizierte das BAG (methodisch schulmäßig):
„Das Rechtsschutzbedürfnis zur Anrufung staatlicher Gerichte kann […] fehlen, wenn es in innerkirchlichen Angelegenheiten ausschließlich um die Anwendung kirchlichen Rechts geht, für entsprechende Streitigkeiten durch die Anrufung kircheneigener Gerichte oder Schlichtungsgremien ein Rechtsweg geschaffen und von ihm ein effektiver Rechtsschutz zu erwarten ist“3.
Das BVerwG schließlich rekurrierte auf den Subsidiaritätstopos bereits mehrmals (und das nicht nur in dienstrechtlichen Streitigkeiten):
„Aufgrund des grundgesetzlichen Selbstbestimmungsrechts der Religionsgesellschaften ist der staatliche Rechtsschutz subsidiär. Ein Rechtsschutzbedürfnis für die Anrufung der staatlichen Gerichte besteht erst dann, wenn ein von der Religionsgesellschaft eröffneter interner Rechtsweg erfolglos ausgeschöpft worden ist“4.
Kurz gesagt:
„In der jüngeren Rechtsprechung des BVerwG ist ausdrücklich geklärt, dass die Inanspruchnahme staatlichen Rechtsschutzes in kirchendienstrechtlichen Angelegenheiten allenfalls subsidiär – erst nach Erschöpfung des innerkirchlichen Rechtswegs – […] möglich ist“5.
II. Streitgegenstände, Kläger und Beklagte
Die Bundesgerichte und ihnen folgend die Instanzgerichte nutzen den Subsidiaritätstopos vornehmlich in den sie häufig beschäftigenden und daher praxisrelevanten dienstrechtlichen Streitigkeiten, so etwa bei (Ruhe-)Gehaltsklagen von Geistlichen6 und Kirchenbeamten7, bei Klagen auf Besoldungsgruppenzuordnung8, Weiterbeschäftigung9, Ruhestandsversetzung10 oder Aktenherausgabe11 und bei Streitigkeiten um Beteiligungsrechte der Schwerbehindertenvertretung12. Jenseits des insofern tangierten religionsgemeinschaftlichen Dienstrechts wird die Subsidiarität des staatlichen Rechtsschutzes gegenüber dem religionsgemeinschaftlichen Rechtsschutz thematisiert bei Klagen auf Gewährung von Einsicht in Patientenakten13, auf Grabnutzung14 oder auf staatliche Anerkennung kirchengerichtlich festgesetzter Kostenerstattungsansprüche15 und bei mitgliedschaftsrechtlichen Streitigkeiten, so bei Klagen auf Feststellung der Unwirksamkeit eines Ausschlusses aus der Religionsgemeinschaft16 oder auf Feststellung der Nichtigkeit von Beschlüssen eines religionsgemeinschaftlichen Organs17.
Der Subsidiaritätstopos wird von den staatlichen Gerichten zumeist im Hinblick auf den Streitgegenstand, vereinzelt auch bei vorgreiflichen Fragen18 oder in Prozesskostenhilfeverfahren19 fruchtbar gemacht.
Auf Klägerseite standen in den bereits erwähnten Verfahren überwiegend Beschäftigte der beklagten Religionsgemeinschaft, bisweilen auch deren Organmitglieder20, selten „einfache“ Gläubige21, eine vormalige Patientin eines kirchlichen Krankenhauses22 oder gar die Religionsgemeinschaft selbst23. Sie alle sahen sich gezwungen, den Subsidiaritätstopos zu achten.
Auf Beklagtenseite befanden sich meist evangelische Landeskirchen, mitunter katholische Bistümer24 (und ein „Katholisches Datenschutzzentrum […] KdöR“)25, ferner auch jüdische Gemeinden26, die Zeugen Jehovas27 und die (eine christliche Freikirche darstellende) Heilsarmee28.
III. Untersuchungsgegenstand
Von diesen Religionsgemeinschaften sollen nachfolgend ausschließlich die als Körperschaften des öffentlichen Rechts verfassten Teilkirchen (Bistümer) der römisch-katholischen Kirche betrachtet werden. Diese thematische Selbstbeschränkung hat mehrere Gründe: Zum einen ist die vorrangige Inanspruchnahme innerkirchlichen Rechtsschutzes bei der katholischen Kirche realiter weitaus schwieriger und rechtsstaatlich problematischer als bei der evangelischen Kirche (die kirchliche Arbeitsgerichtsbarkeit jeweils ausgeblendet). Denn während die evangelische Kirche bereits seit vielen Jahren über eine unabhängige allgemeine Verwaltungsgerichtsbarkeit verfügt, kennt die katholische Kirche in Deutschland nur (und zudem erst seit kurzer Zeit) besondere Verwaltungs-, nämlich Datenschutzgerichte und ansonsten traditionell nur den Rechtsschutz mittels Verwaltungsbeschwerde. Zum anderen dürfte die Geltendmachung von – hier exemplarisch betrachteten – Ansprüchen Missbrauchsbetroffener auf Akteneinsicht bei der katholischen Kirche eine größere Rolle spielen als bei der vom Missbrauchsskandal in geringerem Maße gebeutelten evangelischen Kirche. Davon zeugt auch der anschließend untersuchte Beschluss des VG Bayreuth, ist dieser doch aufgrund einer Klage gegen das Erzbistum Bamberg ergangen. Und schließlich findet sich die Normierung eines allgemeinen Akteneinsichtsrechts im katholischen Kirchenrecht nicht, wohl aber im evangelischen Kirchenrecht, das eine dem § 29 VwVfG (= Art. 29 BayVwVfG) nachgebildete Vorschrift29 enthält.
Die nun folgenden Darlegungen zum Subsidiaritätstopos in der verwaltungsgerichtlichen Judikatur betreffend die katholische Kirche gelten entsprechend für alle Gerichtsbarkeiten und auch für nicht katholische Religionsgemeinschaften. Sub specie des (vorrangigen) innerkirchlichen Rechtsschutzes beansprucht das zum Akteneinsichtsrecht Gesagte mutatis mutandis Geltung auch allgemein, d. h. für sonstige kirchenrechtlich fundierte Ansprüche.
IV. Der Beschluss des VG Bayreuth vom 12. September 2023
Das VG Bayreuth hat auf die Klage eines nach seinem Vorbringen von Missbrauch Betroffenen gegen das Erzbistum Bamberg auf Gewährung von Einsicht in kirchliche (u. a. Personal- und Strafverfahrens-)Akten den beschrittenen Verwaltungsrechtsweg für unzulässig erklärt und das Verfahren an das sachlich und örtlich zuständige Landgericht verwiesen. Das Verwaltungsgericht ist der Ansicht, die Geltendmachung auf dem Zivilrechtsweg sei zwingend, da es dem Kläger ausschließlich um die Vorbereitung einer Schadensersatz-, nämlich Amtshaftungsklage gehe. Das vorgelagerte streitgegenständliche Akteneinsichtsbegehren unterfalle als Annex des Amtshaftungsanspruchs der Rechtswegzuweisung des Art. 34 Satz 3 GG („ordentlicher Rechtsweg“)30.
Das VG Bayreuth hat verkannt, dass der klageweise geltend gemachte Anspruch seine Grundlage (auch und bereits) im Kirchenrecht findet und daher vorrangig auf dem kirchlichen Rechtsweg hätte verfolgt werden müssen. Da Letzteres nicht geschehen ist, der Kläger es also versäumt hat, den für sein Anliegen eröffneten kirchlichen Rechtsweg (erfolglos) zu durchlaufen, hätte das Verwaltungsgericht unter Zugrundelegung des Subsidiaritätstopos die Klage mangels Rechtsschutzbedürfnisses für die Anrufung staatlicher Gerichte als unzulässig abweisen müssen. Die Klageabweisung obliegt nun dem Landgericht.
Sonstige Fehlannahmen des VG Bayreuth (Amtshaftung, Ausübung „öffentlicher Gewalt“)31 bleiben im Weiteren ausgeblendet.
Den gesamten Beitrag lesen Sie in unseren BayVBl. Heft 13/2024.



