Herausforderungen bei der Finanzierung der Energiewende
Im kommunalen Bereich
Herausforderungen bei der Finanzierung der Energiewende
Im kommunalen Bereich
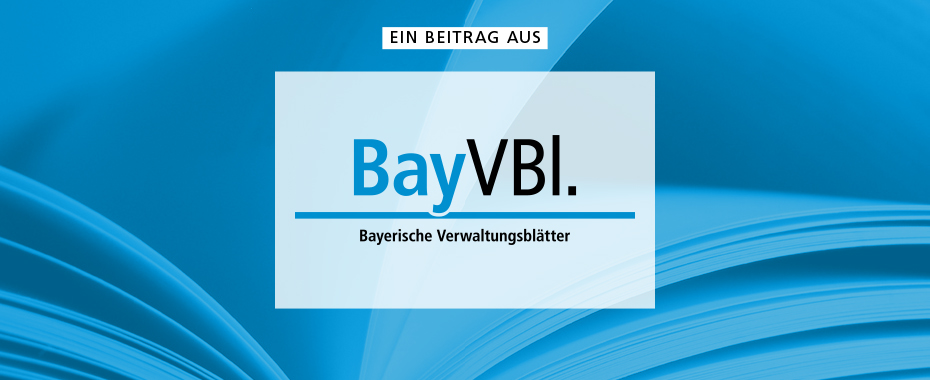
Die Energiewende und die hierfür notwendigen Investitionen stellen sowohl staatliche wie auch kommunale Ebenen vor erhebliche Herausforderungen. Den Kommunen kommt eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der jeweils vor Ort umzusetzenden Transformation der Energieversorgung zu. Dies betrifft nicht nur Begleitung und Ermöglichung von privat finanzierten Maßnahmen, sondern auch Investitionen der kommunalen Ebenen selbst. Dabei ist eine Vielzahl von Rahmenbedingungen zu beachten, welche sich sowohl aus EU- und Bundes- als auch Landesrecht ergeben. Zudem ist die Verflechtung zwischen den einzelnen kommunalen Ebenen auch unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten zu beachten. Durch neue gesetzliche Regelungen entstehen völlig neue Finanzströme zwischen diesen Ebenen, was zu neuen und bisher noch nicht adressierten Fragestellungen, unter anderem im Bereich von Kreis- und Bezirksumlagen, führt. Insgesamt erscheint eine stärkere Koordinierung der Energiewende zwischen den verschiedenen Beteiligten im kommunalen Bereich notwendig, auch um die Rentabilität von Investitionen kalkulieren zu können.
I. Einleitung
„Wir stellen die Weichen auf eine sozial-ökologische Marktwirtschaft und leiten ein Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen ein1”. Dieser Programmsatz stellt den Kern der wirtschaftspolitischen Zielsetzungen der Bundesregierung der 20. Wahlperiode („Berliner Ampelkoalition”) dar und fasst gleichzeitig die globalen Bemühungen um eine nachhaltige Transformation zusammen. Die Ansätze für die Zielerreichung sind vielschichtig: Neben Vorgaben für Bürger werden Anreize durch Förderungen ebenso wie die Anpassung von Standards als wichtiger Baustein bei der Umbildung bestehender Strukturen behandelt.
Diese staatlichen Vorgaben erhöhen jedoch auch den Handlungsdruck für die unteren Verwaltungsebenen und eröffnen so neue rechtliche Spannungsfelder. Auch sind die Anforderungen auf den verschiedenen Ebenen der Gesetzgebung im Rahmen einer Gesamtschau zu berücksichtigen; denn bei Regelungen zum Naturschutz kommt Bund und Ländern nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 29 GG die konkurrierende Gesetzgebung zu, wobei die Länder nach Art. 72 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 GG auch dann abweichende Regelungen treffen können, wenn der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit Gebrauch gemacht hat.
Im Bereich des ebenfalls einschlägigen Rechts der Energiewirtschaft hat der Bund das konkurrierende Gesetzgebungsrecht, wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich macht. Im Übrigen besteht nach Art. 72 Abs. 2 i. V. m. Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG die Länderbefugnis zur Gesetzgebung. Die Energiewirtschaft war als eigenständige Kompetenzmaterie weder der Reichsverfassung von 1871 noch der Weimarer Reichsverfassung bekannt und auch im Entwurf des Verfassungskonvents von Herrenchiemsee nicht vorgesehen; der kompetenzverfassungsrechtliche Begriff der Energiewirtschaft ist entwicklungsoffen konzipiert, sodass er in dynamischer Weise auch innovative Entwicklungen auf dem Energiesektor sowie daraus resultierende zukünftige Herausforderungen abdeckt. Demgemäß umfasst er die Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Energie in jeglicher Form. Hierbei ist der Kompetenzbereich in einem weiten Sinn zu verstehen2.
Oft wird dabei gerade die Vorbildrolle der öffentlichen Hand beim Klimaschutz betont, so unter anderem im Bayerischen Klimaschutzgesetz3. Den Gemeinden kommt dabei als Träger zahlreicher öffentlicher Dienste sowie Aufgaben und einem damit einhergehenden zahlreichen Gebäude- und Flächenbestand eine hohe Bedeutung zu. Dabei haben sich die Gemeinden an bundes- und landesrechtlichen Regelungen zu orientieren, die im Kompetenzgefüge zwischen Bund und Ländern verteilt sind.
II. Bundesrechtliche Vorgaben und Rahmenbedingungen für die Kommunen
Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG gewährleistet den Gemeinden das Recht, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Diese Gewährleistung kommunaler Selbstverwaltung sichert den Gemeinden einen grundsätzlich alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft umfassenden Aufgabenbereich sowie die Befugnis zu eigenverantwortlicher Führung der Geschäfte in diesem Bereich zu, da Art. 28 GG die Gemeinden als einen wesentlichen Bestandteil der staatlichen Gesamtorganisation konstituiert; sie sind selbst ein Teil des Staates, in dessen Aufbau sie integriert und innerhalb dessen sie mit eigenen Rechten ausgestattet sind4. Den Gemeinden wird mit Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG, ohne ein Grundrecht zu statuieren, die Selbstverwaltung objektiv-rechtlich als Rechtsinstitution garantiert und die vollständige und flächendeckende Ersetzung der kommunalen Verwaltung auf der Ortsebene durch untere staatliche Verwaltungsbehörden subjektiv-rechtlich verhindert 5.
Der Gesetzgeber darf Gemeinden eine Aufgabe mit relevantem örtlichem Charakter nur aus Gründen des Gemeininteresses, vor allem also etwa dann entziehen, wenn anders die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung nicht sicherzustellen wäre und wenn die den Aufgabenentzug tragenden Gründe gegenüber dem verfassungsrechtlichen Aufgabenverteilungsprinzip des Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG überwiegen6.
Die Kommunen trifft im Bereich des Klimaschutzes und der Energiewende als unterste Verwaltungsebene in der Hierarchie der öffentlichen Gebietskörperschaften7 eine besondere Verantwortung, die ihren Niederschlag in verschiedenen gesetzlichen Vorgaben findet. Der Gesetzgeber ist dabei für eine verantwortungsvolle Anpassung der rechtlichen Rahmenbedingungen verantwortlich – hier treffen Staatszielbestimmungen wie Art. 20a Grundgesetz (GG) auf verfassungsmäßige Garantien wie die Selbstverwaltung der Kommunen nach Art. 28 GG. Dabei ist nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die auch auf der Rechtsprechung des Staatsgerichtshofs für das Deutsche Reich und der Regelung des Art. 127 der Weimarer Reichsverfassung beruht, entscheidend, dass die Gesetzgebung das Recht kommunaler Selbstverwaltung nicht aufheben und die Verwaltung der Gemeindeangelegenheiten nicht den Staatsbehörden übertragen darf; sie darf die Selbstverwaltung auch nicht derart einschränken, dass sie innerlich ausgehöhlt wird, die Kommune die Gelegenheit zu kraftvoller Betätigung verliert und nur noch ein Scheindasein führen kann8.
1. Zur Finanzhoheit der Kommunen
Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG sieht vor, dass den Gemeinden das Recht gewährleistet sein muss, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft, insbesondere die Grundlagen der finanziellen Eigenverantwortung, im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Das Recht der eigenverantwortlichen Gemeindeführung bedeutet zwar die Freiheit von Reglementierungen des Staates9, diese Freiheit trifft jedoch auf den gesetzlichen Ausgestaltungsbedarf des originären Aufgabenbedarfs der Gemeinden. Dieses Spannungsfeld findet seinen Niederschlag in der Diskussion um die Grenzen von Ausgestaltungsnotwendigkeit und Aushöhlungsverbot der kommunalen Selbstverwaltung10.
Aus der Finanzhoheit der Kommunen folgt jedoch grundsätzlich kein Schutz vor der Übertragung von Aufgaben, die zu Ausgabensteigerungen bei den jeweiligen Kommunen führen11. Das Konnexitätsprinzip mit umfassenden Ausgleichsregelungen ist dem Grundgesetz fremd12. Lediglich Art. 106 Abs. 8 GG sieht einen Ausgleich von Vermögenseinbußen vor, wenn der Bund einzelnen Ländern oder Gemeinden besondere Einrichtungen abverlangt. Umso wichtiger ist die Interessenabwägung, die er beim Aufeinandertreffen verschiedener geschützter Positionen vornehmen muss.
Allerdings steht den Gemeinden nach Art. 28 Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 2 GG mit dem Hebesatzrecht eine wirtschaftsbezogene Steuerquelle zu. Nach Art. 106 Abs. 5 bis 8 GG stehen den Gemeinden und Gemeindeverbänden weiterhin Anteile an bestimmten Steueraufkommen zu. Gleichzeitig gewährt Art. 28 Abs. 2 Satz 2 GG den Gemeindeverbänden im Rahmen ihres gesetzlichen Aufgabenbereiches nach Maßgabe der Gesetze das Recht der Selbstverwaltung, zu dem auch die Grundlagen der finanziellen Eigenverantwortung gehören. Es besteht also eine praktisch bedeutsame Spannungslage, da sich die Gemeindeverbände über ihre Mitgliedsgemeinden finanzieren. Hierbei gibt es keine Vorrangposition zwischen Gemeinden und Gemeindeverbänden betreffend die jeweilige Finanzhoheit; hier ist es Aufgabe des jeweiligen Landesgesetzgebers, einen angemessenen Ausgleich unter Wahrung des Grundsatzes des finanziellen Gleichrangs zu schaffen13.
2. Zur Planungshoheit der Kommunen
Neben der Finanzhoheit ist ein weiterer Kernbereich der Selbstverwaltungsgarantie die gemeindliche Planungshoheit. Diese meint die grundrechtlich geschützte Befugnis der Gemeinden, voraussehbare Entwicklungen bezogen auf das Gemeindegebiet längerfristig zu steuern, sodass die Gemeinden in ihrem Gebiet die zentralen Entscheidungen über die zukünftige Gestaltung des Gemeindegebiets treffen können müssen14.
Die Planungshoheit stellt insoweit die für die Betroffenen spür- und sichtbare Gestaltung des Gemeindegebietes dar und dient so gerade der „Aktivierung der Beteiligten für ihre eigenen Angelegenheiten”15 und dem Aufbau der Demokratie von unten nach oben.
3. Zum Klimaschutz
Gemäß Art. 20a GG schützt der Staat auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung. Dieses Staatsziel des Umweltschutzes, das auch den Klimaschutz beinhaltet16, bedarf der Umsetzung im Einzelfall, also der Präzisierung im Rahmen eines konkreten Sachverhaltes und darauf aufbauend der Entfaltung17.
Bereits in den vergangenen Jahren wurden die gesetzlichen Rahmenbedingungen im Hinblick auf klimagerechte Handlungsweisen fortwährend angepasst18, die auch die Kommunen in Anspruch nehmen.
Seit 2019 sind Einzelmaßnahmen aufgrund des Klimaschutzprogramms der Bundesregierung nach § 9 Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) möglich, die nach § 13 Abs. 1 Satz 1 KSG von den Trägern öffentlicher Aufgaben zu berücksichtigen sind; dabei können die Gemeinden und Gemeindeverbände das Berücksichtigungsgebot innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs ausgestalten.
2022 hat der Bundesgesetzgeber den Ländern in § 3 Abs. 1 des Gesetzes zur Festlegung von Flächenbedarfen für Windenergieanlagen (WindBG) in Verbindung mit der Anlage zum WindBG verbindliche Flächenziele für den Ausbau der Windenergie an Land vorgegeben. Die Länder müssen diese Ziele nach § 3 Abs. 2 WindBG durch eigene Ausweisung der Flächen oder Sicherstellung der Ausweisung durch die regionalen Planungsträger erreichen19.
Aktuell werden die Kommunen erneut als ein Träger der Energiewende stärker in den Fokus und in besondere Verantwortung genommen, da Wärmepläne zu erstellen sind20. Alleine für die Erstellung der neuen Wärmeplanung rechnet die Bundesregierung mit einem einmaligen Erfüllungsaufwand von 535 Millionen Euro bis 2028 und ab 2029 mit jährlich 38 Millionen Euro21. § 4 des Gesetzes für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze (WPG) verpflichtet die Länder, eine Wärmeplanung in ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet sicherzustellen, und gibt je nach Einwohnerzahl des betroffenen Gemeindegebietes zeitliche Vorgaben für die Aufstellung des Wärmeplans.
Allein diese kleine Auswahl zeigt, dass der Druck auf die kommunale Ebene wächst. Gemeinden und Gemeindeverbände müssen mehr Vorgaben berücksichtigen und sehen sich einer zunehmenden Anzahl an (zeitlich drängenden) Aufgaben gegenüber. Das bindet personelle und finanzielle Mittel, die dringend anderweitig benötigt würden. Nicht in allen Fällen erhalten die Kommunen einen adäquaten Finanzausgleich. Trotz der bestehenden Förderkulisse wird daher Handlungsbedarf gesehen22.
III. Landesrechtliche Vorgaben und Rahmenbedingen für die Kommunen
Auch Art. 11 Abs. 2 der Bayerischen Verfassung gewährleistet, wie Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG, die kommunale Selbstverwaltung der Gemeinden, wobei Art. 83 Abs. 1 BV thematisch ausfüllt und konkretisiert, was Art. 11 Abs. 2 BV mit dem Begriff der kommunalen Angelegenheiten umschreibt. Die Selbstverwaltungsgarantie des Art. 11 Abs. 2 BV ist dabei so zu verstehen, dass der einfache Landesgesetzgeber den Gemeinden keines der in Art. 83 Abs. 1 BV erwähnten Aufgabengebiete vollständig entziehen darf. Die dort genannten Bereiche müssen den Gemeinden grundsätzlich erhalten bleiben23.
Dabei sind die staatlichen Behörden aufgrund der verfassungsrechtlichen Garantie des Selbstverwaltungsrechts grundsätzlich verpflichtet, die Selbstverwaltung zu fördern und zu stärken, die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinden zu erhalten und sich gemeindefreundlich zu verhalten24.
1. Zur Finanzhoheit der Kommunen
Anders als das Grundgesetz kennt die Bayerische Verfassung, wie auch nahezu alle anderen Länderverfassungen25, mit Art. 83 Abs. 3 das Konnexitätsprinzip: „Überträgt der Staat den Gemeinden Aufgaben, verpflichtet er sie zur Erfüllung von Aufgaben im eigenen Wirkungskreis oder stellt er besondere Anforderungen an die Erfüllung bestehender oder neuer Aufgaben, hat er gleichzeitig Bestimmungen über die Deckung der Kosten zu treffen. Führt die Wahrnehmung dieser Aufgaben zu einer Mehrbelastung der Gemeinden, ist ein entsprechender finanzieller Ausgleich zu schaffen”. In der Literatur wird dazu auch prägnant geäußert: „Wer anschafft, soll auch bezahlen”26.
Die Geltung des strikten Konnexitätsprinzips setzt nach der Begründung zur Regelung des Art. 83 Abs. 3 BV voraus, dass die Kosten durch eine Entscheidung des Freistaats Bayern, gleich welcher Rechtsnatur, Gesetze, Rechtsverordnungen, aber auch Verwaltungs- und Ausführungsvorschriften, verursacht werden (Verursacherprinzip). Keine Kostenverursachung durch den Freistaat liegt vor, wenn der Bund eine Aufgabe unmittelbar den Gemeinden überträgt, wenn Inhalt und Umfang der gemeindlichen Aufgaben durch Bundes- und Europarecht bestimmt werden oder wenn durch Landesrecht lediglich bundes- oder europarechtliche Vorgaben umgesetzt werden und dabei kein eigener Gestaltungsspielraum des Landes verbleibt, der eine Rücksichtnahme auf die bei den Gemeinden entstehenden Kosten ermöglicht27.
2. Zum Klimaschutz
Art. 141 BV enthält – wie auch Art. 20a GG – die Staatszielbestimmung des Umweltschutzes, die allerdings bereits vor der Regelung des Art. 20a GG in der Bayerischen Verfassung enthalten war28 und zudem auch explizit an Gemeinden und Körperschaften des öffentlichen Rechts adressiert ist. Diese bedarf als Staatszielbestimmung weiterer Umsetzungsregelungen29.
Das Bayerische Klimaschutzgesetz appelliert mit Art. 3 schon nach dessen Titel an die „Vorbildfunktion” des Freistaates Bayern und normiert in der aktuellen Fassung, dass die Behörden und Einrichtungen der unmittelbaren Staatsverwaltung des Freistaates Bayern bis zum Jahr 2028 eine klimaneutrale Verwaltung erreichen sollen (Abs. 1)30, wobei die Staatskanzlei und die Staatsministerien bis zum Jahr 2023 klimaneutral sein sollen (Abs. 2). Den kommunalen Gebietskörperschaften wird dabei empfohlen, entsprechend der unmittelbaren Staatsverwaltung des Freistaates Bayern bis zum Jahr 2028 eine klimaneutrale Verwaltung zu verwirklichen (Art. 3 Abs. 5). Da es sich hierbei aber lediglich um eine Empfehlung handelt, werden keine Konnexitätsfolgen mit Kostentragungspflicht des Freistaates Bayern nach Art. 83 Abs. 3 BV ausgelöst31.
Art. 152 Satz 1 BV verpflichtet den Freistaat Bayern zur Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung, wobei Art. 152 Satz 2 BV explizit die Sicherstellung der Versorgung des Landes mit elektrischer Kraft normiert. Satz 2 enthält damit einen energiepolitischen Sicherstellungs- oder Gewährleistungsauftrag an die Organe des Freistaates Bayern. Diese, also zumal Landtag und Staatsregierung, haben im Rahmen und nach Maßgabe ihrer Zuständigkeiten die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Versorgung mit elektrischer Energie sichergestellt ist32. Zugleich normiert Art. 83 Abs. 1 Bayerische Verfassung, dass in den eigenen Wirkungskreis der Gemeinden insbesondere die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser, Licht, Gas und elektrischer Kraft fällt.
Dabei bezieht sich vorstehend erwähnter Art. 152 Satz 2 BV auf die Zuständigkeit des Freistaates Bayern für die grundsätzliche landesweite Versorgung mit Elektrizität, während gemäß Art. 83 Abs. 1 BV die örtliche Versorgung durch die Gemeinden zu gewährleisten ist und sie damit in diesem Bereich tätig werden dürfen33. Da es sich bei der örtlichen Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität um eine eigene Pflichtaufgabe der Kommunen handelt, die nicht durch eine Entscheidung des Freistaats Bayern verursacht ist, greift das Konnexitätsprinzip des Art. 83 Abs. 3 BV nicht.
Entsprechend der verfassungsrechtlichen Vorgabe des Art. 83 Abs. 1 BV, Energieversorgung als Aufgabe des eigenen Wirkungskreises der Kommunen, hat der Gesetzgeber das Bayerische Klimaschutzgesetz ergänzt und mit Art. 3 Abs. 6 Satz 1 BayKlimaG normiert, dass im eigenen Wirkungskreis die Gemeinden, Landkreise und Bezirke im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit Anlagen zur Erzeugung von erneuerbaren Energien errichten und betreiben können. Dabei sind sie nach Art. 3 Abs. 6 Satz 2 BayKlimaG nicht an die Deckung des voraussichtlichen Bedarfs in ihren jeweiligen Gebieten gebunden. Ergänzt wird die Regelung durch Art. 3 Abs. 6 Satz 3 BayKlimaG, dass die Aufgabe der Gemeinden, die Bevölkerung mit Energie zu versorgen, unberührt bleibt.
Nach der Gesetzesbegründung könnten die Gemeinden, Landkreise und Bezirke im Interesse des Klimaschutzes mit der Erzeugung erneuerbarer Energien einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass die erforderliche Energie nachhaltig, sicher und von Importen möglichst unabhängig zur Verfügung gestellt werden kann und bezahlbar bleibt. Dies könne durch das Hinzutreten der Landkreise und Bezirke im Bereich der Energieerzeugung gefördert werden. Dass die Energieversorgung der (örtlichen) Bevölkerung gemäß Art. 83 Abs. 1 BV in den eigenen Wirkungskreis der Gemeinden fällt, stehe dem Hinzutreten der Landkreise und Bezirke im Bereich der Energieerzeugung grundsätzlich nicht entgegen. Die Zuständigkeit der Gemeinden für die Versorgung der örtlichen Bevölkerung werde durch die Erzeugung von erneuerbaren Energien durch die Landkreise und Bezirke nicht angetastet34.
Explizit führt der Gesetzgeber aus, dass die Aufgabenwahrnehmung durch die Landkreise und Bezirke, die eigentlich nur subsidiär tätig werden sollen (Art. 4 LKrO: „der auf das Kreisgebiet beschränkten öffentlichen Aufgaben” bzw. Art. 4 BezO: „auf das Gebiet des Bezirks beschränken”)35, als auch bezüglich des Kriteriums der Örtlichkeit bei der Erzeugung regenerativer Energien durch Gemeinden, Landkreise und Bezirke aus Gründen des Klimaschutzes und der sicheren Verfügbarkeit bezahlbarer erneuerbarer Energien gerechtfertigt erscheine36.
Während es die Ebene der Landkreise – mit Ausnahme der Stadtstaaten – in allen Ländern gibt37, gibt es Bezirke, die als Gebietskörperschaften das Recht haben, überörtliche Angelegenheiten, die über die Zuständigkeit oder das Leistungsvermögen der Landkreise und kreisfreien Gemeinden hinausgehen und deren Bedeutung über das Gebiet des Bezirks nicht hinausreicht, im Rahmen der Gesetze selbst zu ordnen und zu verwalten38, als umfassend organisierte dritte kommunale Ebene nur in Bayern und Rheinland-Pfalz39.
Daher erscheint es verständlich, dass die bundesgesetzlichen Regelungen bezüglich der Energiewende nicht auf die kommunale Ebene der Bezirke eingehen. Es stellt sich jedoch die Frage, ob nicht auch auf der Ebene der Landkreise, insbesondere in den Flächenländern, eine überregionale Zusammenarbeit auf der Bezirksebene fachlich sinnvoll sein kann, um die großen Herausforderungen der Energiewende zu bewältigen. Landkreisübergreifende Strukturen erscheinen auf jeden Fall für ein planvolles Vorgehen sinnvoll und stellen eine Ergänzungsmöglichkeit zum Handeln auf der Landes- oder Bundesebene dar. Ihren Platz im bundesrechtlich geprägten Rechtsrahmen zu finden, wird in der praktischen Umsetzung jedoch schwierig. Hier haben die Hilfestellungen und Vorgaben des bayerischen Gesetzgebers ein besonderes Gewicht für das Funktionieren der Energiewende.
VIII. Fazit
Die Gesetzgeber streben, auch ausweislich der Klimaschutzgesetze, an, die Energieende zu beschleunigen. Der kommunalen Ebene kommt hierbei an verschiedenen Stellen eine Schlüsselrolle zu. Nicht zuletzt auch durch eigene Investitionen. Allerdings ist eine Fülle an Vorgaben zu beachten und die Kalkulation, ob eine konkrete Anlage unter den bestehenden Rahmenbedingungen tatsächlich plausibel wirtschaftlich betrieben werden kann, kann für eine einzelne Kommune kaum durchgeführt werden. Die vorstehend ausgeführten notwendigen Abwägungen, Prüfungen und rechtlichen Unsicherheiten legen nahe, dass es weiterer Reformanstrengungen bedarf, um den Kommunen zu erlauben, ihren Beitrag hierzu effizient und effektiv zu leisten. Insbesondere erscheint es angemessen, eine stärkere überörtliche Koordination zu befördern.
Den vollständigen Beitrag lesen Sie in Bayerische Verwaltungsblätter 21/2024, S. 725.



