Das kommunalrechtliche Mitwirkungsverbot wegen Befangenheit
Rechtliche Anforderungen, Spannungsfelder und aktuelle Rechtsprechung
Das kommunalrechtliche Mitwirkungsverbot wegen Befangenheit
Rechtliche Anforderungen, Spannungsfelder und aktuelle Rechtsprechung
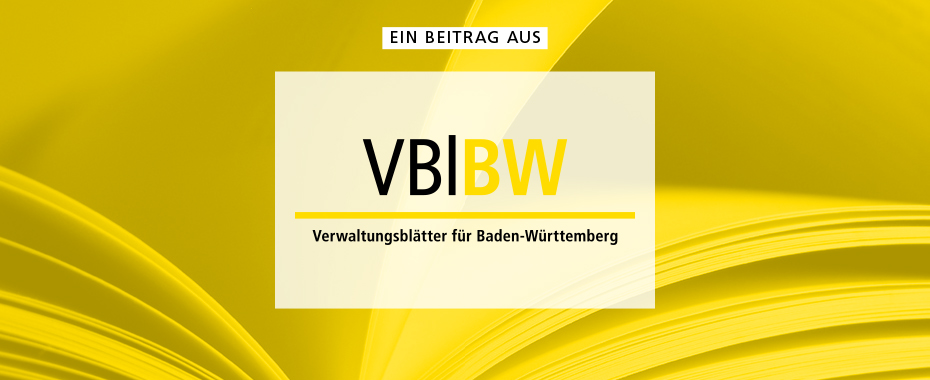
Das Mitwirkungsverbot wegen Befangenheit (§ 18 GemO, § 14 LKrO) ist in der kommunalen Praxis von erheblicher Bedeutung. Von den vielen Streitfragen zeugen nicht zuletzt die Entscheidungen des VGH BW. Die vorliegende Abhandlung analysiert die gesetzlichen Anforderungen an den Ausschluss eines ehrenamtlich tätigen Bürgers sowie weiterer Amtsträger wegen Befangenheit und ordnet die dazu ergangene Rechtsprechung – mitunter kritisch – ein. Hinweise auf das einschlägige Kommunalrecht anderer Länder erfolgen insbesondere dort, wo der Kontrast zu fremden Regelungen das Verständnis der in Baden-Württemberg geltenden Rechtslage schärft.
I. Bedeutung des Mitwirkungsverbots wegen Befangenheit
1. Gesetzlicher Befund
Die Wahrung von „innerer Distanz und Neutralität” seitens der zuständigen Amtswalter zählt zu den Grundbedingungen eines rechtsstaatlichen Verwaltungsverfahrens.1 Gesetzlicher Ausdruck hierfür sind im Allgemeinen Verwaltungsrecht §§ 20, 21 (L)VwVfG. Diese Vorschriften gelten als Positivierung eines verallgemeinerungsfähigen Neutralitätsgebots, das die persönlich-individuelle Unparteilichkeit der im Verwaltungsverfahren für die Behörde agierenden Personen sicherstellt.2 Auch der ehrenamtlich Tätige muss gemäß § 83 Abs. 1 (L)VwVfG (gewissenhaft und) unparteiisch handeln.3 Das Beamtenrecht bekräftigt die Vorgaben; Beamte müssen ihre Aufgaben unparteiisch (und gerecht) erfüllen.4 Vergleichbares gilt im gerichtlichen Verfahren. Wegen Besorgnis der Befangenheit kann ein Richter abgelehnt werden, wenn ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen gegen die Unparteilichkeit des Richters zu rechtfertigen.5
Die kommunalrechtlichen Vorschriften zum Mitwirkungsverbot wegen Befangenheit (§ 18 GemO, § 14 LKrO) folgen einer anderen Rationalität als die Befangenheitsregelungen des Allgemeinen Verwaltungsrechts, des Beamtenrechts und des Prozessrechts. Sie knüpfen den Ausschluss ehrenamtlich tätiger (und gleichgestellter) Personen von der Mitwirkung und Entscheidung in kommunalen Angelegenheiten an bestimmte sachliche Voraussetzungen (II. 1.) und erweitern die Befangenheitsregelungen, indem weitere Personenkreise, denen die Sache einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann, einbezogen werden6 (II. 2.). Damit wird ebenfalls rechtsstaatlichen Anliegen für ein „sauberes” Verfahren (I. 4.) Rechnung getragen, ein allgemeines Neutralitätsgebot wird jedoch gerade nicht statuiert.7 Diese gesetzgeberische Entscheidung ist folgenreich, weil § 18 GemO (ebenso § 14 LKrO) gegenüber §§ 20, 21 LVwVfG einen Anwendungsvorrang genießt.8 Das Absehen von einem allgemeinen Mitwirkungsverbot wegen Besorgnis der Befangenheit aus Gründen eines Neutralitätsverlustes gibt Raum für die Berücksichtigung kommunalpolitischer Rationalitäten, die im Demokratieprinzip ihre Grundlage finden. Dies hat Konsequenzen für das konzeptionelle Verständnis des § 18 GemO (I. 5.) sowie für die Auslegung und Anwendung einzelner seiner Bestimmungen (vgl. etwa II. 1. b aa zu § 18 Abs. 3 Satz 1 GemO).
2. Geltungsbereich des Mitwirkungsverbots
Die nachfolgenden Ausführungen konzentrieren sich auf den in der Praxis relevanten § 18 GemO;9 sie gelten für die Kreisebene sinnentsprechend nach Maßgabe des § 14 LKrO.10 Der Geltungsbereich des Mitwirkungsverbots wegen Befangenheit erstreckt sich auf ehrenamtlich tätige Bürger (§ 18 Abs. 1 GemO). Der ehrenamtlichen Tätigkeit ordnet § 15 Abs. 1 GemO die Wahl in den Gemeinderat oder Ortschaftsrat sowie das gemeindliche Ehrenamt und die Bestellung zu ehrenamtlicher Mitwirkung zu. Von Interesse sind in erster Linie die Gremientätigkeiten. Zur Rechtsstellung der Mitglieder des Gemeinderates bekräftigt § 32 Abs. 1 Satz 1 GemO, dass diese „ehrenamtlich tätig” sind. Entsprechendes gilt für die Mitglieder des Ortschaftsrates nach § 72 GemO. Für den Bürgermeister und die Beigeordneten verweist § 52 GemO auf die Geltung des § 18 GemO. Für Ortsvorsteher gilt die Verweisungsvorschrift des § 72 GemO.
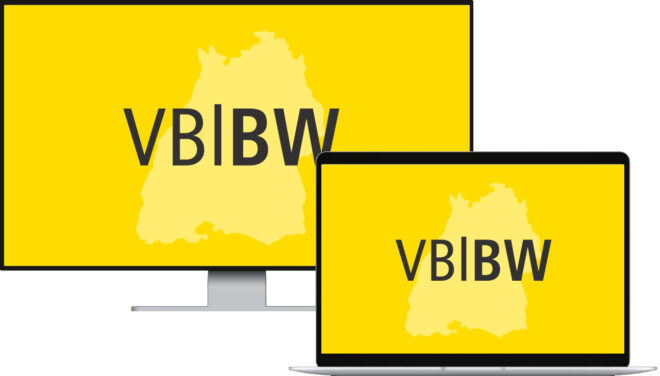 Damit unterliegen die wesentlichen kommunalen Gremien und Funktionsträger dem Mitwirkungsverbot wegen Befangenheit. Sofern der Gemeinderat sachkundige Einwohner in einen Ausschuss beruft, sind auch sie „ehrenamtlich tätig”11 und werden folglich von § 18 GemO erfasst. Umstritten ist die Geltung des kommunalrechtlichen Mitwirkungsverbots wegen Befangenheit für Fraktionen, zu denen sich Gemeinderatsmitglieder zusammenschließen können (§ 32 a Abs. 1 Satz 1 GemO). Die Fragestellung erhält ihre Brisanz dadurch, dass Fraktionen bei der Willensbildung und Entscheidungsfindung des Gemeinderates mitwirken und ihre Auffassungen öffentlich darstellen dürfen (§ 32 a Abs. 2 Satz 1 und 2 GemO). Wird darin mit Blick auf die Beratung und Entscheidung im Gemeinderat eine „Voreingenommenheit” gesehen, kann der Ausschluss wegen Befangenheit auf Fraktionen bezogen werden.12 Das BVerwG hat indessen am Beispiel des ordnungsgemäßen Zustandekommens einer Satzung – aus bundesrechtlicher Sicht – betont, die Beteiligung von nicht stimmberechtigten Stadträten an der Fraktionsarbeit sei durch das „freie Mandat”13 geschützt, Fraktionsbeschlüsse hätten rechtlich nur den Charakter unverbindlicher Empfehlungen, sodass es für die Gültigkeit der Satzung auf die fehlerfreie abschließende Ratsentscheidung ankomme.14 Überträgt man diese im Demokratieprinzip auf kommunaler Ebene verankerte ratio auf die Befangenheitsthematik, findet § 18 GemO auf die Beratung und Beschlussfassung in Ratsfraktionen keine Anwendung.15 Gestützt wird diese Beurteilung durch § 18 Abs. 2 Nr. 4 GemO (dazu II. 2. b).
Damit unterliegen die wesentlichen kommunalen Gremien und Funktionsträger dem Mitwirkungsverbot wegen Befangenheit. Sofern der Gemeinderat sachkundige Einwohner in einen Ausschuss beruft, sind auch sie „ehrenamtlich tätig”11 und werden folglich von § 18 GemO erfasst. Umstritten ist die Geltung des kommunalrechtlichen Mitwirkungsverbots wegen Befangenheit für Fraktionen, zu denen sich Gemeinderatsmitglieder zusammenschließen können (§ 32 a Abs. 1 Satz 1 GemO). Die Fragestellung erhält ihre Brisanz dadurch, dass Fraktionen bei der Willensbildung und Entscheidungsfindung des Gemeinderates mitwirken und ihre Auffassungen öffentlich darstellen dürfen (§ 32 a Abs. 2 Satz 1 und 2 GemO). Wird darin mit Blick auf die Beratung und Entscheidung im Gemeinderat eine „Voreingenommenheit” gesehen, kann der Ausschluss wegen Befangenheit auf Fraktionen bezogen werden.12 Das BVerwG hat indessen am Beispiel des ordnungsgemäßen Zustandekommens einer Satzung – aus bundesrechtlicher Sicht – betont, die Beteiligung von nicht stimmberechtigten Stadträten an der Fraktionsarbeit sei durch das „freie Mandat”13 geschützt, Fraktionsbeschlüsse hätten rechtlich nur den Charakter unverbindlicher Empfehlungen, sodass es für die Gültigkeit der Satzung auf die fehlerfreie abschließende Ratsentscheidung ankomme.14 Überträgt man diese im Demokratieprinzip auf kommunaler Ebene verankerte ratio auf die Befangenheitsthematik, findet § 18 GemO auf die Beratung und Beschlussfassung in Ratsfraktionen keine Anwendung.15 Gestützt wird diese Beurteilung durch § 18 Abs. 2 Nr. 4 GemO (dazu II. 2. b).
3. Systematik des § 18 GemO
Die innere Systematik des § 18 GemO weist eine Art „Doppelstrategie” auf. Die Mehrzahl der Befangenheitstatbestände stellt auf einen potenziellen personellen Interessenwiderstreit ab (§ 18 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 bis 3 GemO), hinzu tritt die sachliche Befangenheit des ehrenamtlich tätigen Bürgers (§ 18 Abs. 2 Nr. 4 GemO).16 Die erste Variante erfasst zunächst den betreffenden Bürger selbst, einbezogen werden sodann potenzielle Vorteile oder Nachteile aus der Entscheidung einer Angelegenheit für persönlich oder rechtlich nahestehende Personen (Abs. 1 Nr. 1 bis 4) sowie für beruflich bzw. ökonomisch mit dem ehrenamtlich Tätigen verbundene Einrichtungen und Institutionen (Abs. 2 Nr. 1 bis 3). Demgegenüber stellen sich Fragen zu „Vorteil oder Nachteil” im Falle des § 18 Abs. 2 Nr. 4 GemO nicht (dazu unter II. 2. b.).
Die über den ehrenamtlich tätigen Bürger hinausreichenden Personen und Institutionen, die wegen möglicher Vorteile oder Nachteile einer Entscheidung für relevant i. S. d. Befangenheit erachtet werden, listet das Gesetz enumerativ auf. Damit trifft § 18 GemO eine abschließende Regelung.17 Soweit in personeller Hinsicht die Frage der „Gerechtigkeit” aufgeworfen wird, weil die (womöglich unbekannte) Tante erfasst werde,18 nicht jedoch der frühere Ehepartner oder der (verfeindete) Nachbar oder der (enge) Freund,19 werden rechtspolitische Überlegungen angestellt. Das geltende Recht ist mit seinen abschließenden Festlegungen verbindlich.
4. Funktion des Mitwirkungsverbots
Der ehrenamtlich tätige Bürger steht zu seiner Gemeinde in einem besonderen Treueverhältnis. Er muss die ihm übertragenen Geschäfte uneigennützig und verantwortungsbewusst führen (§ 17 Abs. 1 GemO). Gemeinderäte entscheiden nach ihrer freien, nur durch das öffentliche Wohl bestimmten Überzeugung (§ 32 Abs. 3 Satz 1 GemO). Die Treuepflichten gelten ebenso für den Bürgermeister und die Beigeordneten (§ 52 GemO). Daraus resultiert die Pflicht kommunaler Amts- und Mandatsträger, die Interessen der Gemeinde zu vertreten (Gemeinwohlorientierung).20
Berührt eine gemeindliche Angelegenheit (z. B. Bauleitplanung) private Interessen des ehrenamtlich tätigen Bürgers (z. B. Grundeigentum im Plangebiet), tritt eine Interessenkollision ein. Eine Entscheidung in dieser Angelegenheit kann dem betreffenden Bürger Vorteile oder Nachteile bringen. Seine privaten Interessen (Streben nach Vorteilen, Abwendung von Nachteilen) und die ihm als Funktionsträger auferlegte Pflicht zur Vertretung gemeindlicher Interessen geraten miteinander in Konflikt. Die Vermeidung eines Interessenwiderstreits ist die Kernfunktion des § 18 GemO.21 Vermieden wird die Interessenkollision dadurch, dass der befangene ehrenamtlich tätige Bürger nach der gesetzlichen Rechtsfolgeanordnung von der Beratung und Entscheidung ausgeschlossen wird (II. 3.).
Dadurch werden – gleichsam als willkommene Nebeneffekte – die Sauberkeit der Kommunalverwaltung gewahrt22 und zugleich das Vertrauen der Bürger in eine am Wohl der Allgemeinheit orientierte unvoreingenommene Kommunalverwaltung gestärkt.23 Das ändert jedoch nichts daran, dass § 18 GemO primär als Interessenkollisionsnorm fungiert. Nicht zutreffend ist die These des VGH, § 18 GemO diene „der Unparteilichkeit der Amtsführung der Gemeindeorgane”.24 Gemeindliche Funktionsträger müssen nach geltendem Kommunalrecht gerade nicht unparteiisch sein (I. 1.), sondern können im kommunal(intern)en Willensbildungsprozess als demokratisch legitimierte Amts- und Mandatsträger durchaus „Partei ergreifen”. Die für das kommunalrechtliche Mitwirkungsverbot wegen Befangenheit relevante Kategorie ist nach dem Gesetz, den potenziellen Interessenwiderstreit reflektierend, das Begriffspaar „Vorteil oder Nachteil”, nicht jedoch „Unparteilichkeit” oder „Neutralität”.25
5. Gesetzlicher Ausgleich widerstreitender Interessen
§ 18 GemO ist rechtsstaatlich abgesichert (I. 1.), aber nicht einseitig auf das Rechtsstaatsprinzip fixiert. Der verfassungsrechtliche Kontext ruft, wie am Beispiel der Mitglieder des Gemeinderates deutlich wird, das Demokratieprinzip in Erinnerung. Die Mitglieder der kommunalen Vertretungskörperschaft sind aus allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen hervorgegangen (Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG, Art. 72 Abs. 1 Satz 1 LV BW) und gesetzlich durch das „freie Mandat” geschützt (§ 32 Abs. 3 GemO). Der Ausschluss von der Beratung und Entscheidung einer Angelegenheit bewirkt eine Beschneidung des Rechts auf ehrenamtliche Tätigkeit demokratisch legitimierter Mandatsträger.26 Die Anwendung des § 18 GemO kann zu einer Veränderung der durch Wahlen begründeten politischen Mehrheitsverhältnisse im Gemeinderat führen, sodass auf diese Weise der Wählerwille verkehrt wird.27 Das Gemeinderecht trifft sogar für außergewöhnliche Konstellationen Vorsorge. Bei Befangenheit von mehr als der Hälfte aller Mitglieder des Gemeinderates (z. B. in Angelegenheiten der Bauleitplanung) ist das Gremium beschlussfähig, wenn mindestens ein Viertel aller Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist (§ 37 Abs. 2 Satz 2 GemO). Im Extremfall ist der Gemeinderat bei mindestens drei anwesenden und stimmberechtigten Mitgliedern beschlussfähig (§ 37 Abs. 3 Satz 1 GemO). Darin kann eine gesetzgeberische Entscheidung zugunsten der Durchsetzung rechtsstaatlicher Standards gesehen werden, die die Einschränkung demokratischer Repräsentation in der Vertretungskörperschaft rechtfertigt.28
Mit Blick auf das Demokratieprinzip darf das Recht eines Gemeinderatsmitglieds auf Ausübung seiner ehrenamtlichen Tätigkeit in der Vertretungskörperschaft allerdings „nur im notwendigen Umfang eingeschränkt werden”.29 Bewähren muss sich diese Maxime bei der Auslegung und Anwendung des § 18 GemO. Auf der Normgeltungsebene steht das kommunalrechtliche Mitwirkungsverbot wegen Befangenheit in einem verfassungsrechtlich angelegten Spannungsverhältnis zwischen Rechtsstaatsprinzip und Demokratieprinzip: Vermeidung von Interessenkollisionen bei der Wahrnehmung kommunaler Angelegenheiten versus Recht auf Mandatsausübung durch einen ehrenamtlich tätigen Bürger.30 Mit seinen (zum Teil recht detaillierten) Einzelregelungen zielt § 18 GemO auf einen Ausgleich zwischen konfligierenden öffentlichen und privaten Interessen.31 Es handelt sich um das Ergebnis einer Güterabwägung: Austarierung von Rechten (§ 32 Abs. 3 GemO) und Pflichten (§ 17 Abs. 1 GemO) ehrenamtlich tätiger Bürger, um sowohl dem Demokratieprinzip als auch dem Rechtsstaatsprinzip sachangemessen Rechnung tragen zu können.32 Dies hat der Norminterpret stets zu bedenken.
II. Voraussetzungen und Folgen des Mitwirkungsverbots wegen Befangenheit
1. Sachliche Voraussetzungen einer Befangenheit
§ 18 GemO gilt im Ländervergleich als Vorschrift mit einem weiten Anwendungsbereich,33 sodass eine restriktive Auslegung geboten sei.34 Dieses Postulat taugt als Auslegungsmaxime nur bedingt. Im Vordergrund der Gesetzesinterpretation steht das an den zu lösenden Sachproblemen ausgerichtete Verständnis des § 18 GemO, das den verfassungsrechtlichen Kontext der Vorschrift (I. 5.) zu beachten hat (verfassungskonforme Auslegung). In diesem größeren Zusammenhang stellt sich die Frage nach einer engen oder weiten Auslegung bei jedem Gesetzesmerkmal neu.35
a) Unmittelbarer Vorteil oder Nachteil in einer Angelegenheit
§ 18 Abs. 1 GemO stellt die „Grundnorm” zu den materiellen Anforderungen an den Ausschluss wegen Befangenheit dar. Vorausgesetzt wird, dass (aa) die Entscheidung einer Angelegenheit (bb) dem ehrenamtlich tätigen Bürger bzw. gesetzlich benannten Dritten einen Vorteil oder Nachteil bringen kann, der (cc) unmittelbar durch die Entscheidung bewirkt wird.
aa) Entscheidung einer „Angelegenheit”
Der Begriff „Angelegenheit” ist denkbar weit gefasst36 und meint – wie in § 18 Abs. 2 Nr. 4 GemO – den Verfahrensgegenstand, über den beraten und entschieden wird.37 Eine signifikante Eingrenzung möglicher Befangenheit bietet das Merkmal „Angelegenheit” nicht.
bb) Vorteil oder Nachteil
„Vorteil” umfasst jede Besserstellung (Vergünstigung, Verbesserung) der Situation der betreffenden Person (ggf. Institution), „Nachteil” jede Schlechterstellung.38 Die Art des Vorteils oder Nachteils ist unerheblich; er kann rechtlicher, wirtschaftlicher, sozialer, ideeller oder sonstiger Natur sein.39 Damit erfasst § 18 Abs. 1 GemO die individualisierbare Besser- oder Schlechterstellung, sei sie materieller oder immaterieller Art.40 Demnach geht auch von dieser Tatbestandsvoraussetzung kaum eine limitierende Wirkung aus.
Rechtliche oder wirtschaftliche Vorteile oder Nachteile lassen sich in der Regel gut fassen.41 Als schwierig kann sich die tragfähige Benennung einer ideellen Verbesserung oder Verschlechterung der Lage des Betroffenen als Befangenheitsgrund erweisen. Das zeigen Beispiele aus der Praxis. So ist der (behauptete) Ansehensverlust eines Oberbürgermeisters anlässlich der Entscheidung in einer nicht unumstrittenen Bauleitplanung zu einer bestimmten Wohnbebauung verneint worden.42 Dagegen wurde im Verfahren zur Umbenennung einer nach dem früheren Oberbürgermeister benannten Straße (wegen dessen NS-Vergangenheit) eine Beeinträchtigung der Ehre jenes (mittlerweile verstorbenen) Oberbürgermeisters gesehen, sodass dessen Sohn als Ratsmitglied in der Angelegenheit befangen sei.43 Die Beispiele verdeutlichen, wie sehr die Beurteilung eines zu erwartenden Vorteils oder Nachteils in einer konfliktträchtigen Angelegenheit durch die Umstände des konkreten Falles geprägt wird.
cc) Unmittelbarkeit des Vorteils oder Nachteils
Die „Unmittelbarkeit” des Vorteils oder Nachteils i. S. d. § 18 Abs. 1 GemO fungiert wegen der inhaltlichen Weite der anderen Tatbestandsvoraussetzungen als Regulativ zur Sicherung der Funktionsfähigkeit kommunaler Gremien und zur Wahrung der demokratischen Mitwirkungsrechte der Amts- und Mandatsträger.44 Zugleich leistet die gesetzlich geforderte „Unmittelbarkeit” einen Beitrag zur Abgrenzung persönlicher Interessen des ehrenamtlich tätigen Bürgers von – nicht zur Befangenheit führenden – Allgemeininteressen und Gruppeninteressen45 (dazu II 1. b). Im Tatbestand des § 18 Abs 1 GemO ist das Merkmal „unmittelbar” das entscheidende Element zur Steuerung der Balance zwischen rechtsstaatlich geforderter Funktionserfüllung der Befangenheitsregelung und Wahrung demokratisch legitimierter Teilhabe der Amts- und Mandatsträger an den Beratungs- und Entscheidungsprozessen der Gemeindepolitik.
Im baden-württembergischen Kommunalrecht wird „unmittelbar” i. S d. § 18 Abs. 1 GemO nicht als unmittelbare Kausalität verstanden,46 die schon dann zu verneinen wäre, wenn der Vorteil oder Nachteil erst durch das Hinzutreten weiterer Umstände (Maßnahmen, Entscheidungen) einträte,47 z. B. durch die Ausführung eines Gemeinderatsbeschlusses durch den Bürgermeister (§ 43 Abs. 1 GemO). Ein unmittelbarer Vorteil oder Nachteil liegt nach hiesigem Verständnis vor, wenn ein – eigenes oder fremdes – individuelles Sonderinteresse an der betreffenden Angelegenheit besteht, das zu einer Interessenkollision führen kann und die Besorgnis begründet, dass der ehrenamtlich tätige Bürger nicht mehr uneigennützig und nur zum Wohle der Gemeinde handelt.48 Dazu genügt, wie das Merkmal „kann” in § 18 Abs. 1 GemO verdeutlicht, die Möglichkeit einer Interessenkollision; schon der „böse Schein” eines Interessenwiderstreits ist zu vermeiden.49 Diese Judikatur des VGH findet Zustimmung im Schrifttum50 und Gefolgschaft in der OVG-Rechtsprechung zum Gemeinderecht anderer Länder.51
Zur Rechtsfindung im Streitfall legt der VGH offen, dass das individuelle Sonderinteresse aufgrund einer wertenden Betrachtungsweise der Verhältnisse des Einzelfalls ermittelt wird.52 In einem dreistufigen Prüfungsprogramm geht der VGH davon aus, dass (1.) jeder individualisierbare materielle oder immaterielle Vor- oder Nachteil zu einer Interessenkollision führen kann, dass es (2.) nicht darauf ankommt, ob die Interessenkollision tatsächlich besteht, und dass (3.) der Eintritt des Vor- oder Nachteils aufgrund der Entscheidung einer Angelegenheit konkret möglich (d. h. hinreichend wahrscheinlich und nicht etwa fernliegend) ist.53 Ergänzend wird mitunter erklärt, das Sonderinteresse dürfe nicht von derart untergeordneter Bedeutung sein, dass es vernachlässigt werden könne.54
Als juristische Herausforderung erweist sich die Individualisierbarkeit des Vor- oder Nachteils. Seit geraumer Zeit operiert der VGH mit der Formel, die Entscheidung in einer bestimmten Angelegenheit müsse so eng mit den persönlichen Interessen des ehrenamtlich Tätigen (bzw. der Bezugsperson) zusammenhängen, dass sie sich auf diesen „zuspitze” und er – da im Mittelpunkt oder jedenfalls im Vordergrund der Entscheidung stehend – als deren „Adressat” anzusehen sei.55 Diese These ist missverständlich. Nicht richtig wäre die Schlussfolgerung, ein Gemeinderatsmitglied sei nur dann befangen, wenn ausschließlich dieser Mandatsträger von der Entscheidung betroffen wird; nach der ratio des § 18 GemO (I. 4.) muss es genügen, dass das Mitglied des Gremiums mit (wenigen) anderen (in gleicher Weise) betroffen ist und sich sein Interesse vom allgemeinen Interesse oder von Gruppeninteressen abhebt.56 In seiner jüngeren Judikatur akzentuiert der VGH diese Einsicht und betont ebenfalls, maßgeblich für eine Befangenheit sei, dass sich das persönliche Interesse des betreffenden Gemeinderatsmitglieds deutlich vom Allgemeininteresse oder von Gruppeninteressen abhebe.57
Den vollständigen Beitrag lesen Sie in Verwaltungsblätter Baden-Württemberg 10/2024, S. 397.


