Parlamentspräsidenten als neutrale oder als politische Instanz?
Verfassungsrechtliche Konflikte um die Amtsführung der Landtagspräsidentin in Bayern
Parlamentspräsidenten als neutrale oder als politische Instanz?
Verfassungsrechtliche Konflikte um die Amtsführung der Landtagspräsidentin in Bayern
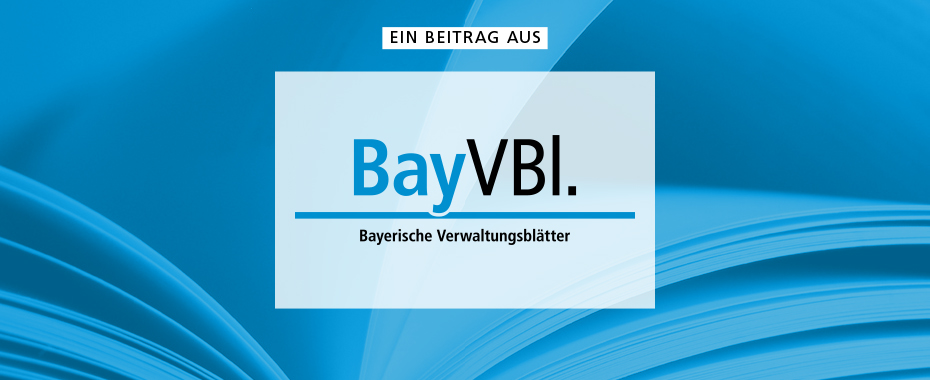
Für den Bayerischen Verfassungsgerichtshof (VerfGH) sind Organstreitigkeiten nichts Außergewöhnliches. Er hatte in allen bisherigen Legislaturperioden verfassungsrechtliche Konflikte zwischen Staatsregierung und Opposition oder zwischen der Mehrheit und der Minderheit des Bayerischen Landtags zu entscheiden. In jüngster Zeit, genauer gesagt seit dem Corona-Jahr 2020, gibt es hier allerdings ein Novum: Antragsgegner war seither in einer Reihe von Fällen nicht mehr die Staatsregierung oder der Bayerische Landtag, sondern erstmals allein und unmittelbar dessen Präsidentin.
In den mittlerweile elf vom VerfGH entschiedenen Verfahren1 ging es jeweils um die Frage, ob die Landtagspräsidentin – also ein gemäß Art. 64 BV „in der Verfassung mit eigenen Rechten ausgestatteter Teil eines obersten Staatsorgans” – durch ein bestimmtes Verhalten ihre amtlichen Befugnisse überschritten und dadurch verfassungsmäßige Rechte der antragstellenden Abgeordneten beziehungsweise Fraktionen verletzt hatte. Im Kern wurde ihr dabei stets vorgeworfen, als verlängerter Arm beziehungsweise Sprachrohr der Landtagsmehrheit zu agieren.
I. Die mögliche Politizität des Amtes
Im Hintergrund solcher Streitigkeiten steht zumeist ein (vermuteter oder tatsächlicher) Rollenkonflikt. Wenn Parlamentspräsidenten ihre exekutivischen Befugnisse ausüben, handeln sie nicht als gewählte Mandatsträger einer bestimmten Partei, sondern in ihrer davon unabhängigen Funktion als Unterorgan des Parlaments. Sie sind zur unparteiischen Amtsführung und zur formalen Gleichbehandlung aller Abgeordneten und Fraktionen verpflichtet, sollen aber zugleich den parlamentarischen Betrieb möglichst wirksam vor Störungen aller Art schützen. Daraus können sich, wie auch ein Blick auf andere Landesparlamente und auf den Deutschen Bundestag zeigt, zahlreiche bisher ungeklärte Verfassungsfragen ergeben, an die man in politisch ruhigeren Zeiten kaum gedacht haben dürfte. Um nur einige aktuelle Beispiele zu nennen:
- – Darf Besuchern von Abgeordneten der Zutritt zu den Parlamentsräumen verwehrt werden, wenn sie extremistischen Organisationen angehören oder wenn befürchtet wird, sie könnten dort strafbare Handlungen begehen2?
- – Darf einzelnen Mitarbeitern von Abgeordneten der Zugang zu bestimmten Räumen des Landtags und zu vertraulichen Informationen vorenthalten werden3?
- – Darf den Abgeordneten beziehungsweise Fraktionen verboten werden, die ihnen überlassenen Räume im Landtag für Publicity-Zwecke zu nutzen, etwa zu Filmaufnahmen oder Videoübertragungen4?
- – Darf die Nutzung der Außenfassade des Parlamentsgebäudes als Mittel der politischen Meinungskundgabe untersagt werden, also zum Beispiel das Anbringen von Plakaten an den Fensterflächen der Abgeordnetenbüros oder das nächtliche Anstrahlen mit Parolen5?
- – Und ganz aktuell: Darf den Mandatsträgern verboten werden, auf dem gesamten Gelände des Landtags oder des Bundestags, also auch unter freiem Himmel, Cannabis zu konsumieren6?
In allen diesen Fällen ist zunächst zu klären, ob der jeweilige Parlamentspräsident für derartige Entscheidungen überhaupt zuständig ist oder ob hier etwa ein Plenarvorbehalt besteht. Wichtiger als diese Kompetenzfrage erscheint aber die Frage, wo im Hinblick auf die Mandatsrechte der Abgeordneten die verfassungsrechtlichen Grenzen verlaufen bei dem Versuch, die Funktionsfähigkeit des Parlaments und seine Würde als Verfassungsorgan vor möglichen Beeinträchtigungen zu bewahren. Konkret gefragt: Muss die Präsidentin des Bayerischen Landtags, soweit sie in dieser Funktion und nicht als einfache Abgeordnete auftritt, sich immer gänzlich neutral verhalten oder darf sie in ihrer Amtsführung auch eigene politische Bewertungen vornehmen, die zumindest Teilen des Parlaments zuwiderlaufen (können)?
Zu diskutieren ist also die diesem Präsidentenamt möglicherweise innewohnende „Politizität”, ein jedenfalls für Juristen ungewohnter Begriff, der auch weder in den gängigen Wörterbüchern noch in Wikipedia näher erläutert wird. Laut juris und beck online war von Politizität bisher auch noch in keiner einzigen Gerichtsentscheidung die Rede; selbst in staatsrechtlichen Aufsätzen und Kommentaren taucht der Begriff erst seit 2015 regelmäßig auf, wobei diese wenigen Treffer weit überwiegend auf einen einzigen Autor zurückgehen7, der ihn übrigens gelegentlich mit dem ebenso sperrigen Komplementärbegriff der Demokratizität kombiniert8. Nach hiesigem Verständnis ist mit Politizität gemeint, dass die Entscheidungen eines staatlichen Akteurs (zumindest vorrangig) nach politischen Maßstäben und nicht nach rechtlichen und damit politisch neutralen Maßstäben getroffen werden können9.
II. Drei Leitentscheidungen des VerfGH
Der VerfGH hat sich zur möglichen Politizität des Amtes der Landtagspräsidentin zwar bisher nicht ausdrücklich geäußert. Zumindest drei seiner Entscheidungen in den genannten Organstreitverfahren lassen aber deutliche Rückschlüsse zu, welchen politischen Entscheidungsspielraum er der Präsidentin des Landtags im Rahmen ihrer Amtsführung zugesteht.
Antragsteller waren in allen drei Fällen die AfD-Landtagsfraktion beziehungsweise einzelne ihrer Abgeordneten. In diesen Verfahren, die hier näher erläutert werden sollen, wurde um höchst unterschiedliche Sachverhalte gestritten, nämlich um von der Landtagspräsidentin angeordnete Infektionsschutzmaßnahmen, um AfD-kritische öffentliche Äußerungen der Präsidentin und um die – bereits von ihrer Vorgängerin begründete – Mitgliedschaft des Bayerischen Landtags in einem zivilgesellschaftlich geprägten „Bündnis für Toleranz”.
1. Die hausrechtlichen Befugnisse der Landtagspräsidentin
In einer am 25. Oktober 2023 erlassenen Hauptsacheentscheidung10 musste sich der VerfGH erstmals mit der Reichweite der hausrechtlichen Befugnisse der Landtagspräsidentin befassen. Gegenstand des Verfahrens war ein als „Anordnungen und Dienstanweisung” bezeichnetes Bündel von Corona-Schutzmaßnahmen vom 3. Juli 202011. Darin hatte die Präsidentin unter Verweis auf das ihr in der Verfassung zugewiesene Hausrecht einige befristete Regelungen über verschärfte Besucherkontrollen beim Zugang zum Maximilianeum sowie über die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und zur Einhaltung eines Mindestabstands auch in den Sitzungssälen und Besprechungsräumen getroffen.
Gegen diese Anordnungen wandten sich die AfD-Fraktion und einer ihrer Abgeordneten in einem Organstreitverfahren und beriefen sich auf eine Verletzung ihrer verfassungsmäßigen Rechte aus dem freien Mandat – Art. 13 Abs. 2 BV – und aus der Stellung als parlamentarische Opposition – Art. 16a Abs. 2 BV. Sie machten geltend, durch die Beschränkung des Zugangs von Besuchern zum Landtagsgebäude werde die verfassungsrechtlich geschützte Kommunikationsbeziehung der Abgeordneten zu den Bürgern beeinträchtigt. Die angeordnete Maskenpflicht sei angesichts gesunkener Infektionszahlen überzogen. Es bestünden wissenschaftlich begründete Zweifel am Sinn einer Mund-Nasen-Bedeckung; die Landtagspräsidentin dürfe die Risikobewertungen des Robert Koch-Instituts nicht unkritisch übernehmen. Die AfD-Abgeordneten hätten auch das Recht, durch eine – so wörtlich – „Verweigerung des Maskenirrsinns” auf sichtbare Weise ihre regierungskritische Haltung im Parlament zum Ausdruck zu bringen. Nur durch ein förmliches Gesetz dürften die verfassungsmäßigen Rechte der Opposition eingeschränkt werden. In der Einführung der Maskenpflicht liege ein politischer Machtmissbrauch der Landtagspräsidentin als Vertreterin der größten Regierungspartei12.
Der mit dieser Begründung beim VerfGH gestellte Antrag auf Feststellung eines Verfassungsverstoßes hatte keinen Erfolg; er bot aber Gelegenheit zu einigen grundsätzlichen Klarstellungen.
a) Die Zulässigkeit des Antrags im Organstreitverfahren
Im Rahmen der Zulässigkeit war zunächst die Rechtsnatur der hausrechtlichen Maßnahmen zu klären13. Das Gericht gelangte dabei in Anbetracht des heterogenen Adressatenkreises zu einem differenzierenden Ergebnis. Soweit sich die Anordnungen nicht an die Abgeordneten, sondern an deren Mitarbeiter und an externe Besucher richteten, handelte es sich um Verwaltungsakte in Form einer Allgemeinverfügung nach Art. 35 Satz 2 BayVwVfG. Darüber hätten also nach § 40 Abs. 1 VwGO mangels einer verfassungsrechtlichen Streitigkeit anstelle des Verfassungsgerichtshofs zunächst die Verwaltungsgerichte zu entscheiden gehabt14. Im Verhältnis zu den Abgeordneten und Fraktionen hatte die Landtagspräsidentin dagegen Maßnahmen getroffen, die sich auf die Mandats- und Oppositionsrechte auswirkten und die daher – jedenfalls nach herrschender und auch vom VerfGH geteilter Auffassung – nur Gegenstand eines Organstreits sein konnten15. Dass damit ein und derselben Rechtsnorm, nämlich der Übertragung des Hausrechts auf die Präsidentin in Art. 21 Abs. 1 BV, eine zur Aufspaltung des Rechtswegs führende Doppelnatur zukommt, kann man gewiss kritisieren16, erscheint aber jedenfalls nicht logisch ausgeschlossen und dürfte auch im praktischen Ergebnis vorzugswürdig sein17.
Als Antragsgegnerin war hier nach Auffassung des VerfGH zu Recht die Landtagspräsidentin benannt worden18. Anders als in früheren Fällen, in denen der Landtagspräsident in seiner – lediglich auf der Geschäftsordnung beruhenden – Funktion als amtierender Sitzungsleiter gehandelt hatte19 und sich der Antrag nach Auffassung des Gerichts daher gegen den Landtag als Ganzes zu richten hatte20, war die Präsidentin in diesem Organstreitverfahren selbst beteiligungsfähig21. Streitgegenstand waren ihre verfassungsunmittelbaren Befugnisse als Inhaberin des Hausrechts nach Art. 21 Abs. 1 BV.
b) Die Betroffenheit in eigenen Mandats- und Fraktionsrechten
Im Rahmen der Begründetheitsprüfung musste der VerfGH zunächst klären, ob die Antragsteller durch die angegriffenen Infektionsschutzmaßnahmen überhaupt in ihren Mandats- und Fraktionsrechten beeinträchtigt waren. Das Gericht ging dabei im Einklang mit der bisherigen Verfassungsrechtsprechung von einem sehr weiten Verständnis der in Art. 13 Abs. 2 und Art. 16a Abs. 2 BV verankerten parlamentarischen Teilhaberechte aus, die sich somit nicht in einem bloßen Rede-, Antrags-, Frage- und Abstimmungsrecht der Abgeordneten erschöpfen22. Hiernach betraf auch die nur für Besucher geltende Zugangsbeschränkung zum Maximilianeum mittelbar die Antragsteller, da sie mit den aus Infektionsschutzgründen abgewiesenen Personen nicht mehr in ihren Abgeordnetenbüros und Fraktionsräumen in direkten Kontakt treten konnten; sie konnten dadurch das ihnen an diesen Räumlichkeiten zustehende mandatsgeschützte Hausrecht nicht mehr uneingeschränkt ausüben.
Für höchst fraglich hielt der VerfGH allerdings die Auffassung der Antragsteller, dass die Gewährleistung des freien Mandats und einer effektiven parlamentarischen Opposition auch das Recht umfasse, durch demonstratives Nichttragen von Schutzmasken eine ablehnende Haltung gegenüber der Regierungspolitik zu bekunden. Solche nonverbalen Meinungskundgaben dürften, so das Gericht23, nicht mehr Teil der mandatsbezogenen Statusrechte sein. Der parlamentarische Willensbildungsprozess solle nach der Vorstellung des Verfassungsgebers durch öffentliche Verhandlung in Form von „Rede und Gegenrede” und nicht durch symbolische Gesten erfolgen. Unabhängig davon lag aber aus Sicht des VerfGH eine unmittelbar mandatsrelevante Beschränkung zumindest in der Verpflichtung der Abgeordneten, in den Sitzungssälen und den sonstigen Räumen des Landtags eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und einen bestimmten Mindestabstand einzuhalten. Denn dadurch wurde ihr Recht auf persönliche Anwesenheit im Plenum und in den Ausschüssen an die Erfüllung bestimmter Verhaltensanforderungen geknüpft24.
c) Die verfassungsimmanenten Schranken der Mandats- und Fraktionsrechte
Den Kern des Verfahrens bildete danach die Frage, ob und inwieweit die Landtagspräsidentin in Ausübung ihres Hausrechts in dieser Weise auf die verfassungsrechtlich geschützte Rechtsstellung der gewählten Volksvertreter reglementierend einwirken durfte. Unmittelbar in der Verfassung finden sich dazu keine Antworten. Es ist aber allgemein anerkannt, dass das freie Mandat der Abgeordneten und die damit korrespondierenden Fraktionsrechte nicht schrankenlos gewährleistet sind, sondern durch andere Rechtsgüter von Verfassungsrang begrenzt werden können, zu denen auch die Funktionsfähigkeit und die Repräsentationsfähigkeit, also die „Würde” des Parlaments gehören. Dem Schutz der Funktionsfähigkeit des Bayerischen Landtags dient auch das der Präsidentin in Art. 21 Abs. 1 BV zugewiesene Hausrecht, das die ungestörte Erfüllung der parlamentarischen Aufgaben sichern soll. Auf dieses Hausrecht lassen sich nach Auffassung des VerfGH25 nicht nur Entscheidungen über den Zutritt zum Landtag stützen, sondern ebenso Verhaltensregeln für den Aufenthalt in den Räumen des Parlaments, wobei die entsprechenden hausrechtlichen Anordnungsbefugnisse nach vorherrschender Auffassung grundsätzlich auch gegenüber den Abgeordneten bestehen. Da das Hausrecht eine der Landtagspräsidentin verfassungsunmittelbar zugewiesene Kompetenz darstellt, gilt für die betreffenden Maßnahmen im Übrigen weder das Erfordernis einer formell-gesetzlichen Grundlage noch ein sonstiger Parlaments- oder Plenarvorbehalt26.
d) Das Verhältnis des Hausrechts zur Geschäftsordnungsautonomie
An dieser Stelle seiner Entscheidungsgründe musste der VerfGH auf ein erst seit der Corona-Pandemie diskutiertes und nicht ganz einfaches Abgrenzungsproblem eingehen, zu dem es bis dahin noch keinerlei Rechtsprechung und auch nur sehr wenige Literaturstimmen gab. Wenn die Landtagspräsidentin in Ausübung ihres Hausrechts den Abgeordneten bestimmte Verhaltenspflichten auch für die Zeit der Sitzungen auferlegt, können sich naturgemäß Überschneidungen mit dem Selbstorganisationsrecht27 des Parlaments in Gestalt seiner Geschäftsordnungsautonomie nach Art. 20 Abs. 3 BV ergeben28. Nach dieser Vorschrift ist der Bayerische Landtag befugt, seine interne Organisation und seinen Geschäftsgang eigenständig zu regeln und im Wege der Geschäftsordnung insbesondere auch für die Aufrechterhaltung der Ordnung in den Sitzungen zu sorgen. In der damaligen Pandemielage wäre es dem Landtag demnach jederzeit möglich gewesen, für seinen Sitzungsbetrieb durch einfachen Plenarbeschluss eine Maskenpflicht und einen Mindestabstand einzuführen oder sonstige Schutzmaßnahmen zu treffen. Hätte er von diesen speziell sitzungsbezogenen Regelungsbefugnissen Gebrauch gemacht, hätte das Hausrecht der Parlamentspräsidentin wohl zurücktreten müssen29.
Ob der Landtagsgeschäftsordnung in einem solchen Kollisionsfall ein Geltungsvorrang oder etwa nur ein Anwendungsvorrang zukommen würde, musste der VerfGH nicht entscheiden. Da entsprechende Geschäftsordnungsregelungen jedenfalls während des maßgebenden Zeitraums nicht existierten, sondern – im Gegenteil – die Mehrheit der Mandatsträger die auf das Hausrecht gestützten Anordnungen vorbehaltlos unterstützte, bestanden aus der Sicht des Gerichts keine Bedenken dagegen, dass die Corona-Schutzmaßnahmen der Landtagspräsidentin auch für den Plenarsaal und für die zu Ausschusssitzungen genutzten Räume Geltung beanspruchten30.
Der VerfGH folgte also nicht einer in Teilen des Schrifttums31 vertretenen rigiden Auffassung, wonach sich aus dem prinzipiellen Vorrang der parlamentarischen Geschäftsordnung eine Sperrwirkung dahingehend ergebe, dass hausrechtliche Anordnungen den Sitzungsbetrieb im Plenum und in den Ausschüssen von vornherein aussparen müssten. Legte man diese Literaturmeinung zugrunde, so wären die von der Landtagspräsidentin getroffenen Maßnahmen kompetenzrechtlich wohl nur zu rechtfertigen gewesen, wenn man entweder ihre (zumindest stillschweigende) Übernahme in die Parlamentsgeschäftsordnung annähme32 oder wenn man die Anordnungen entgegen ihrem Wortlaut auf die der Präsidentin ebenfalls nach Art. 21 Abs. 1 BV zustehende Polizeigewalt im Landtagsgebäude stützen könnte33, wobei allerdings von einer abstrakten Gefahr im polizei- und sicherheitsrechtlichen Sinne wohl noch nicht gesprochen werden konnte.
Den gesamten Beitrag entnehmen Sie unseren BayVBl. Heft 2/2025.


