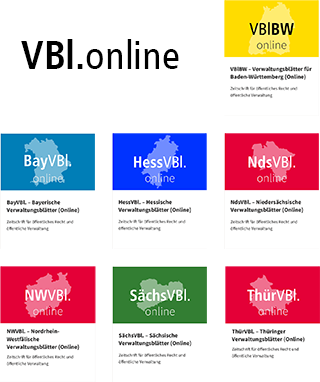Menschenwürde – ein Prinzip des Grundgesetzes und der Versuch, es zu verstehen
Oder: Wie kommt der Mensch (mit Behinderung) zur Menschenwürde?
Menschenwürde – ein Prinzip des Grundgesetzes und der Versuch, es zu verstehen
Oder: Wie kommt der Mensch (mit Behinderung) zur Menschenwürde?
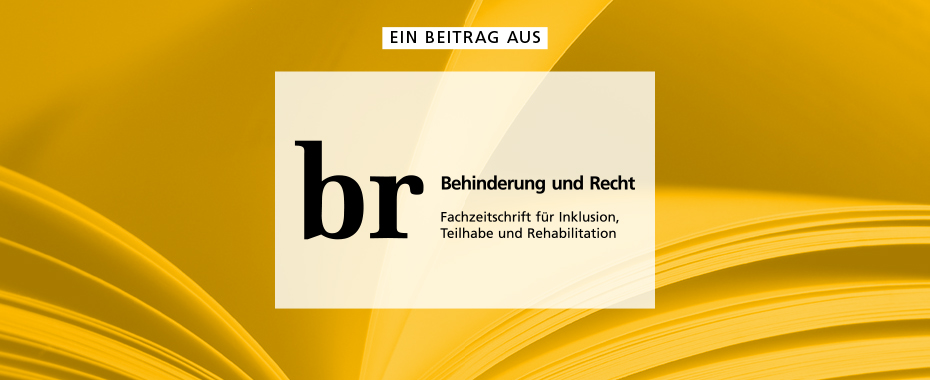
Artikel 1 Abs. 1 des vor 75 Jahren in Kraft getretenen deutschen Grundgesetzes startet mit einer Behauptung: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Mit anderen Worten: Das Grundgesetz setzt eine Behauptung in die Welt in Form einer Gleichung „Der Mensch hat Würde“ („Mensch= Würde“).
Eine Formulierung wie ein Paukenschlag, die manchen Leser dazu bewegt, angesichts der aktuellen Weltlage den Kopf zu wiegen und sich zu fragen, ob dem tatsächlich so ist. Die andererseits seit vielen Jahren immer wieder zu der Frage animiert „Haben Menschen Würde, wenn ja, wo, wie und was soll das sein“ oder gar „Gibt es Menschen ohne Würde? Wann ist Schluss?“.
Was sich im Einzelnen hinter dem Begriff der Würde verbirgt, erläutert das Grundgesetz nicht, und wie der Mensch zur Würde kommt, beantwortet das Grundgesetz ebenso wenig. Wer an Würde denkt, denkt an „würdevoll“ – und damit sind wir mitten in einer anhaltenden Diskussion, in der „provokativ“ oder eher menschenfreundlich gefragt wird, welche Würde muss der Mensch denn mitbringen, um zu Art. 1 Abs. 1 GG „zu passen“? Welchem Bild „würdevoll“ zu sein, muss er denn entsprechen? Das wiederum leitet den Blick zu Menschen, die aufgrund einer schweren Behinderung geistiger oder körperlicher Art oder wegen fortgeschrittenen Alters dem Betrachter nur noch als Schatten ihrer selbst wahrgenommen werden und bei denen sich häufig der Begriff „würdevoll“ kaum aufdrängt.
Historische Ursprünge und zeitlose Debatten
Der seinerzeit aktuelle historische Hintergrund von Art. 1 Abs. 1 GG liegt auf der Hand. Angesichts der Gräueltaten im Dritten Reich und den millionenfachen Misshandlungen und Tötungen unschuldiger Menschen, die der definierten Norm nicht entsprachen, aber auch dem Leid von Kriegsgefangenen und Flüchtlingen, die zum Teil unter unerträglichen Bedingungen leben mussten, sollte ein Zeichen gesetzt werden – ein endgültiges Zeichen.1Nur wenige Monate zuvor einigten sich die Vereinten Nationen auf eine Formulierung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, in der von der „angeborenen Würde … aller Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen“ die Rede ist (so die offizielle deutsche Übersetzung).
Unabhängig von dem historischen Zusammenhang ist und bleibt diese Gleichung seit vielen Jahren Gegenstand zahlreicher kritischer Auseinandersetzungen. Die Feststellung „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ in Art. 1 Abs. 1 Satz 1 GG beschäftigt jegliche akademische Denkrichtung und lädt mit jeweils einer Vielzahl kluger Gedanken zur streitigen Diskussion ein. Nicht nur Juristen widmen sich Überlegungen zum Thema, was Menschenwürde ist. In gleichem Maße gilt das für Soziologen, Psychologen, Philosophen, Historiker, Mediziner, Kulturwissenschaftler und viele mehr. In jedem einzelnen Fall wird versucht, die „Würde“ des Menschen zu erläutern, in einen Begriffs- und vor allem Begründungszusammenhang zu bringen, der ableitet, warum und unter welchen Umständen dem Menschen und nur dem Menschen die Besonderheit der „Würde“ zuzugestehen ist.
Hingewiesen sei hier nur auf einige dieser Erklärungsansätze – etwa auf Kant, der lange vor der Entstehung des Grundgesetzes die Menschenwürde aus der Vernunft des Menschen ableitete und den Einsatz seiner „Talente des Geistes“ einforderte, weil er dazu fähig sei.2Vgl. Kant, Immanuel, Grundlegung der Metaphysik der Sitten, 1785/2016 (Karl-Maria Guth); Kant, Kritik der Urteilskraft, 1790/2016 (Karl-Maria Guth). Gewirth schließt aus der menschlichen Handlungsfähigkeit3Vgl. Gewirth, Alan, 1992 „Human Dignity as the Basis of Rights“, in Meyer, Michael/Parent, Michael (Hrsg.) The Constitution of Rights, S. 10 ff; vgl. auch Steigleder, Klaus, 1999, Grundlegung der normativen Ethik. auf seine Würde, Stoecker betont die dem Menschen jeweils ureigene Individualität,4So Stoecker, Ralf, Theorie und Praxis der Menschenwürde, 2019, http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=4591ab86c8784d50b008f442703b0461&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm. Schaber die Autonomie des Menschen,5Vgl. Schaber, Peter, Menschenwürde, 2012 Durkheim seine besondere Stellung als Teil einer funktionierenden Gesellschaft und den individuell wertschöpfenden Beitrag zu dieser6Vgl. Durkheim, Emile, Über soziale Arbeitsteilung, Studie über die Organisation höherer Gesellschaften, FFM1930/1992, S. 238 ff. – abgeleitet etwa aus seinem Beruf. In ähnliche Richtung führt der Ansatz Luhmanns, die Würde des Menschen mit seiner individuellen Leistung zu begründen.7Vgl. hierzu die Ausführungen von Luhmann, Niklas, Grundrechte als Institution: Ein Beitrag zur politischen Soziologie, Schriften zum öffentlichen Recht, 1965/2009, 5. Aufl.
Auch der Versuch von Metz8Vgl. Metz, Thaddeus, 2013, „The Meaning of Life“, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.standford.edu/entries/life-meaning., Menschenwürde auf den Sinn des Lebens oder zumindest die Möglichkeit zurückzuführen, ein sinnvolles Leben zu leben, das einem Menschen Wertigkeit, Qualität, Bedeutung beimisst, was wiederum seine Würde begründet, sei erwähnt.
Jedem dieser hier nicht abschließend aufgezählten Ansätze folgt eine intensive streitige Auseinandersetzung mit je gegenteiligen Argumenten.9Die hier gewählte Auflistung kann keinesfalls vollständig sein, es sei nur auf Übersichten zu diesen und weiteren Ansätzen hingewiesen etwa bei Kipke, Roland, Die Sinntheorie der Menschenwürde – Auf dem Weg zu einem neuen und integrativen Ansatz, Zeitschrift für Praktische Philosophie Bd. 7, Heft 2, 2020, S. 91-118, vor allem S. 92 ff.; oder bei Lindemann, Gesa, Menschenwürde – Ihre gesellschaftsstrukturellen Bedingungen, https://www.academia.edu/7344514/Menschenwürde_ihre_gesellschaftsstrukturellen_Bedingungen?email_work_card=view-paper. Die Argumente und akademischen Auseinandersetzungen sind sicherlich nicht abgeschlossen. Allein an der Vielzahl solcher Diskussionen zur Frage, was unter Menschenwürde zu verstehen sei, ist erkennbar, dass die positive Definition dessen, was Menschenwürde ist, weder einheitlich gelingen wird noch eine letztlich alle überzeugende Darstellung bisher gefunden wurde.
In seiner 2020 erschienenen Ausführung versucht Roland Kipke10Vgl. Kipke, Roland, Die Sinntheorie der Menschenwürde, Zeitschrift für Praktische Philosophie, Bd. 7, Heft 2, 2020, S. 91 ff, https://www.praktische-philosophie.org//doi.org/10.22613/zfpp/7.2.4. genau diesen Spagat darzustellen und schloss daraus auf die „Sinnlosigkeit“ von Menschenwürde. Zwischen dem kantschen und dem stoeckerschen Ansatz – so seine Überlegungen – lägen Welten, die beim Verständnis dessen, was Menschenwürde denn nun tatsächlich sei, nicht weiterhelfen.
Letztlich bleibt gleichgültig, mit welchen Argumenten Menschenwürde begründet wird und auf welchen Voraussetzungen sie basiert, am Ende stellt sich stets die entscheidende unvermeidliche Frage, ob bei einem Wegfall dieser Voraussetzungen bei einem menschlichen Individuum dieses dann etwa keine Menschenwürde habe und ob das i.S.v. Art. 1 Abs. 1 GG sein kann?
Jeder Maßstab für Menschenwürde schließt Menschen aus, umfasst nicht jeden, lässt Menschen außerhalb der Anerkennung von Menschenwürde stehen. Jeder Versuch, zu argumentieren, geschützt würde etwas, was gemeinhin unter Würde zu verstehen sei, wie etwa Individualität oder Autonomie oder Wertschöpfung, schließt Menschen aus der Gruppe der Innehabenden von Würde aus. Jede Bemühung, „Würde“ und was sie begründen könnte, als eine Voraussetzung für Art. 1 Abs. 1 GG zu definieren, muss daher scheitern. Menschenwürde i.S.v. Art. 1 Abs. 1 GG überhaupt in eine Erklärungsnähe zum Begriff der Würde zu bringen, ist – um einen Begriff von Hauskeller11Vgl. Hauskeller, Michael, https://www.academia.edu/1882884/Unsinn_auf_Stelzen_Menschenwürde_als_säkularer_Glaubensartikel?email_work_card=view-paper/published in eBook Scheidewege 35 (2005/2006) S. 10-21. aufzugreifen – „Unsinn auf Stelzen“.
Dafür sei auf ein einziges „Aber“ hingewiesen, das sich notwendigerweise jedem dieser Versuche, zu erläutern, warum Würde und worauf sie beruht, entgegenstellt. Dieses „Aber“ leitet in Konsequenz all dieser Erklärungsversuche zu der Frage über, was denn gelten soll, wenn der konkrete Mensch aufgrund einer Behinderung oder einer schweren Erkrankung nicht mehr „vernünftig“ handeln kann, keiner körperlichen Handlungsfähigkeit mehr fähig ist, keinen sinnhaften wertschöpfenden Beruf ausübt oder ausüben kann und keinen erkennbaren, messbaren Beitrag für die Gemeinschaft (mehr) leistet. Das „Aber“ stellt sich in den Raum der Diskussion, wenn ein alter Mensch etwa derart von der Hilfe Dritter abhängig ist, dass er keinerlei Autonomie mehr erleben kann, wenn seine Individualität verborgen ist, sodass sie für Außenstehende unerkennbar bleibt wie etwa bei einem Menschen mit fortgeschrittener Demenz oder einem Komapatienten. Wo sollte Würde sein, wenn der konkrete Mensch aufgrund körperlicher oder geistiger Einschränkungen nicht mehr selbstbestimmt leben kann, wenn er keine intellektuelle Freiheit in Anspruch zu nehmen in der Lage ist, weil er unter einer geburtlichen geistigen Einschränkung leidet oder eine fortschreitende Demenz seine geistigen Kapazitäten schleichend begrenzt, wenn seine Sinnbildung im Rahmen der Gemeinschaft aus Altersgründen oder Gründen unfallbedingter mehrfacher Behinderung berechtigte Zweifel aufkommen lässt, seine Individualität sich dem Betrachter kaum erschließt.
Wo ist Menschenwürde bei Menschen mit schwerer geistiger oder sonstiger Behinderung, bei Menschen am Ende ihres Lebens mit stark eingeschränktem Denkvermögen? Wir alle kennen etwa das Eingebundensein alter und kranker Menschen in den Tag-Nacht-Rhythmus eines Alters- und Pflegeheimes, das kaum Eigenleben vorsieht, kein eigenes Zutun als Teil einer Gemeinschaft mehr einfordert, sondern alte Menschen häufig als Objekte in einer Art Warteschleife hält, in der sie bis zu ihrem Tod leben und das einfache Existieren und Sicheinpassen in den Tagesablauf völlig ausreicht. Ähnliches gilt für Menschen mit ihren jeweils verschiedenen Behinderungen: Wäre der Schluss nach der „Aber“-Erwägung, dass ihnen keine Würde zugeteilt werden kann?
Das „Aber“ würde sich bei all den hier beispielhaft aufgezeigten Begründungsversuchen der Würde des Menschen erheben müssen und uns mit einem großen Fragezeichen zurücklassen. Aus juristischer Sicht verbietet es sich daher förmlich, der zuvor auszugsweise angerissenen Diskussion beizutreten. Ein Mehr an Argumenten zugunsten der Gleichung „Mensch= Würde“ trägt nichts zum Thema, zur Zielrichtung des Grundgesetzes bei.
Menschenwürde i.S.v. Art. 1 GG fragt nicht danach, wie „würdevoll“ ein Mensch ist. Sie meint den Menschen ohne Ansehen der Person und ihrer Fähigkeiten, sie meint jeden Einzelnen in gleicher Weise und fordert zur Anwendung der Grundrechte auf ohne Wenn und Aber. Mensch zu sein und eben kein Tisch, kein Stuhl, keine Pflanze und kein Käfer ist für die Anwendung des Grundgesetzes völlig ausreichend. Die Würde des Menschen ist als „nicht interpretierte These“ zu verstehen,12So der damalige FDP-Abgeordnete und spätere erste Bundespräsident Heuß, Theodor im Jahrbuch des öffentlichen Rechts (JöR), zur Entstehungsgeschichte der Artikel des Grundgesetzes, Bd. 1, S. 49 ff. als Grundprinzip13So Dreier, Horst, in: Dreier, Kommentar zum GG, Art 1 Abs. 1, Rdn 27 ff und 121 f. der deutschen Verfassung.
Wir müssen im Angesicht von Art. 1 GG aufhören, die Würde eines jeden Menschen anhand von Kompetenzen, Qualitäten, Fähigkeiten oder Möglichkeiten begründen und suchen zu wollen, die etwa dem Begriff „würdevoll“ zu sein entsprächen. Es muss i.S.v. Art. 1 Abs. 1 GG ausreichen, dass ein Mensch ist.
Überhaupt eine solche Überlegung über die Qualität und Fähigkeit eines Menschen ansatzweise in den Raum zu stellen, entspräche in keiner Weise dem Sinn und der Zielrichtung des Grundgesetzes. Es verbietet sich, intensive Überlegungen anzustellen, ob Menschenwürde etwas mit Würde oder würdevollem Benehmen, mit Bedeutung und Wertschöpfung für die Gemeinschaft oder mit dem Zeigen von besonderer Individualität zu tun hat. Es ist angesichts von Art. 1 Abs. 1 GG förmlich untersagt, sich der Frage zu widmen, ob die Würde des Menschen etwa verloren geht, wenn sich ein Mensch unwürdig verhält, er aktiv darauf verzichtet, als Mensch mit Menschenwürde behandelt zu werden oder er nicht mehr in der Lage ist, für die Gemeinschaft eine messbare positive Rolle zu spielen – was auch immer „unwürdig“ in diesem Zusammenhang bedeuten könnte. Genau darauf kann es angesichts der Zielrichtung des Grundgesetzes nicht ankommen. Menschsein impliziert die Inhaberschaft von Menschenwürde – so statuiert es das Grundgesetz. Es verbietet sich daher – wie Böckenförde in einer wunderbaren Formulierung präzisiert14Vgl. Böckenförde, Ernst-Wolfgang, Recht, Staat, Freiheit, erweiterte Ausgabe, 8. Aufl. 2021, S. 396. –, „Menschenwürde mit kleiner Münze auseinander zu legen“.
Die Menschenwürde im Grundgesetz
Die Mütter und Väter des Grundgesetzes wollten keine Diskussion und Entscheidungsfindung zu Überlegungen anstoßen, welcher Mensch noch Würde habe und welcher sicherlich keine mehr. Sie wollten eine neue staatliche Ordnung statuieren, in der jegliche Erniedrigung und Entwürdigung von Menschen ausgeschlossen sein soll15Vgl. Böckenförde, a.a.O., S. 391.. Die Feststellung „Mensch=Würde“ sollte eine Gleichung mit Folgen statuieren: Jeder, der Mensch ist, ist Träger von Menschenwürde, ohne dass damit eine ihn betreffende Erwartungshaltung oder Leistungsverpflichtung verbunden wäre und ohne jegliche Bewertung seiner menschlichen Fähigkeiten, Talente oder tatsächlichen Wertschöpfung für die Gemeinschaft.
Das Grundgesetz definiert den Zusammenhang „Mensch= Würde“ klar durch die einfache und unerläuterte Gleichung, in der keine Unbekannte vorkommt, die es herauszufinden gilt und die Einschränkungen enthalten würde. Es stellt klar, dass die Menschenwürde ohne Bedingungen daherkommt. „Jeder Mensch hat Würde“ könnte man auch sagen. Keine andere Voraussetzung hat die Anerkennung und der sich daraus ergebende Schutz der Würde, als dass ein Mensch ist.16Im Urteil des Bundesverfassungsgerichts, BVerfGE 87, S. 209/228 wird genau diese Gleichung betont und bestätigt: Bei der Gleichung „Mensch=Würde“ geht es um das Zugestehen eines sozialen Wert- und Achtungsanspruches, weil ein Mensch ein Mensch ist. Menschenwürde endet erst, wenn der Mensch nicht mehr ist.17Auch diese Frage ist allerdings nicht unstreitig, sie soll jedoch hier nicht weiter vertieft werden. So besteht etwa Einigkeit, dass der Schutz der Würde des Verstorbenen über den Tod hinaus zu achten ist und sein Leichnam nicht etwa als Kunst- oder Medizin-Objekt behandelt werden darf. Vgl. dazu nur von Mangoldt/Klein/Starck, a.a.O., Rn. 22 f.
Ein Mensch, der ist, wird mit dem Schutz der sich aus Menschenwürde ergebenden Rechte umgeben. Wie klein oder groß, wie einzigartig genial oder wie unbedeutend und banal sein Leben auch gerade verläuft. Außer der juristischen entspricht die religiöse Betrachtung diesem Ansatz, die bei verschiedenen und nicht nur den christlichen Religionen zu finden ist: Der Mensch wurde als Gottes Ebenbild geschaffen mit der Konsequenz, dass es für die Frage seiner Stellung im Verhältnis zur Menschenwürde keine Rolle spielt, wer er/sie ist oder wer er/sie aufgrund von Behinderung, Krankheit oder altersbedingtem körperlichem und geistigem Abbau nicht (mehr) ist.
Die Frage des Warum einer Anerkennung von Menschenwürde stellt sich aus religiöser Sicht angesichts des Wortlauts des Grundgesetzes jedenfalls nicht. Sie führt ohne Wenn und Aber zur Anwendung der Gleichung bei jedem Menschen. Das gilt in jedem Fall auch, wenn der Mensch aufgrund einer geistigen, körperlichen oder psychischen Behinderung oder aufgrund einer schweren Krankheit oder fortgeschrittenen Alters am Ende des Lebens nicht dem Bild eines Würde tragenden Menschen entspricht. Die Gleichung „Mensch= Würde“ ändert sich dadurch nicht. Sie gilt ohne Einschränkung. Das Grundgesetz führt – so die vielfache Argumentation des Bundesverfassungsgerichts – auf diese Weise eine objektive Werteordnung ein.18Vgl. nur BVerfGE 6, S. 32 und 40. Menschenwürde ist jedem Menschen eigen – ob er will oder nicht, ob andere das so sehen oder nicht. Ohne Frage besteht damit Menschenwürde auch bei Menschen mit Behinderung geistiger, psychischer oder körperlicher Art ebenso uneingeschränkt wie bei Menschen, die aufgrund schwerer Krankheit oder fortgeschrittenen Alters mit Einschränkungen leben müssen und die für ihre Umwelt häufig nur noch als Schatten ihrer selbst, als „Rest“ eines Menschen erlebt werden können. Vor diesem Hintergrund ist es nur logisch, dass in den zwölf Thesen des Deutschen Behindertenrates als These 1 unzweideutig formuliert wird „Die Würde der Menschen mit Behinderung ist unantastbar…“.19Der Paritätische Dachverband, 12 Thesen des Deutschen Behindertenrates, 07.12.2000 erstellte Fachinformation von Joachim Hagelskamp.
Bedeutsam ist für die Anwendung der Gleichung „Mensch= Würde“ vor dem Hintergrund des Grundgesetzes allenfalls, ab wann der Mensch ist und ab wann seine Würde als Mensch zu achten ist. Am Ende des Lebens stellt sich konsequent die Frage, bis wann seine Würde um seiner Existenz willen geschützt wird. Im Rahmen der hier gestellten Frage ist es zulässig, sich auf eine Mindestannahme zu konzentrieren. Die Frage, ab wann spätestens ein Mensch ist, kann damit beantwortet werden, dass mindestens mit dem ersten Schrei, dem ersten Atemzug die Existenz eines Menschen mit dem ihm vom Gesetz zugestandenen Schutz seiner Würde feststeht. Ebenso hilft am Ende des Lebens, dass spätestens mit dem letzten Atemzug und der Feststellung des Todes eines Menschen die Menschenwürde endet, weil kein lebender Mensch mehr ist.20Es würde meinen Beitrag sprengen und dem eigentlichen Thema nicht dienen, würde hier auf die Diskussion um Schutz der Menschenwürde auch für den Nasciturus eingegangen. Dazu finden sich in einschlägigen Kommentaren zum Grundgesetz umfangreiche Ausführungen, auf die ich hier verweise, vgl. nur v. Mangoldt/Klein/Starck, hrsg. von Huber, Peter/Voßkuhle, Andreas, Kommentar zum GG, 1. Band, 7. Aufl., Rn 94 ff; Jarass, Hans/Pieroth, Bodo, Kommentar zum GG, 13. Aufl., zu Art 1 Rdn 8 ff.
Die Menschenwürde als unveränderliches und bedingungsloses Grundrecht
Die Würde eines Menschen nach Art. 1 GG materialisiert sich nicht in einem Strahlenkranz um den Kopf oder einer Art Heiligenschein, der sichtbar bleibt, solange sich ein Mensch würdevoll benimmt, und der verschwindet, wenn es an gelebter Würde fehlt. Menschenwürde wird vom Grundgesetz als unsichtbares, unmessbares und unveränderliches Faktum des Menschseins akzeptiert. In Bezug zu jedem anderen Menschen hat jeder Mensch ohne Einschränkung Menschenwürde. Sobald er/sie auf die Welt kommt, fordert das Grundgesetz dazu auf, die Würde dieses Menschen zu achten. Sie ist nicht objektiv messbar oder subjektiv zu beurteilen – sie ist ohne jegliche Einschränkung zu achten – in jedem einzelnen Fall. Damit ergibt sich aus dem Grundgesetz ein Statut, das die Gleichung „Mensch=Würde“ jeglicher präzisierenden weiteren Interpretation und der Suche nach Voraussetzungen entzieht. Die sich anschließende Formulierung des Grundgesetzes hilft dabei, die Gleichung „Mensch=Würde“ in einen Sinn gebenden Kontext zu stellen, da mit ihrer Annahme Schutzregeln generiert werden. Diese beziehen sich auf jeden Menschen, der Mensch ist.
Aus der schlichten Feststellung, dass zu jedem Menschen auch Menschenwürde gehört, folgert das Grundgesetz, dass es deswegen „unverletzliche unveräußerliche Menschenrechte“ gibt, und statuiert im Anschluss an Art. 1 Abs. 1 GG in Abs. 2 GG: „Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten …“. Durch das „darum“ schließt sich der Kreis: Die Väter und Mütter des Grundgesetzes hinterließen uns damit eine erweiterte Gleichung: „Mensch=Menschenwürde=Menschenrechte“ ohne Ansehen der Person, ohne kritische Bewertung oder Anspruchstellung an bestimmte Eigenschaften und deren Einsatz des einzelnen menschlichen Individuums. Unter diesem Schutz steht jeder Mensch, ob er über geniale Fähigkeiten verfügt, ob er körperlich oder geistig behindert ist oder ob er aufgrund fortgeschrittenen Alters viele seiner ursprünglichen Fähigkeiten verloren hat. Sein Schutz als Träger von Menschenwürde kann und darf dadurch nicht geschmälert sein.
Der Mensch wird von der Rechtsordnung als einzelnes Individuum vorausgesetzt und als solches und nicht etwa als funktionierender Teil der Gemeinschaft wahrgenommen und geschützt.21Vgl. Böckenförde, a.a.O., S. 58 ff. Der einzelne Mensch erhält vom Grundgesetz keine wie auch immer geartete Vorgabe, „würdevoll“ zu sein, ihm wird durch das Rechtssystem die Freiheit gewährt, sich seine Bestimmung selbst zu suchen, sie aber auch zu verlieren oder aus egal welchen Gründen zu verfehlen, ohne dass sich daraus Folgen für den ihm als Individuum vom Grundgesetz gewährten Schutz ergäben.22Vgl. Böckenförde, a.a.O., S. 60. Böckenförde nennt Menschen konsequent als durch das Grundgesetz „in Freiheit Gesetzte“.23Vgl. Böckenförde, a.a.O., S. 62.
Durch diese voraussetzungsfreie Anerkennung als Individuum erhält jeder Mensch durch die Rechtsordnung unabhängig von seinen Qualitäten, seinem Lebenswandel und dem Nicht-mehr-Können den Status, Mensch mit Würde zu sein mit den sich daraus ergebenden Schutzfunktionen. Was bedeutet nun aber die Feststellung, dass vom Grundgesetz alle Menschen ohne Ansehen der Person als innerhalb der Gleichung „Mensch=Würde=Menschenrechte“ anerkannt werden, speziell für Menschen mit Behinderung, für Sterbende oder für Menschen, deren Fähigkeiten fortschreitendem Alter zum Opfer gefallen sind – also Menschen, die nicht „würdevoll“ daherkommen?
Ganz eindeutig richtete sich die ursprüngliche Schutzrichtung auf das Verhältnis zwischen Staat und Bürger. Dem entspricht die Formulierung in Art. 1 Abs. 1 Satz 2 GG: „Sie (die Würde des Menschen) zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ Auch hier erkennt man den historischen Hintergrund eines vergangenen Staatsverhaltens, in dem nach eigenen Maßstäben geschützt, gefördert oder verworfen wurde. Diese Betrachtung entspricht heute längst nicht mehr der gesamten Bandbreite der von Menschenrechten ausgehenden Schutzwirkung.
Die Rechtsanwendung hat sich weiterentwickelt und das Schutzsubjekt gegenüber dem Objekt erweitert. Es geht bei dem Schutz der Menschenwürde und der Menschenrechte nicht länger nur um das Verhältnis „Bürger – Staat“, es geht vielmehr um die gesamte Rechtsordnung und damit auch um das Verhältnis „Bürger – Gemeinschaft“ oder auch „Bürger – Bürger“. Die gesamte Rechtsordnung unterliegt dem Verständnis, dass eine Verletzung der Menschenwürde stets illegal sei. Gerade auch weil Menschenwürde in Bezug auf die gesamte Gemeinschaft und jedes ihrer Mitglieder (es sei wiederholt: unabhängig von der eigenen Wertschöpfung, der Eigenleistung eines Individuums24Vgl. Hofmann, Hasso, Die versprochene Menschenwürde, AöR Nr. 118, 1993, S. 353-377.) schutzwürdig bleibt. Die gesamte im Staat zusammengefasste Gemeinschaft hat danach die Gleichung „Mensch=Würde=Schutz der Menschenrechte“ zu beachten.25Vgl. Böckenförde, a.a.O., S. 412/413. Das gilt gegenüber jedem einzelnen Mitglied der Gesellschaft ohne Ansehen der einzelnen Person.
Entnommen aus Behinderung und Recht 6/2024, S. 155.
----------
- 1Nur wenige Monate zuvor einigten sich die Vereinten Nationen auf eine Formulierung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, in der von der „angeborenen Würde … aller Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen“ die Rede ist (so die offizielle deutsche Übersetzung).
- 2Vgl. Kant, Immanuel, Grundlegung der Metaphysik der Sitten, 1785/2016 (Karl-Maria Guth); Kant, Kritik der Urteilskraft, 1790/2016 (Karl-Maria Guth).
- 3Vgl. Gewirth, Alan, 1992 „Human Dignity as the Basis of Rights“, in Meyer, Michael/Parent, Michael (Hrsg.) The Constitution of Rights, S. 10 ff; vgl. auch Steigleder, Klaus, 1999, Grundlegung der normativen Ethik.
- 4So Stoecker, Ralf, Theorie und Praxis der Menschenwürde, 2019, http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=4591ab86c8784d50b008f442703b0461&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm.
- 5Vgl. Schaber, Peter, Menschenwürde, 2012
- 6Vgl. Durkheim, Emile, Über soziale Arbeitsteilung, Studie über die Organisation höherer Gesellschaften, FFM1930/1992, S. 238 ff.
- 7Vgl. hierzu die Ausführungen von Luhmann, Niklas, Grundrechte als Institution: Ein Beitrag zur politischen Soziologie, Schriften zum öffentlichen Recht, 1965/2009, 5. Aufl.
- 8Vgl. Metz, Thaddeus, 2013, „The Meaning of Life“, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.standford.edu/entries/life-meaning.
- 9Die hier gewählte Auflistung kann keinesfalls vollständig sein, es sei nur auf Übersichten zu diesen und weiteren Ansätzen hingewiesen etwa bei Kipke, Roland, Die Sinntheorie der Menschenwürde – Auf dem Weg zu einem neuen und integrativen Ansatz, Zeitschrift für Praktische Philosophie Bd. 7, Heft 2, 2020, S. 91-118, vor allem S. 92 ff.; oder bei Lindemann, Gesa, Menschenwürde – Ihre gesellschaftsstrukturellen Bedingungen, https://www.academia.edu/7344514/Menschenwürde_ihre_gesellschaftsstrukturellen_Bedingungen?email_work_card=view-paper.
- 10Vgl. Kipke, Roland, Die Sinntheorie der Menschenwürde, Zeitschrift für Praktische Philosophie, Bd. 7, Heft 2, 2020, S. 91 ff, https://www.praktische-philosophie.org//doi.org/10.22613/zfpp/7.2.4.
- 11Vgl. Hauskeller, Michael, https://www.academia.edu/1882884/Unsinn_auf_Stelzen_Menschenwürde_als_säkularer_Glaubensartikel?email_work_card=view-paper/published in eBook Scheidewege 35 (2005/2006) S. 10-21.
- 12So der damalige FDP-Abgeordnete und spätere erste Bundespräsident Heuß, Theodor im Jahrbuch des öffentlichen Rechts (JöR), zur Entstehungsgeschichte der Artikel des Grundgesetzes, Bd. 1, S. 49 ff.
- 13So Dreier, Horst, in: Dreier, Kommentar zum GG, Art 1 Abs. 1, Rdn 27 ff und 121 f.
- 14Vgl. Böckenförde, Ernst-Wolfgang, Recht, Staat, Freiheit, erweiterte Ausgabe, 8. Aufl. 2021, S. 396.
- 15Vgl. Böckenförde, a.a.O., S. 391.
- 16Im Urteil des Bundesverfassungsgerichts, BVerfGE 87, S. 209/228 wird genau diese Gleichung betont und bestätigt: Bei der Gleichung „Mensch=Würde“ geht es um das Zugestehen eines sozialen Wert- und Achtungsanspruches, weil ein Mensch ein Mensch ist.
- 17Auch diese Frage ist allerdings nicht unstreitig, sie soll jedoch hier nicht weiter vertieft werden. So besteht etwa Einigkeit, dass der Schutz der Würde des Verstorbenen über den Tod hinaus zu achten ist und sein Leichnam nicht etwa als Kunst- oder Medizin-Objekt behandelt werden darf. Vgl. dazu nur von Mangoldt/Klein/Starck, a.a.O., Rn. 22 f.
- 18Vgl. nur BVerfGE 6, S. 32 und 40.
- 19Der Paritätische Dachverband, 12 Thesen des Deutschen Behindertenrates, 07.12.2000 erstellte Fachinformation von Joachim Hagelskamp.
- 20Es würde meinen Beitrag sprengen und dem eigentlichen Thema nicht dienen, würde hier auf die Diskussion um Schutz der Menschenwürde auch für den Nasciturus eingegangen. Dazu finden sich in einschlägigen Kommentaren zum Grundgesetz umfangreiche Ausführungen, auf die ich hier verweise, vgl. nur v. Mangoldt/Klein/Starck, hrsg. von Huber, Peter/Voßkuhle, Andreas, Kommentar zum GG, 1. Band, 7. Aufl., Rn 94 ff; Jarass, Hans/Pieroth, Bodo, Kommentar zum GG, 13. Aufl., zu Art 1 Rdn 8 ff.
- 21Vgl. Böckenförde, a.a.O., S. 58 ff.
- 22Vgl. Böckenförde, a.a.O., S. 60.
- 23Vgl. Böckenförde, a.a.O., S. 62.
- 24Vgl. Hofmann, Hasso, Die versprochene Menschenwürde, AöR Nr. 118, 1993, S. 353-377.
- 25Vgl. Böckenförde, a.a.O., S. 412/413.