Aktuelle Entwicklungen der Umsatzbesteuerung von Kurgemeinden
Rechtsprechung von EuGH und BFH im Überblick
Aktuelle Entwicklungen der Umsatzbesteuerung von Kurgemeinden
Rechtsprechung von EuGH und BFH im Überblick
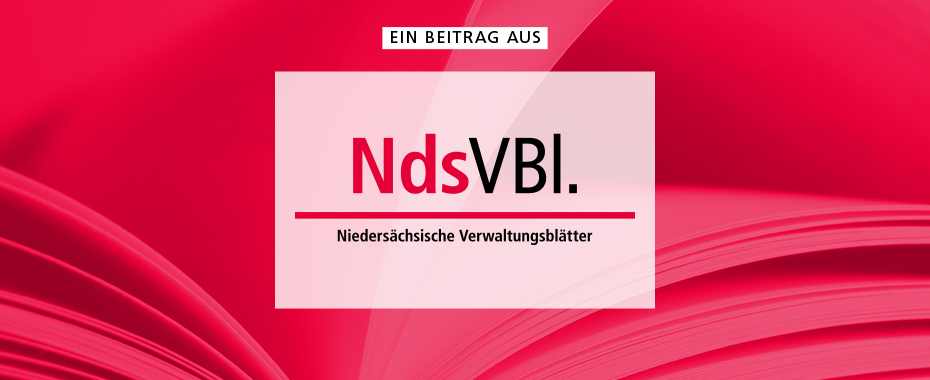
Kurorte, Erholungsorte, Küstenbadeorte und sonstige Tourismusgemeinden (im Folgenden verkürzt: Kurgemeinden) erheben zur Finanzierung ihrer Kur- und Fremdenverkehrseinrichtungen häufig Gästebeiträge auf Grundlage des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG), die im Kommunalabgabenrecht und im Umsatzsteuerrecht1 auch „Kurtaxen” genannt werden. Da der Gästebeitrag die Möglichkeit zur Nutzung bereitgestellter Kur- und Fremdenverkehrseinrichtungen „abgilt”, stellt sich die Frage, ob Gemeinden durch die Erbringung von „Kur”-Leistungen eine umsatzsteuerpflichtige Leistung an die Gäste erbringen, mit der Folge, dass sie berechtigt sind, einen Vorsteuerabzug für Investitionen in die entsprechenden Einrichtungen vorzunehmen. Zwar deutet die Steuersatzermäßigung in § 12 Abs. 2 Nr. 9 Satz 2 UStG darauf hin, dass der Gesetzgeber vom Bestehen einer entgeltlichen Leistung ausgeht, in jüngerer Zeit mehren sich aber Zweifel an der Gültigkeit dieser Annahme – nicht zuletzt aufgrund der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) in der Rechtssache Gemeinde A2, in der dieser das Bestehen einer entgeltlichen Leistung in einem Fall verneinte, in dem die Kureinrichtungen einer Gemeinde für jedermann frei und unentgeltlich zugänglich waren.
Ziel dieses Beitrags ist es, diese Entscheidung des EuGH in die jüngere Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) und der Finanzgerichte zur Vorsteuerabzugsberechtigung von Kurgemeinden einzuordnen und die Konsequenzen für die Ausgestaltung der Erhebung von Gästebeiträgen aufzuzeigen.
Berechtigung zum Vorsteuerabzug
1. Rechtsgrundlage
Der Umsatzsteuer unterfallen nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG Umsätze, die ein Unternehmer (siehe sogleich 2.) im Rahmen seines Unternehmens gegen Entgelt (siehe sogleich 3.) im Inland ausführt. Das Vorliegen dieser Merkmale ist nicht nur Voraussetzung für die Umsatzsteuerpflicht des Gästebeitrags, sondern auch der Berechtigung der Kurgemeinden zum Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 UStG. Nach dieser Regelung kann die gesetzliche Umsatzsteuer, die in Rechnungen für Leistungen an die Kurgemeinde ausgewiesen ist, von der Umsatzsteuerschuld der Kurgemeinde in Abzug gebracht werden, soweit sie als Unternehmerin beabsichtigt, diese Eingangsumsätze zur Erbringung entgeltlicher Ausgangsumsätze (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG) – nämlich zur Bereitstellung der Kur- bzw. Tourismusinfrastruktur gegen Erhebung des Gästebeitrags – zu verwenden.3 Neuralgische Punkte der Berechtigung zum Vorsteuerabzug, die zugleich im Mittelpunkt der jüngeren Rechtsprechung standen, sind somit die Unternehmereigenschaft der Kommune sowie das Erbringen einer entgeltlichen Leistung.
2. Unternehmereigenschaft
Nach § 2 Abs. 1 Satz 1 und 3 UStG ist Unternehmer, wer eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit selbstständig ausübt, wobei gewerblich oder beruflich jede nachhaltige Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen ist, auch wenn die Absicht, Gewinn zu erzielen, fehlt. Der seit dem Jahr 2016 geltende § 2b UStG4, der spätestens für ab dem Jahr 2021 ausgeführte Umsätze anzuwenden ist5, normiert im Wesentlichen die bereits in ständiger Rechtsprechung des BFH6 nach Maßgabe des Art. 13 Abs. 1 MwStSystRL vorgenommene Auslegung des zuvor geltenden § 2 Abs. 3 UStG a. F.7
§ 2b Abs. 1 Satz 1 UStG sieht vor, dass juristische Personen des öffentlichen Rechts nicht als Unternehmer i. S. d. § 2 UStG gelten, soweit sie Tätigkeiten ausüben, die ihnen im Rahmen der öffentlichen Gewalt obliegen, auch wenn sie im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten Zölle, Gebühren, Beiträge oder sonstige Abgaben erheben. Eine Unternehmereigenschaft liegt in diesem Fall nur ausnahmsweise nach § 2b Abs. 1 Satz 2 UStG vor, wenn die Behandlung als Nichtunternehmer zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führen würde. Wettbewerbsverzerrungen können allerdings nur entstehen, wenn ein Wettbewerb tatsächlich besteht oder zumindest bestehen kann. Die rein hypothetische, nicht faktenbasierte Möglichkeit eines Wettbewerbs reicht dagegen zur Annahme einer Unternehmereigenschaft nicht aus.8
3. Entgeltliche Leistung
Gegen Entgelt wird eine Leistung ausgeführt, wenn zwischen dem Leistenden und dem Leistungsempfänger ein Rechtsverhältnis besteht, in dessen Rahmen gegenseitige Leistungen ausgetauscht werden.9 Voraussetzung ist, dass zwischen der erbrachten Dienstleistung und dem erhaltenen Gegenwert ein unmittelbarer Zusammenhang besteht10, wobei grundsätzlich jeder kausale Zusammenhang zwischen Leistung und Gegenleistung genügt.11 Hierfür müssen sich die gegenseitigen Leistungen bedingen, d. h. die eine Leistung darf nur unter der Voraussetzung erbracht werden, dass auch die andere Leistung erfolgt, und umgekehrt.12 Dabei bildet die vom Leistenden empfangene Vergütung den tatsächlichen Gegenwert für die dem Leistungsempfänger gegenüber erbrachte bestimmbare Dienstleistung.13 Unerheblich ist die Höhe der Gegenleistung und insbesondere, ob diese höher, gleich hoch oder geringer als die Kosten ist, die dem Unternehmer im Rahmen der Erbringung seiner Leistung entstanden sind.14
Aktuelle Rechtsprechung
1. Urt. des BFH v. 18.10.2023 (Az. XI R 21/23) und Urt. des EuGH in der Rs. Gemeinde A v. 13.07.2023 (Az. C-344/22)
a) Sachverhalt und erstinstanzliche Entscheidung des FG Baden-Württemberg
Das Finanzgericht Baden-Württemberg15 hatte erstinstanzlich über die Vorsteuerabzugsberechtigung einer Kurgemeinde für Investitionen in ihre Kureinrichtungen, wie z. B. Kurpark, Kurhaus und Wege, zu entscheiden. Diese Kureinrichtungen konnten von jedermann ohne Zugangsbeschränkungen oder -kontrollen genutzt werden. Ein Gästebeitrag wurde lediglich von Übernachtungsgästen erhoben, nicht aber von Tagestouristen. Der Vorsteuerabzug war der Kurgemeinde durch die Finanzverwaltung (teilweise) versagt worden. Dem schloss sich das Finanzgericht mit der Begründung an, die Gemeinde handele mangels Möglichkeit eines Wettbewerbs mit potenziellen privaten Anbietern nicht als Unternehmerin. Zudem fehle es am für den Vorsteuerabzug zusätzlich erforderlichen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Eingangs- und Ausgangsleistungen, da die Kurinfrastruktur dem Allgemeingebrauch gewidmet oder jedenfalls eine öffentliche Einrichtung i. S. d. § 10 Abs. 2 und 3 GemO Baden-Württemberg sei.
b) Vorlagefragen und Entscheidung des EuGH
aa) Erste Vorlagefrage: Vorliegen einer entgeltlich erbrachten Leistung
Im Revisionsverfahren setzte der XI. Senat des BFH16 das Verfahren aus und legte dem EuGH zur Vorabentscheidung nach Art. 267 Abs. 1 AEUV zum einen17 die Frage vor, ob es sich bei der Bereitstellung von Kureinrichtungen überhaupt um eine wirtschaftliche Tätigkeit – also eine Leistung – gegen Entgelt i. S. d. Art. 2 Abs. 1 Buchst. c MwStSystRL handelt, wenn die Kureinrichtungen ohnehin für jedermann, also auch für Hauptwohnsitznehmer in der betreffenden Kurgemeinde, frei zugänglich sind. Er stellte damit hinsichtlich der Berechtigung zum Vorsteuerabzug im Gegensatz zum Finanzgericht nicht auf den potenziellen Wettbewerb als Voraussetzung der Unternehmereigenschaft oder auf den unmittelbaren Zusammenhang zwischen Eingangs- und Ausgangsumsatz ab, sondern auf die Frage der wirtschaftlichen Tätigkeit und damit der Entgeltlichkeit der erbrachten Ausgangsumsätze, die bei richtlinienkonformer Auslegung des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG ebenfalls Voraussetzung des Vorsteuerabzugs ist.18 Fehlt es bereits an der Erbringung einer entgeltlichen Leistung, so kommt es auf das Vorliegen der u. U. aufwändig zu klärenden tatsächlichen Voraussetzungen des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG gar nicht mehr an.
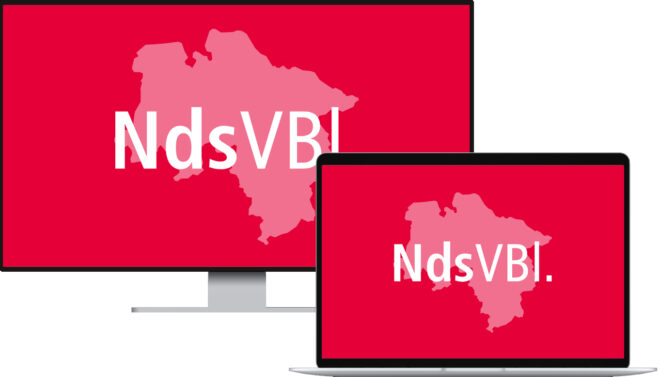 Diese Frage nach dem Bestehen einer entgeltlich erbrachten Leistung verneinte der EuGH19: Ein Rechtsverhältnis, in dessen Rahmen gegenseitige Leistungen ausgetauscht werden, liege zwischen der Kurgemeinde und den zur Zahlung des Gästebeitrags nach der örtlichen Satzung Verpflichteten nicht vor, soweit die Kureinrichtungen von jedermann genutzt werden könnten, unabhängig davon, ob die potenziellen Nutzer zur Zahlung des Gästebeitrags verpflichtet seien. Ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Leistung und Gegenleistung erfordere ein gegenseitiges Bedingen. So werde der Gästebeitrag bereits aufgrund der örtlichen Satzung dem Grunde und der Höhe nach festgesetzt. Überdies hänge die kommunalabgabenrechtliche Pflicht zur Entrichtung des Gästebeitrags nicht von der Nutzung der Kurinfrastruktur durch die Pflichtigen ab, sondern ausschließlich vom Aufenthalt im Gemeindegebiet. Zur Zahlung des Gästebeitrags seien bereits Personen verpflichtet, die lediglich Familienangehörige oder Bekannte besuchten, auch ohne die Absicht der Nutzung der Kureinrichtungen. Schließlich hätten die zur Zahlung des Gästebeitrags Verpflichteten hierdurch keine Vorteile gegenüber den Nichtverpflichteten, die die Kurinfrastruktur dennoch nutzten.
Diese Frage nach dem Bestehen einer entgeltlich erbrachten Leistung verneinte der EuGH19: Ein Rechtsverhältnis, in dessen Rahmen gegenseitige Leistungen ausgetauscht werden, liege zwischen der Kurgemeinde und den zur Zahlung des Gästebeitrags nach der örtlichen Satzung Verpflichteten nicht vor, soweit die Kureinrichtungen von jedermann genutzt werden könnten, unabhängig davon, ob die potenziellen Nutzer zur Zahlung des Gästebeitrags verpflichtet seien. Ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Leistung und Gegenleistung erfordere ein gegenseitiges Bedingen. So werde der Gästebeitrag bereits aufgrund der örtlichen Satzung dem Grunde und der Höhe nach festgesetzt. Überdies hänge die kommunalabgabenrechtliche Pflicht zur Entrichtung des Gästebeitrags nicht von der Nutzung der Kurinfrastruktur durch die Pflichtigen ab, sondern ausschließlich vom Aufenthalt im Gemeindegebiet. Zur Zahlung des Gästebeitrags seien bereits Personen verpflichtet, die lediglich Familienangehörige oder Bekannte besuchten, auch ohne die Absicht der Nutzung der Kureinrichtungen. Schließlich hätten die zur Zahlung des Gästebeitrags Verpflichteten hierdurch keine Vorteile gegenüber den Nichtverpflichteten, die die Kurinfrastruktur dennoch nutzten.
Eine gegen Entgelt erbrachte Leistung lag damit vor allem deshalb nicht vor, weil die Bereitstellung der Kurinfrastruktur nicht exklusiv für den beitragsverpflichteten Personenkreis erbracht wurde, und zwar gleich in doppelter Hinsicht: Zum einen erfasst der Gästebeitrag bestimmte Personengruppen, welche die Kureinrichtungen nutzen, nicht. Zum anderen werden Personengruppen erfasst, die bei typisierender Betrachtung die Einrichtungen nicht nutzen bzw. sich nicht zu diesem Zweck im Gemeindegebiet aufhalten.20
bb) Zweite Vorlagefrage: Unternehmereigenschaft von Kurgemeinden (unbeantwortet)
Auf die zweite Vorlagefrage, die die Unternehmereigenschaft der Kurgemeinde zum Gegenstand hatte, brauchte der EuGH mangels Entscheidungserheblichkeit nicht mehr einzugehen; sie blieb daher unbeantwortet. Als Folge der bindenden Beantwortung der ersten Vorlagefrage durch den EuGH wurde das wieder aufgenommene Revisionsverfahren durch den BFH zurückgewiesen.21
Dass die zweite Vorlagefrage unbeantwortet bleiben konnte, macht sie allerdings nicht weniger bedeutend. Im Gegenteil ist die darin angesprochene Unternehmereigenschaft von Kurgemeinden von grundlegender Bedeutung, denn während Kurgemeinden die Modalitäten der Ausgestaltung des Gästebeitrags i.R. der Kommunalabgabengesetze selbst gestalten können, betrifft die zweite Vorlagefrage primär das Bestehen eines potenziellen Wettbewerbs, was sich der Einflussnahme der Gemeinden weitgehend entziehen dürfte (s.u. IV.).
Den gesamten Beitrag lesen Sie in unseren NdsVBl..


