Wärmeplanung als neue Herausforderung für niedersächsische Kommunen
Rechtliche Grundlagen und Umsetzungsperspektiven
Wärmeplanung als neue Herausforderung für niedersächsische Kommunen
Rechtliche Grundlagen und Umsetzungsperspektiven
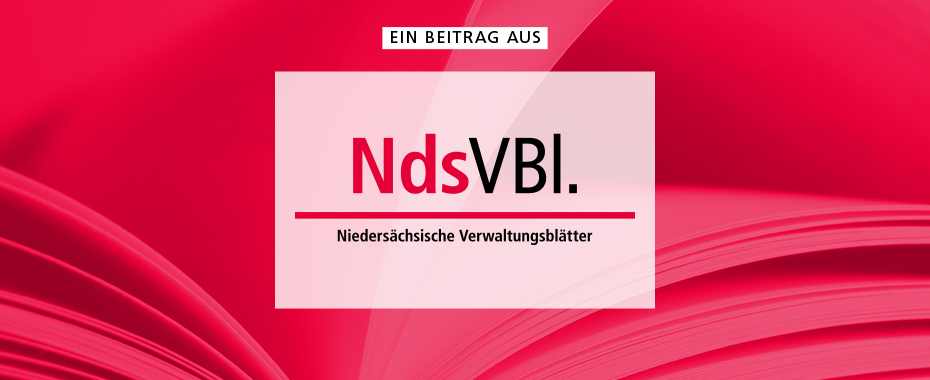
Mit der flächendeckenden Aufstellung von Wärmeplänen entsteht ein Paradigmenwechsel in der deutschen Wärmepolitik: Der Fokus richtet sich vom Einzelgebäude auf Versorgungsgebiete (bzw. -teilgebiete). Die (kommunale) Wärmeplanung stellt dabei die Grundlage für die kosteneffiziente Transformation vor Ort dar. Allerdings darf es nicht bei einer Planung bleiben, die Planung muss schlussendlich auch umgesetzt werden. Hierfür muss der Gesetzgeber die passenden Rahmenbedingungen setzen.
I. Ausgangssituation: Handlungsdruck durch Klimawandel
Deutschland steht bei der Energieversorgung vor einer Zeitenwende. Die Größe der vor uns als Gesellschaft stehenden Aufgabe ist vergleichbar mit der Industrialisierung vor rund 200 Jahren. Die fortschreitende Erderwärmung und damit verbundene, immer häufiger auftretende Extremwetterereignisse machen ein Umlenken auf erneuerbare Energien und klimaneutrale Energieträger unabdingbar. Ein „Weiter so!“ hätte für Menschen, Tiere und Pflanzen bis hin zur Zerstörung der eigenen Lebensgrundlage dramatische Folgen.
Nach Angaben der Bundesregierung sind zwischen 2000 und 2021 durch Folgen des Klimawandels 145 Mrd. € Schäden entstanden. Je nachdem, wie der Klimawandel fortschreitet, liegen die künftigen Kosten bis 2050 zwischen 280 und 900 Mrd. €1. In diesen Zahlen sind zahlreiche gesundheitliche Beeinträchtigungen, Todesfälle durch Hitze und Überflutungen, die Belastung von Ökosystemen, der Verlust von Artenvielfalt und eine schlechtere Lebensqualität nicht einberechnet.
Jeder Euro für den Klimaschutz ist besser investiert als ein Vielfaches in die Schadensbehebung. Klimaschutz ist Menschenschutz. Klimaschutz ist eine Investition in den Erhalt unseres Wohlstands, sozialen Friedens, unserer Unabhängigkeit und Freiheit. Die Energiewende ist eine gesamtgesellschaftliche Mammutaufgabe mit hohem Investitionsbedarf. Damit der Umstieg auf saubere und bezahlbare Energie gelingt und Stadtwerke auch künftig ihre Aufgaben leisten können, brauchen wir andere Finanzierungsformen als bisher und ein möglichst großes Angebot an klimaneutralen Energien. Denn auch hier gilt: Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Je mehr Energie angeboten werden kann, desto günstiger die Preise.
UN-Generalsekretär António Guterres hat die Anstrengungen gegen die Erderwärmung als einen „Kampf um Leben und Tod für unsere Sicherheit heute und unser Überleben morgen“ bezeichnet. Auf der Weltklimakonferenz sagte er: „Wir sind auf dem Highway zur Klimahölle mit dem Fuß auf dem Gaspedal“2. Den 20 wohlhabendsten Ländern warf er vor, nicht genug gegen eine Überhitzung des Planeten zu tun.
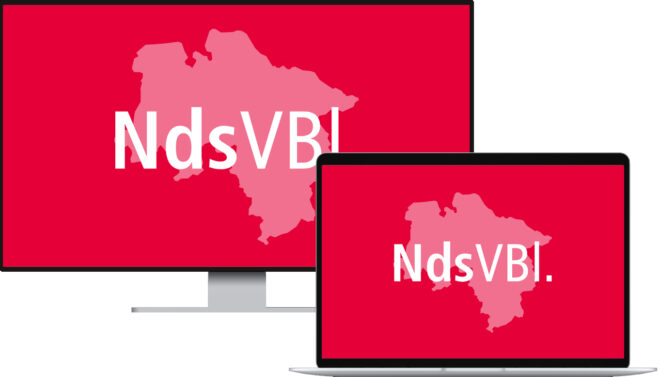 Hierzulande verpflichtet § 3 Absatz 2 Satz 1 Bundes-Klimaschutzgesetz Deutschland bis 2045 CO2-neutral zu sein3. Auf Europaebene setzt sich die Europäische Union mit ihrer Initiative „Fit for 55“ ebenfalls für eine schnellere Reduzierung der Treibhausgase ein und hat durch das „Europäische Klimagesetz“ eine Senkung der CO2-Emissionen um 55 Prozent gegenüber 1990 bis 2030 verbindlich normiert. Bis 2050 soll Europa komplett treibhausgasneutral werden4. Und im Pariser Klimaschutzübereinkommen haben sich die Regierungen darauf geeinigt, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 °C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen und einen Anstieg von weniger als 1,5 °C anzustreben5.
Hierzulande verpflichtet § 3 Absatz 2 Satz 1 Bundes-Klimaschutzgesetz Deutschland bis 2045 CO2-neutral zu sein3. Auf Europaebene setzt sich die Europäische Union mit ihrer Initiative „Fit for 55“ ebenfalls für eine schnellere Reduzierung der Treibhausgase ein und hat durch das „Europäische Klimagesetz“ eine Senkung der CO2-Emissionen um 55 Prozent gegenüber 1990 bis 2030 verbindlich normiert. Bis 2050 soll Europa komplett treibhausgasneutral werden4. Und im Pariser Klimaschutzübereinkommen haben sich die Regierungen darauf geeinigt, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 °C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen und einen Anstieg von weniger als 1,5 °C anzustreben5.
Der Niedersächsische Landtag hat am 11.12.2023 die Novelle des Niedersächsischen Klimagesetzes beschlossen6. Die Novelle umfasst dabei unter anderem die Anhebung der Klimaziele – so sollen bis 2030 die Treibhausgasemissionen des Landes um 75 Prozent und bis 2035 um 90 Prozent gesenkt werden. Die Treibhausgasneutralität soll bis 2040 erreicht werden. Klimaschutz ist den Deutschen wichtig: Laut ARD-DeutschlandTrend wollen 44 Prozent mehr Tempo beim Klimaschutz7. Allerdings sinkt laut Civey die Bereitschaft die Kosten einer grünen Zukunft zu tragen. Das zeigt: Die Energiewende hat kein Akzeptanz-, aber ein Finanzierungsproblem.
Um die Klimaschutzziele zu erreichen, sind enorme Anstrengungen in den Sektoren Energie, Industrie, Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft und Abfallwirtschaft notwendig. Zunächst wurde das Augenmerk auf die Bereiche Energie, Industrie und Verkehr gerichtet. Es wurde aber schnell deutlich, dass ohne eine massive Senkung der CO2-Emissionen im Gebäudebereich und dort insbesondere in der Wärmebereitstellung für Gebäude die Klimaschutzziele nicht erreichbar sind, da der Gebäudesektor den viertgrößten Sektor der CO2-Emittenten darstellt8.
Die Frage ist also, wie die Wärmeversorgung der Zukunft aussehen soll. Nach den Vorstellungen der Bundesregierung soll die Wärmeversorgung überwiegend auf Basis von Strom (für Wärmepumpen), Wärmenetzen und erneuerbaren Gasen erfolgen. Damit gewinnen die leitungsgebundenen Infrastrukturen der allgemeinen Versorgung an Bedeutung. Dezentrale klimaneutrale Versorgungsoptionen wie z. B. Biomassekessel oder Solarthermie werden zwar (absolut) an Bedeutung zunehmen, es ist allerdings nicht davon auszugehen, dass diese größer ist als der heutige Einsatz z. B. von Kohle oder Heizöl.
Die Details sind im Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbaren Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz – GEG)9 sowie im damit eng verzahnten Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze (Wärmeplanungsgesetz – WPG)10 geregelt, welche beide zum 01.01.2024 in Kraft getreten sind. Bundesbauministerin Klara Geywitz sagte im Bundesrat zur Beratung des WPG folgendes: „Ab dem 1. Januar 2024 werden in ganz Deutschland Wärmepläne erstellt. Das gibt den Bürgerinnen und Bürgern, den Unternehmen und Energieversorgern Sicherheit darüber, mit welcher Wärmeversorgung sie lokal rechnen können.“11
Nach den durch die ersten bekannt gewordenen Entwürfe zum GEG und die dadurch ausgelösten Diskussionen in der Presse und der Bevölkerung wird durch diese Aussage die Wichtigkeit der Wärmeplanung und die an sie gesetzten Erwartungen deutlich. Die kommunale Wärmeplanung beschreibt im Ergebnis einen wirtschaftlich optimalen und gesellschaftlich tragfähigen Transformationspfad hin zu einem klimaneutralen Gebäudebestand im örtlichen Versorgungsgebiet. Sie berücksichtigt dabei den Zustand und das Zusammenspiel der vorhandenen Energienetze und ist daher als integrierte Infrastrukturplanung zu verstehen, welche auf den vorhandenen Planungen der Kommunen und ihrer Unternehmen aufsetzt. Die Zielsetzung der Bundesregierung, dass mit der Verabschiedung des Gesetzes für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze ab Januar 2024 flächendeckend mit der Aufstellung von Wärmeplänen begonnen werden soll, ist daher sehr zu begrüßen.
Ein großer Mehrwert der Wärmeplanung ist die Möglichkeit, die Transformationsstrategien unterschiedlicher Stakeholder (z. B. Stadtwerke, Wohnungswirtschaft, Industrie bzw. Gewerbe) aufeinander abzustimmen. Die betroffenen Akteure sind daher aufgerufen, sich am Planungsprozess zu beteiligen. Gleichzeitig schafft die Wärmeplanung eine gewisse Investitionssicherheit für die Gebäudeeigentümer in der Wahl der passenden Heizungsoption: Durch die Berücksichtigung der vorhandenen Infrastrukturen sowie des kostenbasierten Vergleiches unterschiedlicher Technologien bzw. Versorgungsoptionen sollte schlussendlich die für den jeweiligen Straßenzug im Wärmeplan kostengünstigste Option identifiziert und im Wärmeplan festgesetzt werden. Allerdings ist mit der Festsetzung im Wärmeplan noch nicht sichergestellt, dass die ausgewiesene Variante auch tatsächlich umgesetzt wird. Denn gemäß § 27 Abs. 2 WPG bewirkt die Entscheidung in einem Wärmeplan über die Ausweisung eines Gebiets als Gebiet zum Neu- oder Ausbau von Wärmenetzen oder als Wasserstoffnetzausbaugebiet keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder eine bestimmte Wärmeversorgungsinfrastruktur zu errichten, auszubauen oder zu betreiben. Vielmehr muss hierfür in einem zweiten Schritt noch bei Betreiber gefunden werden. Und dies wir nur erfolgen, wenn es für den Betreiber wirtschaftlich auch darstellbar ist.
Lediglich bei Feststetzung einer Gebietes für dezentrale Wärmeversorgung ist für die Gebäudeeigentümer klar, dass sie sich selbst um eine klimaneutrale Wärmeerzeugung (z. B. Wärmepumpe, Biomassekessel o.a.) kümmern müssen.
II. Rechtliche Grundlagen der Wärmeplanung
1. Wärmeplanung nach dem WPG
Das WPG verpflichtet in § 4 die Länder, sicherzustellen, dass auf ihrem Hoheitsgebiet Wärmepläne erstellt werden. Der Bund hat also die Pflicht zur Erstellung von Wärmeplänen zunächst den Ländern übertragen; eine Übertragung direkt durch den Bund auf die Kommunen war verfassungsrechtlich nicht zulässig.
Es ist aber davon auszugehen, dass das Land Niedersachsen diese Pflicht auf die Kommunen übertragen wird. Zwar besteht in Niedersachsen bereits die Pflicht zur Aufstellung von Wärmeplänen nach § 20 des NKlimaG für die Kommunen, in denen ein Mittel- oder Oberzentrum liegt. Allerdings ist diese Pflicht anders ausgestaltet als die Wärmeplanungen nach dem WPG, sodass eine landesrechtliche Übertragung auf die nach dem WPG zunächst dem Land obliegende Pflicht auf die Kommunen notwendig ist. Erfolgt dies, so hat das Land gemäß Art. 57 Abs. 4 der Niedersächsischen Verfassung durch Gesetz für einen finanziellen Ausgleich zu sorgen (Konnexitätsprinzip). Für die Pflicht zur Erstellung von Wärmeplänen nach § 20 NKlimaG durch Kommunen, in denen ein Mittel- und Oberzentrum liegt, ist diese Kostenausgleichsregelung in § 20 Abs. 6 NKlimaG bereits vorhanden. Allerdings dürften die dort vorgesehenen finanziellen Mittel für die nach dem WPG aufzustellenden Wärmepläne nicht ausreichend sein, da die Anforderungen des WPG an Wärmpläne deutlich höher sind als die Anforderungen nach § 20 NKlimaG.
Nach dem WPG sind die Wärmepläne spätestens bis zum Ablauf des 30.06.2026 für alle bestehenden Gemeindegebiete, in denen zum 01.01.2024 mehr als 100 000 Einwohner gemeldet sind, sowie spätestens bis zum Ablauf des 30.06.2028 für alle bestehenden Gemeindegebiete, in denen zum 01.01.2024 100 000 Einwohner oder weniger gemeldet sind, zu erstellen. Die Länder können für bestehende Gemeindegebiete, in denen zum 01.01.2024 weniger als 10 000 Einwohner gemeldet sind, ein vereinfachtes Verfahren nach Maßgabe von § 22 WEG vorsehen. Die Länder können außerdem vorsehen, dass für mehrere Gemeindegebiete eine gemeinsame Wärmeplanung erfolgen kann.
Nach § 5 WPG besteht die Pflicht zur Durchführung einer Wärmeplanung nicht für ein beplantes Gebiet, für das spätestens zum Ablauf der in § 4 Abs. 2 WPG genannten Umsetzungsfristen auf Grundlage von und im Einklang mit Landesrecht ein Wärmeplan erstellt und veröffentlicht wurde. Die Wirksamkeit eines solchen nach Landesrecht erstellten Wärmeplans wird durch das Inkrafttreten dieses Gesetzes nicht berührt.
In seiner Logik und einzelnen Teilschritten entspricht die Wärmeplanung nach WPG im Wesentlichen der insbesondere aus Baden-Württemberg bekannten Vorgehensweise (Bestandsanalyse, Potenzialanalyse, Szenarioentwicklung Umsetzungsstrategie usw.). Das WPG sieht allerdings in § 14 vor, dass für das beplante Gebiet oder Teilgebiete eine verkürzte Wärmeplanung durchgeführt werden kann, wenn die Eignung für die Versorgung durch ein Wärme- und Wasserstoffgebiet als sehr unwahrscheinlich anzusehen ist – entweder ist kein Wärme- bzw. Wasserstoffnetz vorhanden oder der Betrieb ist vermutlich unwirtschaftlich. Die Potenzialanalyse kann für diese Teilgebiete beschränkt werden auf dezentrale Wärmequellen.
Die Wärmeplanung wird rechtlich als unverbindliche, strategische Fachplanung verstanden. Der Wärmeplan und die formulierte Umsetzungsstrategie haben keine rechtliche Außenwirkung und begründen keine einklagbaren Rechte oder Pflichten.
Gleichwohl führt die Ausweisung, z. B. eines Wärme- oder Wasserstoffnetzgebietes, zum vorzeitigen Inkrafttreten des § 71 GEG (sog. „65-Prozent-Erneuerbaren-Energien-Anforderung“ für neue Heizungen). In diesem Zusammnehang führt der Beschluss eines kommunalen Wärmeplans für Gebiete, in denen keine Versorgung über ein Wasserstoffnetz ausgewiesen wird, für diese Gebiete dazu, dass bestehende Gasnetze nicht mehr in ein Wasserstoffnetz umgewidmet und auch keine neuen Wasserstoffnetze gebaut werden können. Letztendlich entscheidet die Kommune mit dem Wärmeplan damit über die Zukunft der vorhandenen Gasnetze. Diese Konsequenz folgt aus § 71 k GEG, weil nach § 71 k Abs. 1 Nr. 2 GEG durch den Gasverteilnetzbetreiber und die für die Wärmeplanung zuständige Stelle ein einvernehmlicher und verbindlicher Fahrplan zur Umstellung der Netzinfrastruktur auf eine Wasserstoffversorgung zur Genehmigung bei der Bundesnetzagentur eingereicht werden muss, was nicht erfolgt, wenn im Wärmeplan kein Wasserstoffnetzgebiet ausgewiesen ist. Außerdem sind die Anforderungen an diesen Fahrplan zeitlich unrealistisch und so hoch, dass im Zusammenspiel mit der unangemessenen Haftungsregelung des § 71 k Abs. 6 GEG von einer echten Technologieoffenheit nicht gesprochen werden kann.
In der politischen Diskussion stehen außerdem unterschiedliche Instrumente, um zusätzliche Verbindlichkeit für die Wärmeplanung zu schaffen. Auf Bundesebene steht der fokussierte Einsatz von staatlichen Fördermitteln dabei in Mittelpunkt: Um einen wirtschaftlichen Anreiz für Gebäudeeigentümer zu schaffen, sich möglichst gemeinwohlorientiert zu verhalten, wird staatliche Unterstützung nur noch für diejenige Versorgungsoption im Teilgebiet gewährt, welche nach Wärmeplan als mindestens geeignet identifiziert wird. Fördermittel würden damit unter Berücksichtigung des übergeordneten Infrastruktur- und Versorgungssystems gewährt werden. Auf kommunaler Ebene steht mit dem Anschluss- und Benutzungszwang ein weites Instrument zur Verfügung, von dem die Kommunen bislang auf sehr unterschiedliche Weise Gebrauch machen.
2. Wärmeplanung nach § 20 NKlimaG
Niedersachsen war bei der verpflichtenden Wärmeplanung deutlich früher am Start als der Bund. Mit dem Gesetz zur Änderung des Niedersächsischen Gesetzes zur Förderung des Klimaschutzes und zur Minderung der Folgen des Klimawandels sowie zur Änderung weiterer Gesetze vom 28.06.202212 hat der Landtag mit der Einfügung eines neuen § 20 in das NKlimaG Kommunen, in denen ein Ober- oder Mittelzentrum liegt, zur Wärmeplanung verpflichtet. In Kraft getreten ist diese Gesetzesänderung allerdings gemäß Art. 6 Gesetzes zur Förderung des Klimaschutzes und zur Minderung der Folgen des Klimawandels sowie zur Änderung weiterer Gesetze vom 28.06.2022 auch erst zum 01.01.2024. Allerdings wussten die Kommunen bereits seit Mitte 2022, welche Regelungen und Fristen für die Aufstellung von Wärmeplänen nach niedersächsischem Recht gelten. Durch das Gesetz zur Verbesserung des Klimaschutzes vom 12.12.202313 sind geringfügige Änderungen an den die Wärmeplanung betreffenden Regelungen des NKlimaG vorgenommen worden, unter anderem sind die Wärmepläne dem zuständigen Ministerium elektronisch zu übermitteln.
Aus Sicht der Kommunen hat der Bund sinnvollerweise Ausnahmeregelungen für Wärmeplanungen nach Landesrecht geschaffen. Ansonsten hätten bestehende Wärmepläne überarbeitet werden müssen bzw. laufende Wärmeplanungsverfahren wären unnötig verkompliziert worden und dadurch auch deutlich teurer geworden. Außerdem wären ansonsten Kommunen/Länder bestraft worden, die schon früh erkannt haben, dass für eine erfolgreiche Wärmewende eine Wärmeplanung notwendig ist.
Diese Ausnahmeregelungen sind in § 5 WPG enthalten. Aus § 5 Abs. 1 WPG ergibt sich, dass in Niedersachsen die Pflicht zur Durchführung einer Wärmeplanung nach den Regelungen des WPG nicht für ein beplantes Gebiet gilt, wenn auf Grundlage von und im Einklang mit § 20 NKlimaG ein Wärmeplan in Kommunen mit mehr als 100 000 Einwohnern erstellt und bis zum Ablauf des 30.06.026 veröffentlicht wurde. Damit sind die Fristen des NKlimaG (Erstellung bis zum 31.12.2026, Veröffentlichung bis zum 31.03.2027, vgl. § 20 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 NKlimaG) für diese Kommunen verkürzt worden. Allerdings ist zu beachten, dass Wärmepläne, die von Kommunen mit mehr als 100 000 Einwohnern vor dem 1. Januar erstellt wurden und die den Anforderungen des NKlimaG entsprechen, bis zum 31.03.2024 zu veröffentlichen sind (§ 20 Abs. 2 Satz 3 NKlimaG), damit die Ausnahmevorschrift des § 5 Abs. 1 WPG greift, weil § 5 Abs. 1 WPG vorschreibt, dass der Wärmeplan auf Grundlage von und im Einklang mit Landesrecht erstellt und veröffentlich wird.
Für Kommunen mit 100 000 oder weniger Einwohnern, sofern im Gemeindegebiet ein Ober- oder Mittelzentrum liegt, gilt für die Anwendung der Ausnahmevorschrift des § 5 Abs. 1 WPG allerdings nicht die Umsetzungsfrist des § 4 Abs. 2 Nr. 2 WPG (Erstellung und Veröffentlichung bis zum Ablauf des 30.06.2028), weil, wie oben ausgeführt, § 5 Abs. 1 WPG vorschreibt, dass der Wärmeplan auf Grundlage von und im Einklang mit Landesrecht erstellt und veröffentlich wurde. Da das Landesrecht, hier also § 20 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 NKlimaG für alle verpflichteten Kommunen den 31.12.2026 als Frist für die Erstellung und den 31.03.2027 für die Veröffentlichung gesetzt hat, muss zur Anwendung der Ausnahmevorschrift des § 5 Abs. 1 WPG in diesen Kommunen der Wärmeplan bis zum 31.12.2026 erstellt und bis zum 31.03.2027 veröffentlicht sein. Sofern der Wärmeplan vor dem 1. Januar erstellt wurde, muss er sogar bis zum 31.03.2024 veröffentlicht worden sein (§ 20 Abs. 2 Satz 3 NKlimaG), damit die Ausnahmevorschrift des § 5 Abs. 1 WPG greift.
Für Gemeinden, in denen weder ein Ober- noch ein Mittelzentrum liegt, gilt § 5 Abs. 1 WPG nicht, da es für diese Kommunen keine landesrechtliche Regelung für die Erstellung von Wärmeplänen gibt.
Damit greift für diese Kommunen der etwas restriktivere § 5 Abs. 2 WPG. Dieser greift unter Umständen auch für Kommunen, die vor dem 01.01.2024 einen Wärmeplan erstellt haben, der nicht § 20 Abs. 4 und 5 NKlimaG entspricht, da § 20 NKlimaG erst am 01.01.2024 in Kraft getreten ist und es sich bei einem solchen Wärmeplan also nicht um einen nach Landesrecht erstellten Wärmeplan handelt.
Nach § 5 Abs. 2 WPG gilt, dass die Pflicht zur Durchführung einer Wärmeplanung nach den Regelungen des WPG nicht für ein beplantes Gebiet gilt, wenn am 01.01.2024 ein Beschluss oder eine Entscheidung über die Durchführung der Wärmeplanung vorliegt, spätestens bis zum Ablauf des 30.06.2026 der Wärmeplan erstellt und veröffentlicht wurde und die dem Wärmeplan zu Grunde liegende Planung mit den Anforderungen des WPG im Wesentlichen vergleichbar ist. Die wesentliche Vergleichbarkeit ist insbesondere anzunehmen, wenn die Erstellung des Wärmeplans Gegenstand einer Förderung aus Mitteln des Bundes oder eines Landes war oder nach den Standards der in der Praxis verwendeten Leitfäden erfolgt ist. In Niedersachsen dürfte dies der Fall sein, wenn Kommunen den Leitfaden der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen (KEAN) angewandt haben. Die KEAN hat bereits 2018 zur Unterstützung der Kommunen einen mehrteiligen Leitfaden „Kommunale Wärmeplanung“ verfasst, um Städten und Gemeinden mit praktischen Arbeitshilfen, Informationen zu Förderprogrammen und Praxisbeispielen aus Niedersachsen beim Aufbau einer zukunftsfähigen Wärmeversorgung zu helfen14.
Aber nicht nur Kommunen, bei denen bereits eine Wärmeplanung vorliegt oder in Aufstellung ist, sondern auch Kommunen, die noch nicht mit der Wärmeplanung begonnen haben, können den ersten Wärmeplan nach § 20 NKlimaG anstatt nach dem WPG aufstellen, wenn die oben genannten Fristen eingehalten werden. Allerdings gilt dies nur für Kommunen, in denen ein Ober- oder Mittelzentrum liegt!
Kommunen, in denen kein Ober- oder Mittelzentrum liegt, sind in Niedersachsen insoweit etwas benachteiligt, weil für diese keine landesrechtliche Regelung zur Aufstellung von Wärmeplänen besteht und daher nur die etwas strengere Ausnahmeregelung des § 5 Abs. 2 WPG greift. Es muss also am 01.01.2024 ein Beschluss oder eine Entscheidung über die Durchführung der Wärmeplanung vorgelegen haben und diese muss dann spätestens bis zum Ablauf des 30.06.2026 erstellt und veröffentlicht werden, um ihn noch nach dem NKlimaG aufstellen zu können.
Einen Wärmeplan nach § 20 NKlimaG anstatt nach dem WPG aufzustellen, dürfte deutlich einfacher sein, was man allein am Regelungsumfang des WPG (35 Paragrafen) und des NKlimaG (zwei Paragrafen) erkennen kann. Allerdings muss beachtet werden, dass bei einer ggf. notwendigen Fortschreibung des Wärmeplans die Regelungen des WPG beachten müssen (siehe unten 3.), sodass die Regelungen des WPG über die Aufstellung der Wärmepläne zumindest im Auge behalten werden sollten.
Nun zu den Regelungen des NKlimaG über die Aufstellung der Wärmepläne, die sich in § 20 Abs. 4 und 5 finden.
Im Wärmeplan sind für das Gebiet der Kommune räumlich aufgelöst (kartografisch) eine Bestandsanalyse, eine Potenzialanalyse und eine Berechnung zur Entwicklung des Gebäudewärmebedarfs und der Wärmeversorgungsstruktur bis 2030 und darüber hinaus bis 2040 mit einer treibhausgasneutralen Wärmeversorgung der Gebäude darzustellen. Außerdem sind aufgrund der kartografischen Darstellungen Handlungsstrategien zur Senkung und treibhausgasneutralen Deckung des Wärmebedarfs darzustellen sowie Maßnahmen zur Umsetzung der Handlungsstrategien zu benennen, wobei mindestens fünf Maßnahmen benannt werden sollen, mit deren Umsetzung innerhalb von fünf Jahren nach der Veröffentlichung begonnen werden soll.
Man erkennt also, dass die Vorgaben des § 20 NKlimaG für die Aufstellung der Wärmepläne sehr schlank gehalten worden sind. Damit eröffnen sich den Kommunen deutlich mehr Spielräume bei der Ausgestaltung der Wärmepläne als bei Aufstellung der Wärmepläne nach den Regelungen des WPG. Insbesondere kann damit die Wärmeplanung durch die Kommunen auch als strategisches Instrument nicht nur zur Umsetzung der Wärmewende, sondern auch zur strategischen Ausrichtung der kommunalen Unternehmen, insbesondere der Stadtwerke genutzt werden. Denn die Energie- und Wärmewende sowie die Transformation zur klimaneutralen Gesellschaft wird die klassischen Betätigungsfelder der kommunalen Unternehmen deutlich verändern und erzeugt damit große Veränderungsnotwendigkeiten mit einem enormen Finanzierungsbedarf.
Die nach § 20 Abs. 4 Nr. 1 NKlimaG zu erstellende Bestandsanalyse erfordert die Darstellung des aktuellen Wärmebedarfs oder -verbrauchs der Gebäude und der damit verbundenen Treibhausgasemissionen auf Grundlage einer systematischen und qualifizierten Datenerhebung. Die Kommunen haben also die Wahl, entweder den Wärmeverbrauch darzustellen oder aber den Wärmebedarf. Eine große Hilfe kann für die Kommunen hierbei die Wärmebedarfskarte sein, die die KEAN für ganz Niedersachsen erstellt hat und die die Kommunen bei der KEAN anfordern können. Außerdem muss die Darstellung Informationen zu den vorhandenen Gebäudetypen und den Baualtersklassen sowie die aktuelle Wärmeversorgungsstruktur enthalten.
Die nach § 20 Abs. 4 Nr. 2 NKlimaG zu erstellende Potenzialanalyse muss die Potenziale zur Senkung des Wärmebedarfs und zur treibhausgasneutralen Versorgung der Gebäude mit Wärme aus erneuerbaren Energien einschließlich Geothermie und Kraft-Wärme-Kopplung sowie zur Versorgung der Gebäude mit Wärme aus Abwärme darstellen. Gerade bei der Potenzialanalyse sollten die Kommunen, die in der Regel die Wärmepläne nicht selbst, sondern durch Externe aufstellen lassen werden, die strategischen Möglichkeiten der Wärmeplanung auch zur Entwicklung der eigenen kommunalen Unternehmen im Auge haben. Dafür ist es sinnvoll, sich zum einen die Finanzströme zwischen den Kommunen und ihren kommunalen Unternehmen anzuschauen, aber auch mit den kommunalen Unternehmen zu sprechen, wo derzeit deren Überschüsse erwirtschaftet werden und wo in Zukunft Betätigungsfelder mit Gewinnchancen gesehen werden. Viele kommunale Unternehmen bieten den Kommunen auch an, als Dienstleister die Wärmepläne aufzustellen. Dann ist natürlich sichergestellt, dass diese strategischen Überlegungen in die Wärmeplanung und auch die Potenzialanalyse einfließen.
Denn entgegen der ersten Vorstellungen des BMWK von einer all-electric-world wird die Wärme- und Energiewende sich aus diversen verschiedenen Modulen zusammensetzen und damit gerade für Kommunen und ihre kommunalen Unternehmen deutlich mehr Betätigungsfelder bieten.
So ist zu einen an Biogas in Gasnetzen zu denken. Ein großer niedersächsischer Verteilnetzbetreiber hat derzeit Anschlussbegehren von Biogasanlagen an sein Gasnetz, mit denen ca. ¼ des Gasverbrauchs im Netz gedeckt werden könnte und bei einem mittelgroßen Verteilnetzbetreiber übersteigen die Mengen aus den Anschlussbegehren sogar den Gasverbrauch in diesem Verteilnetz. Auch werden entgegen der Auffassung des ehemaligen Staatssekretärs im BMWK, Partick Graichen, die Gasnetze nicht komplett überflüssig und müssen zurückgebaut werden15. Vielmehr wird auch die Option zu untersuchen sein, inwieweit die bestehenden Gasnetze zu Wasserstoffnetzen umgenutzt werden können. Insbesondere Kommunen, die in der Nähe des geplanten Wasserstoffkernnetzes16 liegen, aber nicht nur diese, sollten das Potenzial eines Wasserstoffnetzversorgunsgsgebietes in Betracht ziehen.
Auf Basis der Bestands- und der Potenzialanalyse sind dann Berechnungen darüber anzustellen, wie sich zum einen der Wärmebedarf der Gebäude und die Wärmeversorgungsstruktur bis zum Jahr 2030 entwickeln wird und wie sich zum anderen der Wärmebedarf der Gebäude und die Wärmeversorgungsstruktur entwickeln müssen, um bis zum Jahr 2040 eine treibhausgasneutrale Wärmeversorgung der Gebäude zu erreichen.
Auf Grundlage der Darstellungen der Bestandsanalyse, der Potenzialanalyse und der Berechnung nach § 20 Abs. 4 NKlimaG sind dann im Wärmeplan Handlungsstrategien der Kommune zur Senkung und treibhausgasneutralen Deckung des Wärmebedarfs der Gebäude darzustellen sowie Maßnahmen zur Umsetzung der Handlungsstrategien zu benennen. Außerdem soll die Kommune (gebundenes Ermessen) mindestens fünf Maßnahmen benennen, mit deren Umsetzung innerhalb der auf die Veröffentlichung folgenden fünf Jahre begonnen werden soll.
Für die Umsetzung der Wärmeplanung weist das Land den Kommunen gemäß § 20 Abs. 6 NKlimaG für die Erstaufstellung in den Jahren 2024 bis 2026 jährlich einen Betrag in Höhe von 16 000 € zuzüglich 0,25 € je Einwohnerin oder Einwohner und für die Fortschreibung ab dem Jahr 2027 jährlich einen Betrag in Höhe von 3000 € zuzüglich 0,06 € je Einwohnerin oder Einwohner zu.
Die aus Datenschutzgründen notwendigen Regelungen zur Datenbeschaffung und -verarbeitung durch die Kommunen für die Wärmeplanung sind detailliert in § 21 NKlimaG geregelt.
Den gesamten Beitrag entnehmen Sie den NdsVBl. Heft 6/2024.


