Sozialgerichtstag 2024: Neue Zeiten, Neues Sozialrecht
Ein Blick auf SGB II, SGB III und SGB XII - Teil 1
Sozialgerichtstag 2024: Neue Zeiten, Neues Sozialrecht
Ein Blick auf SGB II, SGB III und SGB XII - Teil 1
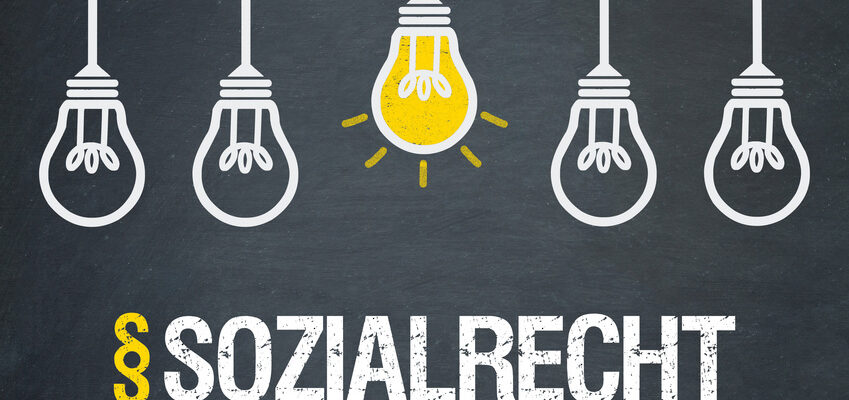
Unter dem Generalthema „Neue Zeiten – Neues Sozialrecht“ kamen am 7. und 8. November 2024 über 200 Teilnehmer beim 9. Deutschen Sozialgerichtstag in Kassel zusammen, um sich in neun Kommissionen zu aktuellen Entwicklungen im Sozialrecht fachlich auszutauschen. Die seit den Anfangszeiten des Sozialgerichtstags in den 2000er Jahren zahlenmäßig traditionell größte Kommission war abermals die des SGB II/SGB III/SGB XII mit ihren Themenkomplexen „Passive Leistungen: Existenzsichernde Leistungen zwischen Menschenwürde und Lohnabstandgebot“ und „Wie kann Arbeitsmarktintegration gelingen?“.
Zu Beginn referierte Frau Prof. Dr. Andrea Kießling, Universität Frankfurt a.D., zum Thema „Der verfassungsrechtliche Rahmen für existenzsichernde Leistungen“. Anspruchsgrundlage stellt Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 1 GG dar, wonach die Mittel zu gewährleisten sind, die zur Sicherung des physischen und des soziokulturellen Existenzminimums unbedingt erforderlich sind. Hingegen gebe es keine Grundlage für darüber hinausgehende Ansprüche auf Leistungen zur Ermöglichung der durch die einzelnen Grundrechte garantierten Freiheiten. Bspw. gebe es kein „Recht mittelloser Zugangsberechtigter auf Ermöglichung eines Hochschulstudiums durch Gewährleistung der dafür notwendigen existenzsichernden Leistungen“ (BVerfG, Beschluss vom 23. September 2024 – 1 BvL 9/21). Anspruchsvoraussetzung ist die Bedürftigkeit (Nachranggrundsatz), d. h., es besteht die Pflicht zum vorrangigen Einsatz eigener verfügbarer Mittel und ggf. von Mitteln Dritter sowie die Pflicht, an der Überwindung der Hilfebedürftigkeit selbst aktiv mitzuwirken oder die Bedürftigkeit gar nicht erst eintreten zu lassen (BVerfG, Urteil vom 5. November 2019 – 1 BvL 7/16). Als Rechtsfolge werden Leistungen im Umfang der Bedürftigkeit gewährt, wobei dies durch einen einfach-rechtlichen Anspruch zu konkretisieren ist. Hier gibt es einen Spielraum des Gesetzgebers, denn Höhe und Berechnungsmethode sind nicht durch das Grundgesetz vorgegeben. Beim Schlüsselbegriff „Bedarf“ werden die tatsächlichen Verhältnisse beurteilt, eine wertende Einschätzung des notwendigen Bedarfs vorgenommen sowie die unterschiedlichen Bedarfe der verschiedenen Personengruppen ermittelt. Die Berechnungsmethode kann frei gewählt werden, solange im Ergebnis das Existenzminimum gesichert ist, also die Bedarfe gedeckt werden (BVerfG, Beschluss vom 23. Juli 2014 – 1 BvL 10/12, 1 BvL 12/12, 1 BvL 1691/13). Verfassungsrechtliche Vorgaben für die Berechnungsmethode sind die Notwendigkeit regelmäßiger Neuberechnungen und Fortschreibungen, die zeitnahe Berücksichtigung von Preissteigerungen durch die Berechnungsmethode und ggf. die Erforderlichkeit eines zusätzlichen Eingreifens bei unvermittelt auftretenden extremen Preissteigerungen.
Nach der bereits o.g. Entscheidung des BVerfG vom 5. November 2019 (1 BvL 7/16) müssen die Mitwirkungspflichten der Betroffenen verhältnismäßig sein und dürfen nichts Unzumutbares von ihnen verlangen. Die Sanktionen bei Missachtung der Mitwirkungspflichten müssen verhältnismäßig sein, wobei hier ein strenger Maßstab anzulegen ist. Es geht nicht um die repressive Ahndung von Fehlverhalten, sondern die Sanktionen müssen darauf ausgerichtet sein, „dass Mitwirkungspflichten erfüllt werden, die gerade dazu dienen, die existenzielle Bedürftigkeit zu vermeiden oder zu überwinden“. Es seien tragfähige Erkenntnisse notwendig, um insbesondere die Eignung der Sanktionen zu belegen. Eine Leistungsminderung muss durch eigenes Verhalten abgewendet werden können. Eine Minderung in Höhe von 100 % der Leistung sei nicht von vornherein verfassungswidrig; Hier gibt Rn. 209 im Urteil des BVerfG vom 5. November 2019 (s.o.) Aufschluss: „Bei willentlicher Weigerung der Aufnahme einer angebotenen zumutbaren Arbeit, die die menschenwürdige Existenz tatsächlich und unmittelbar selbst sicherte, ist die Situation im Ausgangspunkt derjenigen vergleichbar, in der keine Bedürftigkeit vorliegt, weil Einkommen oder Vermögen verfügbar sind.“ Es tritt also die Fiktion der Nichtbedürftigkeit ein und die verfassungsrechtlichen Anspruchsvoraussetzungen liegen nicht vor. Im März 2024 gab es in der öffentlichen Diskussion die „Totalverweigerer“: Nach § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB II wurde eine nach § 10 SGB II zumutbare Arbeit nicht aufgenommen. Als Sanktion war gem. § 31a Abs. 7 SGB II eine Minderung der Leistung in Höhe von 100 % vorgesehen bei willentlicher Verweigerung der Aufnahme einer zumutbaren Arbeit.
Als weiteres Problemfeld wurde das Thema „Schwarzarbeit“ beschrieben, das in § 31 Abs. 2 Nr. 5 SGB II Eingang finden sollte. Bei einer rechtskräftigen Entscheidung über eine Ordnungswidrigkeit oder Straftat im Zusammenhang mit Schwarzarbeit sollten Sanktionen in Höhe von sofort 30 % Leistungsminderung eintreten. Diese geplante Regelung ist allerdings nicht Gesetz geworden, weil sie repressiv war und keine Ausrichtung am Bedarf beinhaltete sowie keine Überwindung der Bedürftigkeit zum Ziel hatte.
Gründe der Politik für die Verschärfung von Sanktionen seien allgemein das Thema „Solidarität“ und Einsparungen wegen der angespannten Haushaltslage. Nach der oben bereits genannten Entscheidung des BVerfG vom 23. September 2024 (Beschluss, Az. 1 BvL 9/21) gebe es „faktische Grenzen“: Aus der Aufgabe des Staates gem. dem Sozialstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 1 GG, für eine gerechte Sozialordnung zu sorgen, ergebe sich „auch aus der Notwendigkeit, die für die Verwirklichung einer gerechten Sozialordnung unabdingbare Bereitschaft der Steuer- und Beitragszahler zur Solidarität mit sozial Benachteiligten zu erhalten.“


