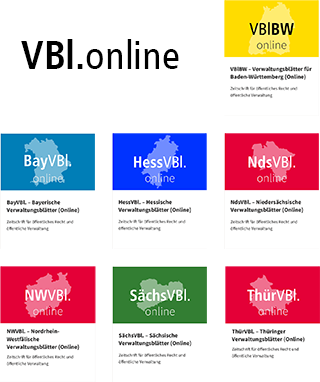Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur
Beihilferechtliche Aspekte für Elektrofahrzeuge
Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur
Beihilferechtliche Aspekte für Elektrofahrzeuge

Zum 1. August 2025 überschritt Deutschland die Marke von 175.000 öffentlich zugänglichen Ladepunkten. Im Ladesäulenregister sind 132.994 Normalladepunkte und 42.147 Schnellladepunkte verzeichnet. Insgesamt steht damit eine Anschlussleistung von 7,01 GW bereit. Dieser kontinuierliche Zuwachs zeigt den Fortschritt beim Infrastrukturausbau. Die steigenden Zulassungszahlen für Elektrofahrzeuge machen jedoch zugleich die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen deutlich.
Die Elektromobilität ist ein zentraler Faktor der Energiewende, auch wenn die Entwicklung – zumindest bisher – nicht ganz den Erwartungen der Automobilindustrie und der Politik entspricht. Es ist daher weiterhin essenziell, Standorte netzdienlich zu planen, Engpässe entlang von Verkehrsachsen zu schließen und die Infrastruktur auszubauen, um den Nutzern den Umstieg auf die Elektromobilität zu erleichtern. Wo private Investitionen ausbleiben oder zu langsam erfolgen, kann und sollte der Staat daher fördern – allerdings nur innerhalb der Vorgaben des EU-Beihilfenrechts.
Der unionsrechtliche Beihilfenbegriff und Anmeldepflicht
Eine staatliche Maßnahme gilt nur dann als Beihilfe gem. Art. 107 AEUV, wenn sie die folgenden fünf Kriterien kumulativ erfüllt:
- Die Maßnahme begünstigt ein spezifisches Unternehmen.
- Sie wird aus öffentlichen Mitteln finanziert.
- Sie begünstigt das Unternehmen.
- Sie ist selektiv und betrifft nur bestimmte Unternehmen oder Branchen.
- Sie kann den Wettbewerb verzerren und den Handel zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtigen.
Staatliche Fördermaßnahmen, die als Beihilfen eingestuft werden, müssen grundsätzlich vor ihrer Gewährung bei der Europäischen Kommission angemeldet und von dieser genehmigt werden. Diese Notifizierungspflicht soll sicherstellen, dass die Förderung mit dem EU-Beihilferecht vereinbar ist. Die Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung („AGVO“) stellt jedoch Beihilfen von dieser Anmeldepflicht frei, die bestimmte, in der AGVO festgelegte Kriterien erfüllen und daher als mit dem Binnenmarkt vereinbar angesehen werden.
Art. 36a AGVO und Ladeinfrastruktur
Durch die jüngsten Anpassungen der AGVO können Lade- und Tankinfrastruktur nach Art. 36a AGVO gefördert und deren Aufbau vereinfacht und beschleunigt werden. Dazu wurden die Anforderungen gelockert und der Anwendungsbereich erweitert:
- Anwendungsbereich und beihilfefähige Kosten: Die Regelungen erstrecken sich auf alle Arten von Ladeinfrastrukturen, nicht nur auf öffentlich zugängliche. Dies öffnet die Tür für die Förderung von Ladeinfrastruktur innerhalb geschlossener Betriebe, was insbesondere für Unternehmen von Bedeutung ist. Beihilfefähige Kosten umfassen gemäß Art. 36a Abs. 3 AGVO etwa die Kosten für die Infrastruktur selbst, Installation von Stromkabeln und Transformatoren sowie Baumaßnahmen und Genehmigungen. Zusätzlich können sie unter bestimmten Voraussetzungen Investitionskosten für erneuerbare Energieerzeugung oder -speicherung am Standort der Infrastruktur abdecken.
- Energiequellen: Der Fokus liegt auf Ladeinfrastruktur, die Strom und Wasserstoff bereitstellt. Ein besonderer Schwerpunkt wird auf die Förderung erneuerbarer Energiequellen gelegt. Spätestens im Jahr 2035 sollten die Voraussetzungen für die Nutzung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energiequellen gegeben sein.
- Wettbewerbliches Ausschreibungsverfahren: Die Freistellung mit einer hohen Beihilfenintensität (bis zu 100 % der beihilfefähigen Kosten) erfordert grundsätzlich ein wettbewerbliches Vergabeverfahren (vgl. Teil 2 des Beitrags). Eine Beihilfenregelung ohne Ausschreibungsverfahren ermöglicht je nach Unternehmensgröße eine Beihilfenintensität von 20-50 %. Das Vergabeverfahren muss dabei bestimmte Anforderungen erfüllen, u.a. die Festlegung von mindestens 70 % der Auswahlkriterien basierend auf der Höhe der Beihilfe im Verhältnis zum Beitrag des Vorhabens zu den Umweltzielen. Die restlichen 30 % der Auswahlkriterien und einige andere Aspekte lassen den staatlichen Fördergebern einen gewissen Gestaltungsspielraum.
- Schwellenwerte und Ausnahmen: Die Obergrenze für die Förderung ohne vorherige Anmeldung wurde bei der letzten Änderung der AGVO erhöht, was bedeutet, dass größere Projekte einfacher und schneller umgesetzt werden können. Die Anmeldeschwelle beträgt nun 30 Mio. EUR je Unternehmen und Projekt bzw. bei Beihilfenregelungen ein durchschnittliches jährliches Budget von 300 Mio. EUR.
- Diskriminierungsfreier Zugang und Marktpreis bei öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur: Für öffentlich zugängliche Infrastrukturen ist es erforderlich, dass der Zugang diskriminierungsfrei erfolgt (vgl. auch Teil 3 des Beitrags) und die Preise dem Marktwert entsprechen. Dies soll verhindern, dass Beihilfen indirekt und mittelbar an bestimmte Nutzergruppen gewährt werden.
- Nachweis der Erforderlichkeit: In der Regel muss nachgewiesen werden, dass die betreffenden Investitionen nicht auch innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten der Beihilfemaßnahme unter Marktbedingungen getätigt würden. Diese besondere Anforderung gilt ausschließlich für öffentlich zugängliche Ladeinfrastrukturen.
- Betrieb durch Dritte: Wird die Infrastruktur nicht vom Beihilfeempfänger selbst, sondern von einem Dritten betrieben, so muss die Vergabe der Konzessionen oder sonstigen Aufträge in einem offenen, transparenten und diskriminierungsfreien Verfahren erfolgen. Damit wird sichergestellt, dass dem Betreiber keine unzulässigen indirekten Beihilfen gewährt werden und die Gegenleistung den Marktbedingungen entspricht.
Fazit
Die Förderung der Errichtung von Ladeinfrastruktur unterliegt komplexen rechtlichen Anforderungen. Die staatliche Förderung ist u.U. möglich und notwendig, erfordert aber eine sorgfältige Abstimmung mit dem EU-Recht. Die jüngsten Änderungen der AGVO vereinfachen die Verfahren zur Beantragung von Beihilfen, um eine schnelle und effiziente Umsetzung von Ladeinfrastruktur zu fördern. Dies unterstützt die europäische Initiative zur Entwicklung einer nachhaltigen Verkehrsinfrastruktur.