Verwaltungsrecht Tagungsbericht
30. Baden-Württembergischer Verwaltungsrechtstag
Verwaltungsrecht Tagungsbericht
30. Baden-Württembergischer Verwaltungsrechtstag
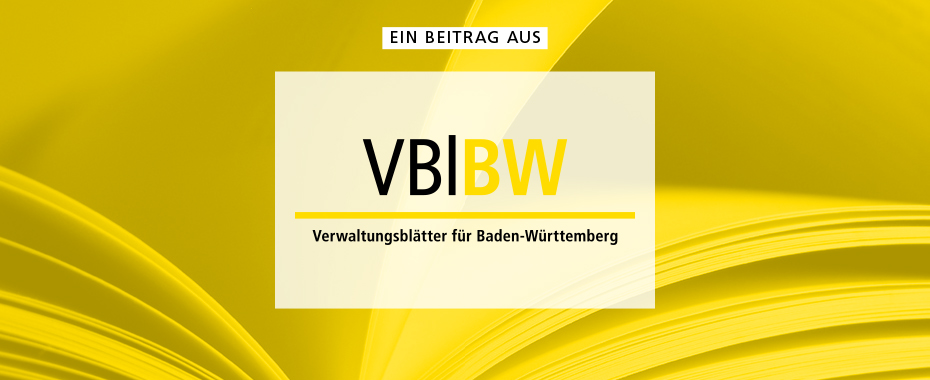
Die Arbeitsgemeinschaft Verwaltungsrecht im Deutschen Anwaltverein lud am 04.07.2024 zum 30. Baden-Württembergischen Verwaltungsrechtstag nach Stuttgart ein. Die Vorsitzende, Rechtsanwältin Alexandra Friedrich, begrüßte 180 Teilnehmende aus Rechtsanwaltschaft, Justiz und öffentlicher Verwaltung zu diesem Jubiläum.
I. Grußworte und Berichte
In ihrem Grußwort legte Friedrich den Schwerpunkt auf das 30-jährige Jubiläum des Verwaltungsrechtstags und erinnerte an das gleichzeitige 75-jährige Bestehen des Grundgesetzes. Auch Justizministerin Marion Gentges sah den Verwaltungsrechtstag ganz im Zeichen des 75-jährigen Verfassungsjubiläums und nutzte die Gelegenheit, mit dem Öffentlichkeitsbeteiligungsprojekt „Zukunftsgerichtet” sowie der Bündelung von Maßnahmen zur Beschleunigung von asylrechtlichen Gerichtsverfahren zwei aktuelle Kampagnen ihres Ministeriums vorzustellen. Den jährlichen „Werkstattbericht des VGH-Präsidenten” erstattete Prof. Dr. Malte Graßhof, Präsident des Verfassungsgerichtshofs und des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg, der einen Blick zurück auf die Arbeit der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Baden-Württemberg in den vergangenen Jahren, aber auch auf aktuelle Gesetzesvorhaben und zukünftige Herausforderungen warf. Bezogen auf den Verwaltungsrechtstag hob Herr Prof. Graßhof die Bedeutung des guten fachlichen Austauschs über wichtige verwaltungsrechtliche und in der Praxis relevante Themen hervor. Der Verwaltungsrechtstag sei ein Ort des vertrauensvollen Miteinanders, das nicht mehr selbstverständlich sei. Anknüpfend daran unternahm Dr. Dirk Rodewoldt, Fachanwalt für Verwaltungsrecht und einer der Gründungsväter der Arge Verwaltungsrecht in Baden-Württemberg, einen humorvollen Rückblick auf „30 Jahre Verwaltungsrechtstag”. Er schloss, indem er sich bei den damaligen und heutigen Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofs bedankte, ohne die der Verwaltungsrechtstag in seiner heutigen Form undenkbar sei.
II. Fachreferate
1. 75 Jahre Grundgesetz – Demokratie und Rechtsstaat in guter Verfassung? Peter Müller, Richter am Bundesverfassungsgericht a. D. und Ministerpräsident a. D.
Den Auftakt zum fachlichen Programm machte Herr Peter Müller, Richter am Bundesverfassungsgericht a. D. und Ministerpräsident a. D. mit einem Thema, das bereits die Grußworte geprägt hatte: „75 Jahre Grundgesetz – Demokratie und Rechtsstaat in guter Verfassung?”. Zu Beginn seines Vortrags warf er einen Blick auf die Geschichte des Grundgesetzes, das zunächst nur eine Übergangslösung sein sollte. Als Grund für die Langlebigkeit dieses so gedachten „Transitoriums” sah Müller nicht nur die Bescheidenheit des Regelungsanspruchs, sondern auch das klare Leitbild. Das Grundgesetz stellte einen Gegenentwurf zum Nationalsozialismus dar und sollte ein Bollwerk gegen Faschismus und Totalitarismus aufbauen.
Ein Pfeiler dieses Bollwerks sei die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die das Bekenntnis zur Menschenwürde sowie die Grundsätze der Demokratie und des Rechtsstaats umfasse (zweites sogenanntes „NPD-Urteil”, BVerfG, Urt. v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13). Durch den Fokus auf die Menschenwürde stelle das Grundgesetz bewusst das Individuum in den Mittelpunkt und verwerfe zugleich jegliche Vorstellung von einer „Volksgemeinschaft”. Jede Unterscheidung nach der ethnischen Zugehörigkeit, etwa eine Unterteilung in „Passdeutsche” und „Biodeutsche”, stehe daher in klarem Widerspruch zu Art. 1 Abs. 1 des Grundgesetzes.
Als zweiten Pfeiler einer langlebigen Verfassung entwerfe das Grundgesetz eine wehrhafte Demokratie, die gegenüber Feinden der Demokratie gerade keine unbedingte Toleranz walten lasse. Neben der Ewigkeitsklausel nach Art. 79 Abs. 3 Grundgesetz sowie dem Widerstandsrecht nach Art. 20 Abs. 4 Grundgesetz werde diese Wehrhaftigkeit insbesondere durch das Bundesverfassungsgericht sichergestellt. Dieses gehöre zu den stärksten Verfassungsgerichten der Welt mit der Möglichkeit, dem demokratischen Gesetzgeber „in den Arm zu fallen”. Dabei habe das Bundesverfassungsgericht jedoch stets den Balanceakt zu wahren, nur Hüter der Verfassung, nicht Gestalter der Politik zu sein. Gleichzeitig betont Müller, dass die dem Staat zur Verfügung stehenden Instrumente nur als schärfstes Schwert einzusetzen seien. Das Grundgesetz setze auf die Kraft der geistigen Auseinandersetzung, in der Demokraten die Demokratie „mit offenem Visier” verteidigten. Aus diesem Grund seien etwa die Anforderungen an ein Parteiverbotsverfahren sehr hochgesteckt.
Insgesamt habe das Grundgesetz sich bewährt und sei Grundlage für die besten Jahre Deutschlands. Dennoch herrsche keine Feierlaune, sondern die Auseinandersetzungen nähmen zu, und ein Auseinanderdriften der Gesellschaft sei zu beobachten. In Bezug auf die Ausgangsfrage stellt er daher fest, dass Deutschland zwar eine gute Verfassung habe, insgesamt aber nicht unbedingt „in guter Verfassung” sei.
Dabei beobachtet Müller einen weltweiten Trend, nach dem Demokratie und Rechtsstaat zunehmend unter Druck gerieten. Selbstkritisch sei aber zu beobachten, dass auf Seiten des Staates durchaus Vollzugsdefizite vorlägen. Dies betreffe insbesondere das Asyl- und das Strafrecht. Es gebe aber durchaus Möglichkeiten, der drohenden Erosion der Demokratie entgegenzuwirken:
Müller spricht insoweit zunächst ein mögliches Verbotsverfahren gegen die AfD an, wie es immer wieder diskutiert werde. In einem solchen Verfahren müsse nachgewiesen werden, dass die Partei als Ganzes auf die Bekämpfung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ausgerichtet sei. Es genüge gerade nicht, dies einzelnen Parteimitgliedern oder Teilen der Partei nachzuweisen. Dies werde der AfD deutlich schwieriger nachzuweisen sein als in der Vergangenheit der NPD, die sich in ihrem Parteiprogramm offen gegen die Demokratie gestellt habe. Zudem sei zu erwarten, dass ein solches Verfahren geraume Zeit in Anspruch nehmen werde. Das zweite NPD-Verbotserfahren, das Müller als Berichterstatter vorbereitet hatte, dauerte sechs Jahre. Aus diesen Gründen hält Müller ein Parteiverbotsverfahren für wenig erfolgversprechend. Er setzt stattdessen mit dem Grundgesetz auf die Kraft des Arguments und der geistigen Auseinandersetzung.
Ein vorzugswürdiger Lösungsansatz sei die Erhöhung der Resilienz des Bundesverfassungsgerichts, auch wenn die Politik diese Frage früher hätte angehen müssen. Müller stellt fest, dass das Grundgesetz nur wenige Regelungen zum Schutz des Bundesverfassungsgerichts vorsieht. Weder die Zahl der Richter und Senate noch die Amtszeit der Richter oder ihre fehlende Wiederwählbarkeit seien grundgesetzlich abgesichert. Eine Möglichkeit, Abhilfe zu schaffen, sieht Müller darin, Änderungen des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes zustimmungspflichtig zu machen.
Nicht nur die Demokratie sieht Müller unter Druck, sondern auch den Rechtsstaat. Ein Grund hierfür sei die zunehmende Regelungsdichte. Auch die vermehrte Bereitschaft, Gesetze für den vermeintlich „guten Zweck” zu brechen, sei besorgniserregend. Der Grundsatz „Not kennt kein Gebot” habe in einem Rechtsstaat keinen Platz. Vielmehr bedeute ziviler Ungehorsam gerade, Gesetze zwar zu brechen, aber auch die Bereitschaft, die Konsequenzen zu tragen.
Müller schloss mit einem Aufruf an die Anwesenden, sich für die Demokratie einzusetzen, und mit der Feststellung, dass die Weimarer Republik nicht aufgrund ihrer Verfassung gescheitert sei, sondern aufgrund fehlenden Engagements der Demokraten.
Im Anschluss entspann sich eine lebhafte Diskussion unter der Moderation von Vizepräsidentin des Verwaltungsgerichts Karlsruhe, Frau Dr. Isabel Röcker, u. a. zu den Gefahren für den Supreme Court in den USA sowie über den Umgang mit sogenannten „Reichsbürgern” in der Verwaltungspraxis.
2. Generative Sprachmodelle in der Rechtspraxis – Grundlagen, Anwendungen, Herausforderungen Prof. Dr. Matthias Grabmair, Professor für Legal Tec an der Technischen Universität München
Grabmair begann seinen Vortrag mit einer Erklärung der grundlegenden Funktionsweise generativer Sprachmodelle. Er betonte, dass diese Modelle durch das Training mit großen Textmengen, häufig aus dem Internet, entwickelt werden, wobei das „Lernen” ausschließlich aufgrund der Wahrscheinlichkeit erfolge, mit der bestimmte Wörter auf andere folgen. Als praktische Anwendungsbeispiele für generative Künstliche Intelligenz (KI) in der Rechtsanwendung nannte Grabmair überblicksartig die Erstellung von Timelines aus bestehenden Akten und die Extrahierung sowie die übersichtliche Darstellung der wesentlichen Argumente der Parteien.
Ein zentrales Problem bestehe derzeit noch in der „Halluzination” der Modelle, bei der Informationen ausgegeben würden, die nicht auf tatsächlichen Quellen basieren. Grund hierfür sei, dass die bestehenden Modelle keine Wissensbasen darstellten, sondern lediglich auf Wahrscheinlichkeiten beruhten. Die Weiterentwicklung der Modelle ziele darauf ab, dieses Problem zu lösen, bspw. durch die Kombination mit kuratierten Dokumentsammlungen. Eine weitere Herausforderung in Deutschland stelle die geringere Verfügbarkeit juristischer Texte im Vergleich zu den USA dar, wodurch das „Lernen” der Systeme erschwert werde. Trotz Fortschritten in diesem Bereich wiesen auch mit Wissensdatenbanken verknüpfte Modelle eine Fehlerquote von etwa 1:6 auf. Dies hänge jedoch auch mit systematischen Problemen der juristischen Recherche zusammen. Auch der Gutachtenstil und die juristische Subsumtion würden von generativer KI derzeit noch nicht vollständig beherrscht.
Grabmair stellte in diesem Zusammenhang das Modell FRAUKE aus Hessen vor. Dieses Modell unterstütze schon jetzt bei der Urteilsfindung in Verfahren über Fluggastrechte. Das Modell erzeuge keine Halluzinationen, sei dafür jedoch wartungsintensiver als wahrscheinlichkeitsbasierte Modelle. Für Gerichte sieht Grabmair die Schwierigkeit, dass Entscheidungen im Ergebnis weiterhin von Menschen getroffen werden müssten und dem Einsatz von KI aus diesem Grund Grenzen gesetzt seien. Die Anwaltschaft könne KI hingegen jetzt schon freier anwenden. Gerade Aufgaben, die für Menschen zeitaufwändig seien, aber deren Richtigkeit im Anschluss ohne großen Aufwand überprüfbar ist, könnten gut an eine KI ausgelagert werden. Grabmair betonte dabei das Spannungsfeld, in dem generative KI zwar Experten unterstützen könne, im schlechtesten Fall jedoch auch zu einer Erosion von Wissen führen könnte. Zudem müssten die Prozessordnungen in diesem Zusammenhang neu gedacht werden, um den Einsatz von KI zu erleichtern und den möglichen Nutzen zu entfalten.
In der anschließenden Diskussion unter der Moderation von Dr. Hansjörg Melchinger, Fachanwalt für Verwaltungsrecht, wurde die mangelnde Datenbasis in der deutschen Rechtsprechung thematisiert, wodurch eine mögliche Fehlerfortpflanzung begünstigt werden könnte. Auch die Möglichkeit, durch KI Abwägungsentscheidungen zu treffen, wurde kritisch betrachtet. Obwohl mit verschiedenen Lösungsansätzen experimentiert werde, sei nicht auszuschließen, dass ein Modell ideologisch vorbelastet sein könnte.
3. Die Normenkontrolle – Ein Fremdkörper in der VwGO? Prof. Dr. Christoph Külpmann, Vorsitzender Richter am Bundesverwaltungsgericht
Zunächst stellte Külpmann fest, dass trotz der vermeintlichen Verschiedenheit zwischen der Normenkontrolle und anderen Verfahrensarten große Parallelen in der Verfahrensführung sowie den maßgeblichen rechtlichen Fragen bestehen.
Die abstrakte Normenkontrolle sei seit ihrer Einführung in ihren Kernelementen unverändert: Eine Klagebefugnis sei nicht erforderlich und das stattgebende Urteil über die Norm allgemeinverbindlich. Grund hierfür sei die hehre Vorstellung des Gesetzgebers von einer vollständigen Rechtmäßigkeitsprüfung der Norm durch die Gerichte. Diese finde sich in der Gerichtspraxis jedoch nicht wieder. Vielmehr klagten gerade Private, die ein subjektives Interesse am Ausgang des Verfahrens hätten und denen es nicht darum gehe, die Rechtmäßigkeit einer Norm abstrakt prüfen zu lassen. Allein daraus ergebe sich eine gewisse faktische Nähe zu anderen Klagearten.
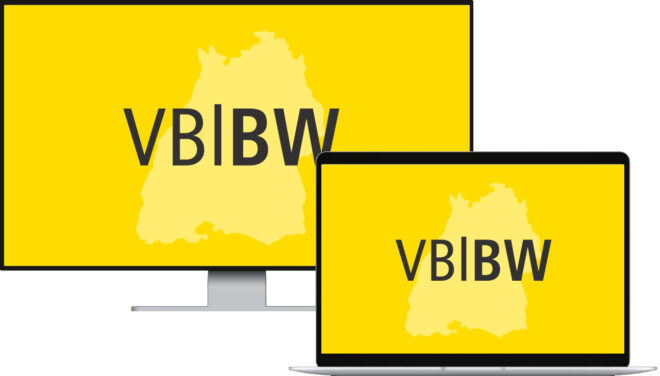 Külpmann stellte zudem fest, dass die zur Prüfung gestellten Normen zum ganz überwiegenden Teil Satzungen nach dem BauGB seien, also eher „atypische” Normen. Gerade vorhabenbezogene Bebauungspläne seien eher dem Verwaltungsakt vergleichbar als der Landesverordnung, die der Gesetzgeber bei der Regelung der Normenkontrolle wohl vor Augen gehabt habe. Die Anwendung des Normenkontrollverfahrens auf Bebauungspläne sei problematisch, weil bei Kommunen der Eindruck entstehen kann, dass aus marginalen Gründen ganze Bebauungspläne scheiterten. Denn die Teilnichtigkeit führe bei Normen, also auch bei Bebauungsplänen, regelmäßig zur Gesamtnichtigkeit. Dies sei besonders ärgerlich, wenn ein Bebauungsplan allein aufgrund von einzelnen Verfahrensfehlern aufgehoben würde. Der Bebauungsplan im Übrigen werde in diesen Fällen regelmäßig nicht auf Rechtmäßigkeit geprüft. Behebe die Gemeinde den beanstandeten Fehler in einem ergänzenden Verfahren, könne der geänderte Bebauungsplan dennoch aufgrund eines anderen, im ersten Verfahren nicht durch das Gericht beanstandeten, Grundes nichtig sein.
Külpmann stellte zudem fest, dass die zur Prüfung gestellten Normen zum ganz überwiegenden Teil Satzungen nach dem BauGB seien, also eher „atypische” Normen. Gerade vorhabenbezogene Bebauungspläne seien eher dem Verwaltungsakt vergleichbar als der Landesverordnung, die der Gesetzgeber bei der Regelung der Normenkontrolle wohl vor Augen gehabt habe. Die Anwendung des Normenkontrollverfahrens auf Bebauungspläne sei problematisch, weil bei Kommunen der Eindruck entstehen kann, dass aus marginalen Gründen ganze Bebauungspläne scheiterten. Denn die Teilnichtigkeit führe bei Normen, also auch bei Bebauungsplänen, regelmäßig zur Gesamtnichtigkeit. Dies sei besonders ärgerlich, wenn ein Bebauungsplan allein aufgrund von einzelnen Verfahrensfehlern aufgehoben würde. Der Bebauungsplan im Übrigen werde in diesen Fällen regelmäßig nicht auf Rechtmäßigkeit geprüft. Behebe die Gemeinde den beanstandeten Fehler in einem ergänzenden Verfahren, könne der geänderte Bebauungsplan dennoch aufgrund eines anderen, im ersten Verfahren nicht durch das Gericht beanstandeten, Grundes nichtig sein.
Allerdings sieht Külpmann Anzeichen der Annäherung der Normenkontrolle zu den übrigen Verfahren. Inzwischen bestehe die Möglichkeit, Betroffene zur Normenkontrolle beizuladen, und auch die Antragsbefugnis sei gestärkt worden. Die Rechtsprechung zum fehlende Rechtsschutzbedürfnis, wenn ein Bebauungsplan bereits vollständig vollzogen ist (BVerwG, Beschl. v. 25.02.2015 – 4 VR 5.14), oder der von der Rechtsprechung angewendete Maßstab für § 47 Abs. 6 VwGO für die Abwägung im Eilverfahren (BVerwG, Beschl. v. 16.05.2023 – 3 CN 5.22) zeigten eine Anlehnung an subjektive Verfahren.
Külpmann folgerte, dass ein gesondertes Verfahren für Normen nach dem BauGB den Normen besser gerecht werden könne. In diesem könnte etwa eine Begründungsfrist gelten. Zudem könnten diese atypischen Normen tatsächlich umfassend auf ihre Rechtmäßigkeit geprüft werden, so dass auch einem abweisenden Urteil Rechtskraft zukommen könne im Sinne einer „doppelten Rechtskraft”. Die derzeit möglichen „Beanstandungsschleifen”, in denen die Gemeinde jeweils einzelne Fehler behebt, wären dann nicht mehr zu befürchten. Gleichzeitig verneinte Külpmann die Frage, ob auch eine Normenkontrolle gegen untergesetzliche Normen des Bundesrechts sinnvoll wäre. Es wäre der Rechtssicherheit nicht zuträglich, wenn etwa gegen die StVO oder die verschiedenen Verordnungen nach dem BImSchG ein Verfahren mit quasi unbeschränkter Antragsbefugnis zulässig wäre.
In der nachfolgenden Diskussion unter der Moderation von Dr. Maria Marquard, Fachanwältin für Verwaltungsrecht, wurde lebhaft diskutiert, inwieweit das Problem mehrfacher Beanstandungsschleifen bereits derzeit durch „Segelanweisungen” der Gerichte gemildert werden könne. Zudem wurde angemerkt, dass in den letzten Jahren gerade am Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg nicht Bebauungspläne das Hauptgeschäft der Normenkontrolle darstellten, sondern Corona-Verordnungen, bei denen die vom Gesetzgeber ursprünglich anvisierte Nähe zur Verfassungsgerichtsbarkeit deutlich stärker gegeben sei.
4. Beschleunigungspotentiale am Beispiel von RED III Dr. Katharina Schober, Rechtsanwältin
Im Anschluss stellte Frau Dr. Katharina Schober, Rechtsanwältin, die „Beschleunigungspotentiale am Beispiel von RED III” vor. „RED III” bezeichnet dabei die EU-Richtlinie 2023/2413 („Renewable Energy Directive”).
Die Problemstellung sei bekannt: Lange Verfahrensdauern für die Vorhabenzulassung verzögerten die Energiewende und kosteten die Vorhabenträger massiv Geld. Gleichzeitig würden die Verfahren durch die geringe Personalausstattung, erhöhte materiellrechtliche Anforderungen sowie stärkere Möglichkeiten der Öffentlichkeitsbeteiligung immer langwieriger. Im Ergebnis habe sich die Verfahrensdauer für die Genehmigung von Windenergievorhaben an Land von 2011 bis 2022 fast verdoppelt.
Die RED III habe das Ziel, sowohl auf der Verfahrensebene als auch auf der materiellen Ebene eine schnellere bzw. einfachere Zulassung zu erreichen. Zu den Kernansätzen gehöre die Verlagerung von Prüfungen von der Genehmigungs- auf die Planebene. Unter Umständen bestehe sogar die Möglichkeit zur Genehmigungsfiktion.
Durch die „Hochzonung” vieler Untersuchungen auf die Planungsebene werde bei Einhaltung von auf Planebene festgelegten Maßnahmen die Umweltverträglichkeit des Vorhabens vermutet und auf Genehmigungsebene keine Artenschutzprüfung, Umweltverträglichkeitsprüfung oder FFH-Verträglichkeitsprüfung mehr durchgeführt. Zwar finde auf Genehmigungsebene grundsätzlich noch ein Screening statt, ob das Projekt „höchstwahrscheinlich erhebliche unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen haben wird”. Hiervon könnten die Mitgliedsstaaten jedoch für Wind- und Photovoltaik-Vorhaben eine Ausnahme vorsehen. In diesem Fall seien lediglich Minderungsmaßnahmen oder die Zahlung an einen Artenhilfsfonds erforderlich. Die Anordnung von Maßnahmen finde allein auf Grundlage vorhandener Daten statt. Falls keine aktuellen Daten vorliegen, sei stattdessen eine Zahlung an einen Artenhilfsfonds in pauschaler Höhe zu leisten.
Der Entwurf eines nationalen Umsetzungsgesetzes sehe etwa die Ausweisung aller neuen Windenergiegebiete als Beschleunigungsgebiete vor, sofern diese nicht in Natura 2000-Gebieten, Naturschutzgebieten, Kern-/Pflegezonen von Biosphärenreservaten oder Gebieten „mit bedeutenden Vorkommen einer oder mehrerer durch den Ausbau der Windenergie betroffener Arten, das auf Grundlage von vorhandenen Daten zu bekannten Artvorkommen und zu besonders geeigneten Lebensräumen ermittelt wird” liegen. Schober kritisierte jedoch, dass die nationale Umsetzung derzeit von unbestimmten Rechtsbegriffen geprägt sei und die geplanten Umsetzungshilfen voraussichtlich viele Fragen nicht beantworten würden.
Im Ergebnis sieht sie ein moderates Beschleunigungspotential durch die Neuregelungen. Allein die verfahrensrechtlichen Erleichterungen würden lediglich zu einer geringen Beschleunigung führen. Ein echter Gewinn seien zwar der Wegfall der Umweltverträglichkeitsprüfung sowie der FFH-Prüfung auf Ebene der Vorhabenzulassung. Mit Blick auf den Artenschutz sei es aber für Vorhabenträger immer noch vorteilhaft, ggf. aufwändige Kartierungen durchzuführen, um Ausgleichszahlungen zu verringern. Das größte Risiko sieht sie in den unbestimmten Rechtsbegriffen in der nationalen Umsetzung. Hier werde bis zu einer gerichtlichen Klärung hohe Unsicherheit bei Behörden und Vorhabenträgern herrschen, die zu weiteren Verzögerungen führen könne. Zudem bestehe die bisher häufig genutzte Möglichkeit, eine freiwillige Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, um mehr Rechtssicherheit zu erreichen, nach dem neuen Recht nicht mehr. Für die Zukunft sei daher neben den verfahrensrechtlichen Erleichterungen erforderlich, die personelle Ausstattung der Behörden auszubauen. Zudem sei eine Reduzierung materieller Maßstäbe unumgänglich.
In der Diskussion unter der Moderation von RinVG Denise Ritter, VGH Baden-Württemberg, wurden die Auswirkungen der RED III auf laufende Verfahren diskutiert. Bemängelt wurde, dass die Praxis bereits die bestehenden Verfahrensregelungen zum Teil nicht umsetze. Insbesondere die schon nach heutigem Recht erforderlichen Vollständigkeitsbestätigungen würden größtenteils nicht erteilt. Diskutiert wurde zudem die Frage, welche rechtliche Bedeutung die Fiktion der „umweltrechtlichen Genehmigung” nach Art. 16 a Absatz 5 Satz 1 der RED III haben kann.
5. BauGB-Novelle Dr. Jens Wahlhäuser, Ministerialrat Bundeskanzleramt
Zum Abschluss des Programms stellte Dr. Jens Wahlhäuser, Ministerialrat, die „BauGB-Novelle” vor. Zunächst erläuterte er die geplanten Änderungen nach dem Bund-Länder-Pakt, die sich insbesondere auf § 246 e BauGB, die TA Lärm sowie den „Gebäudetyp-E” beziehen. Zudem befassten sich das Bauministerium sowie das Kanzleramt mit möglichen Maßnahmen für bezahlbaren Wohnraum.
In einem kurzen Rückblick stellte Wahlhäuser die bereits erfolgten Gesetzesänderungen vor. Diese betrafen insbesondere Neuregelungen zu Erneuerbaren Energien und zur Digitalisierung im Bauleitverfahren.
Im Ausblick fehle nun noch der „Turbo für den Wohnungsbau”. Geplant sei zu diesem Zweck eine große BauGB-Novelle. Ziel sei, angesichts des immensen Bedarfs mehr Wohnraum auch in der Nähe von lärmbelasteten Gebieten zu ermöglichen sowie die Handlungsfähigkeit der Kommunen, insbesondere die gemeindlichen Vorkaufsrechte in Milieuschutzgebieten, zu stärken – nicht zuletzt in Reaktion auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts v. 09.11.2021 – 4 C 1.20, das ein Vorkaufsrecht der Kommune allein aufgrund der zu erwartenden Nutzung nach geltendem Recht verneint hatte. Zudem sei eine Vorschrift nach dem Vorbild der Regelungen über den Wohnungsbau für Flüchtlinge vorgesehen. Ein neuer § 246 e BauGB soll ermöglichen, für den Wohnungsbau in großem Umfang vom Planungsrecht abzuweichen, soweit die Gemeinde dem zustimmt.
Zudem sollen einige Regelungen der RED III im Rahmen der geplanten BauGB-Novelle umgesetzt werden. Hierfür würden Beschleunigungsgebiete für Erneuerbare Energien im BauGB sowie parallel im ROG vorgesehen.
Daneben solle das Verfahren zur Aufstellung von Bauleitplänen vereinfacht werden. Dies werde sowohl durch verstärkte Digitalisierung als auch durch eine praxisnähere Gestaltung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans erreicht.
Schließlich seien Erleichterungen in Bezug auf den Immissionsschutz geplant, etwa die Regelung der Emissionskontingentierung und eine Änderung der TA Lärm.
Im Anschluss an den Vortrag diskutierten die Teilnehmenden unter der Moderation von Dr. Hartmut Fischer, Fachanwalt für Verwaltungsrecht, über die neue Regelung des § 246 e BauGB und die Frage, wie diese sich in das bestehende Bauplanungsrecht einfüge.
III. Fazit
Dieses doppelte Jubiläum nicht nur des Verwaltungsrechtstags, sondern auch des Grundgesetzes war Anlass für spannende, wenn auch zum Teil bedrückende Rück- und Ausblicke. Dennoch zeigte der Verwaltungsrechtstag 2024 einmal mehr, wie wichtig die Vernetzung und der Austausch aller sind, die mit dem Verwaltungsrecht tagtäglich die Schnittstelle zwischen Bürger und Staat darstellen und dort die Möglichkeit und die Pflicht haben, Demokratie und Rechtsstaat zu vermitteln. Daneben war das Jubiläum aber auch ein wundervoller Anlass zum geselligen Zusammenkommen, und viele nutzten gerne die Gelegenheit, den Tag bei musikalischer Untermalung beim an die Tagung anschließenden Empfang ausklingen zu lassen.
Entnommen aus den VBlBW Heft 6/2025.


