Die Kreisschulbaukasse
Zweckgebundenes Sondervermögen oder „Füllhorn” für die kreisangehörigen Gemeinden?
Die Kreisschulbaukasse
Zweckgebundenes Sondervermögen oder „Füllhorn” für die kreisangehörigen Gemeinden?
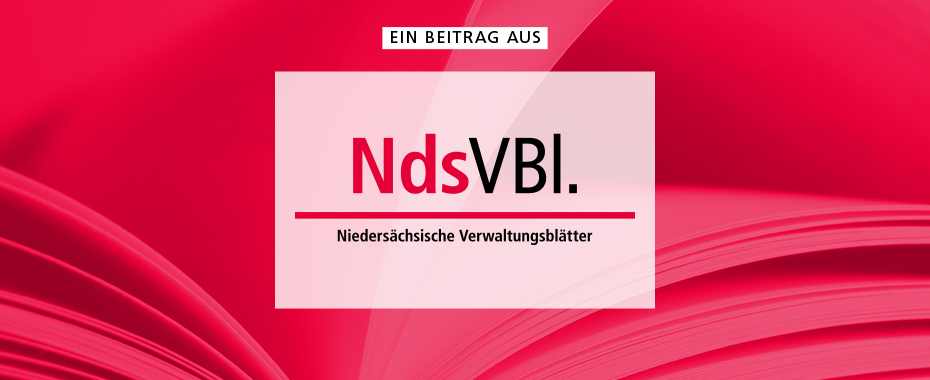
Gegenstand des Beitrages sind die Regelungen über die Kreisschulbaukasse (KSBK) in den §§ 117, 115 des Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG). Sie bergen ein Konfliktpotenzial zwischen Landkreis und kreisangehörigen Gemeinden, insbesondere, wenn die Gemeinden in dem Landkreis nicht nur Schulträger der Grundschulen sind, sondern auch von Schulen des Sekundarbereichs I, § 5 Abs. 3 Nr. 2 NSchG. Dabei geht es im Schwerpunkt um die Auslegung des Begriffs der „Notwendigkeit” der Kosten in § 117 Abs. 1 NSchG. Schließlich finden sich Ausführungen über die beabsichtigte Änderung der Vorschriften über die KSBK und deren mögliche Auswirkungen.
I. Ausgangslage und rechtliche Fragestellung
Nach § 102 Abs. 1 und 2 NSchG ist die Schulträgerschaft mit all ihren Rechten und Pflichten zwischen den Gemeinden und den Landkreisen und kreisfreien Städten klar aufgeteilt. Unter den Voraussetzungen des § 102 Abs. 3 und 4 NSchG kann die Schulbehörde die Schulträgerschaft den Gemeinden und Samtgemeinden auch für weiterführende allgemeinbildenden Schulformen übertragen.1 Hiervon ist vor allem in den 70er und 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts nach damaliger Rechtslage rege Gebrauch gemacht worden. Seit Beginn dieses Jahrhunderts ist allerdings ein Trend zur Rückübertragung der Schulträgerschaft zurück auf die Landkreise zu verzeichnen. Bspw. sind die weiterführenden Schulen in den Landkreisen Goslar und Peine wieder zurück in die Trägerschaft des Landkreises überführt worden. Die Gründe hierfür sind vor allem ein hoher Sanierungsstau bei den Schulgebäuden und die Situation leerer Haushaltskassen bei vielen Gemeinden, die hier ein beträchtliches Einsparpotenzial gesehen haben. Andere Gemeinden, welche diesen Schritt nicht vollzogen haben und Schulträger der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen geblieben sind, haben bei der Suche nach Finanzierungsmitteln anderweitige Lösungen gesucht und gefunden.
Eine kreisangehörige Gemeinde ist kraft Übertragung der Schulträgerschaft nach § 102 Abs. 3 NSchG Schulträger für Hauptschulen und Realschulen auf ihrem Gebiet. Nach § 117 Abs. 1 NSchG in Verbindung mit der Satzung über die Kreisschulbaukasse (KSBK) des Landkreises als Sondervermögen des Landkreises beträgt die Zuwendung aus der KSBK 70 % der für den Schulbau „notwendigen” Kosten in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses, wenn eine Schule des Sekundarbereichs errichtet werden soll. Schulbauten des Primarbereichs werden hingegen nur zu 30 % der notwendigen Kosten aus der KSBK unterstützt, zudem auch nur in Form eines rückzahlbaren Darlehens. In der Gemeinde besteht erheblicher Bedarf für eine neue Grundschule aufgrund steigender Schülerzahlen in den nächsten Jahren. Zugleich besteht ein erheblicher Sanierungsbedarf für das Gebäude der bestehenden Hauptschule. Es ist naheliegend, dass die Gemeinde bei dieser Sachlage das Hauptschulgebäude sanieren und ein neues Gebäude für die Grundschule bauen müsste.
Die Gemeinde plant jedoch als zuständiger Schulträger umgekehrt, nämlich den Neubau für die bestehende Hauptschule. Und in das zwischenzeitlich sanierte Bestandsgebäude soll nach Fertigstellung des Neubaus die neue Grundschule einziehen. Das neue Gebäude für die Hauptschule soll erheblich moderner ausgestaltet und für vielfältige Möglichkeiten der Unterrichtsgestaltung offen sein. Die Hauptschule ist eine Ganztagsschule und genießt einen guten Ruf. Die Gemeinde muss für die restlichen 30 % aufkommen. Der Landkreis äußert Zweifel an der „Notwendigkeit” der aufzuwendenden Schulbaukosten und vermutet, dass die Mittel der KSBK für nicht erforderliche Baumaßnahmen verwendet werden würden („Luxus”). Er erwägt daher, die Mittel in Höhe der Aufwendungen für nicht „notwendige” Baumaßnahmen zu kürzen. Insoweit stellt sich folgende Rechtsfrage:
Kann der Landkreis im Rahmen eines Ermessens gemäß den §§ 117, 115 NSchG Mittel aus der Kreisschulbaukasse (KSBK) kürzen, wenn er den geplanten Schulbau einer kreisangehörigen Gemeinde für zu „luxuriös”, mithin er die dafür aufzuwendenden Kosten teilweise für nicht „notwendig” i. S. d. § 117 Abs. 1 NSchG hält?
II. Mögliches Szenario und Beteiligung der Schulbehörde
Wenn man die „Notwendigkeit” der Aufwendungen aus § 117 Abs. 1 NSchG dahingehend interpretiert, dass diese sich auch auf die Notwendigkeit der Baumaßnahme für den Bau einer Hauptschule erstreckt, also nicht nur die reinen Kosten für die Maßnahme, sondern auch die Maßnahme als solche auf das absolute Minimum für den Schulbetrieb einer Hauptschule beschränkt, kann das dazu führen, dass der Landkreis eine eigene Ermittlung der notwendigen Kosten für den Schulbau zugrunde legen darf und entsprechend sich der Betrag der Anteilfinanzierung aus Mitteln der KSBK reduziert. Gegen eine solche Einwirkung des Landkreises mit der Folge einer Reduzierung der Zuschüsse aus der KSBK und einer gleichzeitigen Tragung der Mehrkosten durch die Gemeinde als Schulträger könnte sich die Gemeinde wehren, indem sie den Landkreis beim Verwaltungsgericht (VG) auf Zahlung des nach ihrer Kostenberechnung höheren Differenzbetrages verklagt. Das VG könnte zur Ermittlung der „notwendigen” Kosten bei entsprechender Auslegung des Begriffs der „Notwendigkeit” im Rahmen einer Beweisaufnahme nach § 117 Abs. 1 NSchG Mitarbeitende der Schulbehörde als Sachverständige oder Zeugen heranziehen, weil für die Beurteilung der Notwendigkeit der Baumaßnahme nicht nur rechtliche oder bautechnische Aspekte und solche des Arbeitsschutzes zu berücksichtigen sind, sondern gleichermaßen auch schulfachliche und pädagogische Gesichtspunkte.
III. Kritische Betrachtung der Rechtsauffassung des Landkreises
Die KSBK ist nach § 117 Abs. 5 Satz 1 NSchG ein zweckgebundenes Sondervermögen des Landkreises (nicht hingegen ein Sondervermögen i. S. d. § 130 NKomVG)2. Die Leistungen aus der KSBK stellen „Zuwendungen” im Rechtssinne dar. Dies folgt aus dem Wortlaut des § 117 NSchG, vor allem aus der Bezugnahme auf einzelne Vorschriften des § 115 NSchG. Auch die Satzung der KSBK des Landkreises geht ersichtlich davon aus, dass die Leistungen Zuwendungen sind, vor allem, wenn dort zwischen Zuwendungen in Form von Darlehen für Schulbauten im Primarbereich und „verlorenen” Zuschüssen für Maßnahmen im Sekundarbereich unterschieden wird. Für Zuwendungen, welche von Kommunen gewährt werden, gibt es weder in den §§ 110 ff. NKomVG noch in den Vorschriften der KomHKVO Regelungen oder Definitionen. Insofern wird man für die Interpretation dessen, was „notwendige” Kosten für Zuwendungen im Sinne der §§ 117 Abs. 1, 115 NSchG sind, die Vorschrift des § 23 der Landeshaushaltsordnung (LHO) entsprechend heranziehen können.
Nach allgemeinem Zuwendungsrecht ist zunächst zu ermitteln, welche Art von Förderung – institutionelle Förderung oder Projektförderung – in § 117 Abs. 1 NSchG gemeint ist. Da offensichtlich nicht die Schulträger als „Institute” gefördert werden sollen, sondern nur der Schulbau durch die kreisangehörigen Gemeinden (und der Landkreise), handelt es sich um eine Projektförderung. Der Landkreis beteiligt sich durch das Sondervermögen der KSBK nach der Satzung der KSBK in Form einer Anteilsfinanzierung (in Abgrenzung von einer Fehlbedarfsfinanzierung oder einer Vollfinanzierung) in Höhe von 70 % der Kosten für Schulbauten für den Sekundarbereich, und zwar insoweit als nicht rückzahlbarem Zuschuss.
Nach allgemeinem Zuwendungsrecht des Landes hat der Zuwendungsempfänger das Projekt zu beschreiben und einen Kosten- und Finanzierungsplan vorzulegen. Die Projektbeschreibung muss zudem darlegen, dass sich das Projekt im Rahmen des zuwendungsfähigen Zweckes verhält, insbesondere keine Maßnahmen und darauf entfallende Aufwendungen enthält, welche nicht dem Zuwendungszweck entsprechen.
Der Zuwendungszweck (§ 23 LHO) wird durch den § 117 NSchG, ergänzt durch § 115 NSchG und die Satzung der KSBK des Landkreises bestimmt als Schulbaukosten für „Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, zum Erwerb von Gebäuden für schulische Zwecke und für Erstausstattungen”. Eine weitergehende Eingrenzung des Zuwendungszweckes gibt es nicht.
Abweichend von § 23 LHO steht die Gewährung von Zuschüssen nach § 117 Abs. 1 NSchG nicht im Ermessen des Zuwendungsgebers. Spielraum „nach oben” besteht auch nicht hinsichtlich der Höhe der Zuwendungen. Die Satzung der KSBK beziffert die Höhe der Zuwendungen auf genau 70 % der Kosten in Form von nicht rückzahlbaren Zuschüssen und nicht etwa „bis zu 70 %”. Fallgruppen oder andere Sachgründe als eine zuwendungsrechtlich relevante Erschöpfung des Sondervermögens der KSBK nennt die Satzung der KSBK nicht. Daher ist von einer Finanzierung von genau 70 % auszugehen.
Entscheidend für die Bestimmung der „Notwendigkeit” der Schulbaukosten wird daher die geplante Maßnahme durch den Schulträger sein und die dafür ermittelten und veranschlagten Kosten, die vom Schulträger im Finanzierungsplan darzustellen sind. Dem Zuwendungszweck entsprechend müssen neben den Kosten nach § 115 Abs. 1 Satz 3 NSchG all diejenigen Kosten unberücksichtigt bleiben, welche ausweislich des Planes nicht für schulische Zwecke i. e. S. aufgewendet werden. Insoweit können z. B. die Kosten für einen angegliederten verpachteten Kiosk außer Betracht bleiben und ggf. von den Gesamtkosten abgezogen werden.
Im Übrigen ist jedoch der Gesamtfinanzierungsplan des gemeindlichen Schulträgers für den Landkreis und die Beteiligung durch die KSBK bindend. Eine Reduzierung aus Gründen der Sparsamkeit oder weil aus Sicht des Landkreises bestimmte Teile des Schulbaues als nicht zwingend für erforderlich gehalten werden, sondern als „Luxusmaßnahmen” angesehen werden, könnte nicht zulässig sein. Denn damit wird nicht allein die Notwendigkeit der Kosten kritisiert, sondern die Notwendigkeit der Baumaßnahmen als solche. Eine solche weitreichende Auslegung des Begriffs der „Notwendigkeit” ist jedoch augenscheinlich weder vom Wortlaut der Regelung des § 117 Abs. 1 NSchG noch nach allgemeinen Regeln des Zuwendungsrechts vorgesehen. Im Gegenteil könnte argumentiert werden, dass eine solche Interpretation des § 117 Abs. 1 NSchG eine schulrechtlich nicht vorgesehene Einflussnahme des Landkreises auf die Aufgaben des zuständigen Schulträgers (§ 101 Abs. 2 NSchG: eigener Wirkungskreis) bedeutet. Zudem könnte damit der Landkreis unzulässig in die Organisations- und Finanzhoheit der Gemeinde und damit einen Kernbereich der nach Art. 28 Abs. 2 GG und Art. 57 Abs. 3 Nds. Verfassung verfassungsrechtlich garantierten Selbstverwaltungshoheit der Gemeinden eingreifen.3 Berücksichtigt man zudem die Aufgabe der Schulentwicklungsplanung für alle Kommunen, die es auch nach Wegfall des § 26 NSchG a. F. als Verpflichtung aus der Schulträgerschaft noch gibt, kann auch die Planungshoheit beeinträchtigt sein.
Zwar könnte hiergegen eingewendet werden, dass auch die Gemeinde als Schulträger nach den §§ 101 Abs. 1, 108 Abs. 1 NSchG verpflichtet ist, u. a. das „notwendige” Schulangebot und die „notwendigen” (§ 101 NSchG) bzw. „erforderlichen” (§ 108 Abs. 1 NSchG) Schulanlagen vorzuhalten und zu errichten. Die Begriffe „notwendig” und „erforderlich” sind bedeutungsidentisch.4
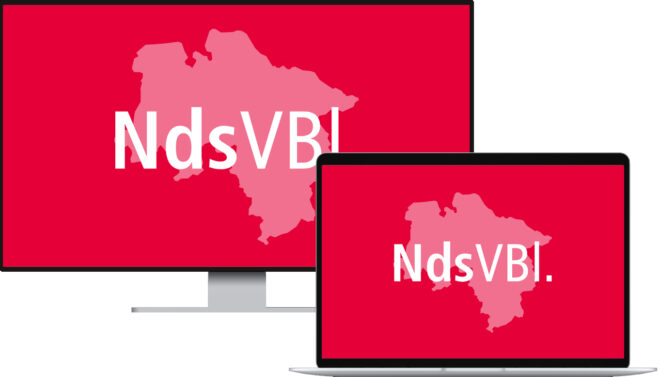 In der Literatur ist die Erforderlichkeit in § 108 Abs. 1 NSchG eingehend kommentiert worden zur Frage, was passiert, wenn der Schulträger seinen Pflichten nicht nachkommt und eben weniger als das Erforderliche getan hat und die zuständigen Behörden im Wege der Kommunalaufsicht regulierend eingreifen können.5
In der Literatur ist die Erforderlichkeit in § 108 Abs. 1 NSchG eingehend kommentiert worden zur Frage, was passiert, wenn der Schulträger seinen Pflichten nicht nachkommt und eben weniger als das Erforderliche getan hat und die zuständigen Behörden im Wege der Kommunalaufsicht regulierend eingreifen können.5
Welche Folgen eintreten, wenn der eigenverantwortliche Schulträger (Art. 28 Abs. 2 GG/Art. 57 Abs. 3 Nds. Verfassung!) seine Pflichten über das erforderliche Maß erfüllt, wird bislang nicht erörtert. Offenkundig wird in diesen Fällen kein Nachteil für den Bildungsauftrag und das Recht auf Bildung (Art. 4 NV) gesehen und dementsprechend auch kein Handlungsbedarf, hier regulierend einzugreifen. Wer mehr macht als notwendig, ist ja per se zunächst einmal nicht schlecht, sondern positiv zu bewerten. Insoweit bestehen rein schulrechtlich keine Beschränkungen für den planenden Schulträger. Andererseits kann vertreten werden, dass der Begriff der Notwendigkeit nicht nur die Forderung eines Minimums des aufzubringenden Aufwandes zur Erfüllung des Beitrages der Schulträger für den Bildungsauftrag (§ 2 NSchG) umfasst. Er kann eben auch dieselbe Beschränkung nach oben, auf das Erforderliche – und nicht darüber hinaus – enthalten.
Denn neben der Auslegung des Wortlautes der Begriffe „Notwendigkeit” und „Erforderlichkeit” in den §§ 101, 108 NSchG kann auch eine systematische Auslegung im Kontext zu den Regelungen der §§ 117 und 115 NSchG erfolgen. Denn wer mehr als das Notwendige für Schulanlagen baut, macht das zu Lasten der KSBK, vor allem, weil bei Schulbauten des Sekundarbereichs I die KSBK deutlich mehr belastet wird. Da sich die KSBK zu 1/3 durch Beiträge aller kreisangehörigen Gemeinden speist, werden bei einem Schulbau eines Schulträgers mit einer Ausstattung, die deutlich mehr als das Notwendige umfasst, neben dem Landkreis (2/3) auch die anderen gemeindlichen Schulträger mit erhöhten Beiträgen belastet. Das kann dazu führen, dass andere kreisangehörige Gemeinden in der Erfüllung ihrer sonstigen Aufgaben beeinträchtigt werden. Oder es kann, vor allem im Bereich des Sekundarbereichs I, zu einem „Nachahmeffekt” führen, mit der Folge, dass andere Gemeinden dieses Landkreises als Schulträger weiterführender Schulen Gleiches tun und es dadurch wiederum zu Mehrbelastungen der anderen Gemeinden und des Landkreises kommen wird und damit die Leistungsfähigkeit aller Kommunen empfindlich gestört werden kann. Ebenfalls steigen werden sehr wahrscheinlich die Beiträge, welche alle kreisangehörigen Gemeinden nach § 15 des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes (NFAG) über die Kreisumlage abzuführen haben.
Insofern ließe sich vertreten, dass für die Auslegung des Begriffs der „Notwendigkeit” in § 117 Abs. 1 NSchG neben der Angemessenheit der Kosten für das Projekt Schulbau in systematischer Auslegung der §§ 101, 108, 117 und 115 NSchG auch die Notwendigkeit des Umfanges des geplanten Schulbaues einzubeziehen sein kann. Das hätte zur Folge, dass der Landkreis als Träger des Sondervermögens KSBK auch insoweit ein Prüfrecht hat, infolgedessen er die Zuwendungen reduzieren könnte.
Allerdings ist die dahingehende einschränkende Auslegung des Begriffs der „Notwendigkeit” in § 117 NSchG eher im Bereich der „Eingriffsverwaltung”, insbesondere aus dem Gefahrenabwehrrecht verortet und gebräuchlich als Teil des Verhältnismäßigkeitsprinzips (mildestes geeignetes Mittel). Daher bestehen nicht unerhebliche Zweifel, ob diese Einschränkung „nach oben” auch vom Regelungszweck der §§ 117, 115 NSchG umfasst ist. Denn die Eingriffsverwaltung unterliegt deutlich anderen Regelungen und Einschränkungen und hat vor allem einen völlig anderen Zweck, der mit jenem des § 117 NSchG nicht vergleichbar ist. Denn hiernach werden die Erfüllung des Bildungsauftrages und die Gewährleistung des Rechts auf Bildung bezweckt, quasi eine Aufgabe zur Daseinsvorsorge i. w. S.
Dann verbleiben nur noch die Instrumente der Kommunalaufsicht aus den §§ 170 ff. NKomVG, um gegen vermutet wirtschaftlich „maßlose” Maßnahmen des gemeindlichen Schulträgers möglicherweise vorzugehen. Die zuständige Kommunalaufsichtsbehörde wird der Gemeinde gegenüber darlegen und beweisen müssen, dass diese mit einer mehr als erforderlichen Baumaßnahme im Rahmen ihrer Schulträgerschaft gegen das Gesetz oder eine Haushaltssatzung verstößt, und nach pflichtgemäßem Ermessen ein Einschreiten der Kommunalaufsicht, etwa nach Maßgabe der §§ 170, 173 NKomVG in Betracht ziehen, um auf diese Weise regulierend einzuwirken. Das wird im Einzelfall zu prüfen sein, notfalls im Rahmen eines verwaltungsgerichtlichen Verfahrens.
IV. Ergänzende Hinweise aus zuwendungsrechtlicher Sicht
Die Notwendigkeit der Kosten kann überdies in den Fällen abgesprochen werden, in denen dem Zuwendungsempfänger ein generell verbotener vorzeitiger Maßnahmenbeginn vorgeworfen werden kann. Dieses Verbot ist nach allgemeinem Zuwendungsrecht und in der dahingehenden Rechtsprechung generell anerkannt. Ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn betrifft nicht die Ermessensausübung im Sinne einer Reduzierung des Ermessens nach allgemeinen Zuwendungsrecht; das wäre hier auch irrelevant, weil die Vergabe der Mittel aus der KSBK nach § 117 NSchG keine Ermessensentscheidung ist, sondern eine gebundene Entscheidung. Mit anderen Worten hat die begünstigte Gemeinde im Falle eines Schulbaus einen Rechtsanspruch auf diese Leistungen. Der Rechtsbegriff des verbotenen Maßnahmenbeginns betrifft vielmehr die Tatbestandsvoraussetzung der „Notwendigkeit” und stellt einen anspruchshindernden Umstand dar. Es wird unwiderlegbar vermutet, dass eine „Notwendigkeit” im zuwendungsrechtlichen Sinn nicht gegeben ist. Aus diesem Verbot folgt, dass eine Zuwendung nicht mehr in Betracht kommt, wenn mit einem Vorhaben bereits begonnen wurde (in diesem Sinne auch Ziffer 1.3 der Verwaltungsvorschriften (VV) zu § 44 LHO, die hier sinngemäß anwendbar sein dürfte). Ob ein solcher Fall bei dem geplanten Schulbau der Gemeinde vorliegt, ist vom Zuwendungsgeber (Landkreis) eigenverantwortlich zu prüfen.
V. Fazit
Eine Reduzierung der Beteiligung aus der KSBK durch den Landkreis gegenüber der kreisangehörigen Gemeinde mit der Begründung, bestimmte Teile des Schulbaues als solchen seien nicht notwendig, kann rechtmäßig sein, allerdings nach diesseitiger Auffassung nur über den „Umweg” der Kommunalaufsicht, soweit der Vorwurf gerechtfertigt ist, dass die Gemeinde gegen wesentliche Grundsätze des Haushaltsrechtes verstößt. § 117 NSchG bietet hierfür keine tragfähige Rechtsgrundlage.
VI. Ausblick: beabsichtigte Novellierung der §§ 117 und 118 NSchG
Die Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen haben Anfang 2025 einen Gesetzentwurf zur Änderung des NSchG vorgelegt, der neben dem Recht der Schulen in freier Trägerschaft auch die Regelungen der §§ 117 und 118 NSchG umfasst, die einen neuen Absatz erhalten sollen. Hier wird beabsichtigt, die starre gesetzliche Regelung der Schulbaufinanzierung zu flexibilisieren, indem den beteiligten Landkreisen und ihren kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden die Möglichkeit eröffnet wird, kraft Vereinbarung von den bisherigen Regelungen der §§ 117 und 118 NSchG abzuweichen.6 Dem Wortlaut der neuen Regelung und der Gesetzesbegründung nach kann damit auch im Einvernehmen auf das Führen einer KSBK gänzlich verzichtet werden und das Sondervermögen aufgelöst werden. Sollte diese Regelung vom Landtag so beschlossen werden, könnten Landkreis und kreisangehörige Gemeinden im Wege eines öffentlich-rechtlichen Vertrages nach § 54 VwVfG die Auflösung der KSBK vereinbaren. Eine solche Vereinbarung muss auch die Verteilung der verbliebenen Mittel dieses Sondervermögens regeln. Und es sollte eine Regelung über eine alternative gemeinsame Finanzierung des Schulbaus vereinbart werden, sofern nicht die alleinige Zuständigkeit und Finanzierungspflicht (§ 113 Abs. 1 NSchG) den einzelnen Schulträgern überlassen werden soll. Hier kann durchaus politisches Konfliktpotenzial liegen. Über eine Aufhebung der KSBK müsste jede beteiligte Kommune positiv beschließen. Allein das ablehnende Votum nur einer Mitgliedsgemeinde würde eine solche Vereinbarung scheitern lassen. Für diesen „Ausstiegsbeschluss” sind zwar die Vertretungen nicht ausschließlich nach § 58 Abs. 1 NKomVG zuständig, da es insoweit an einer hierfür erforderlichen ausdrücklichen Regelung fehlt und die Ziffern 11 bis 13 nur für Einrichtungen des kommunalen Wirtschaftsrechtes gelten. Allerdings dürfte sich die Zuständigkeit der Vertretungen über die Möglichkeiten aus § 58 Abs. 2 NKomVG ergeben, zumal für diesen Schritt eine erhebliche politische Bedeutung sprechen dürfte. Der Landkreis müsste im Fall eines Zustandekommens einer Vereinbarung, mit der die KSBK aufgelöst werden soll, zusätzlich die entsprechende Satzung aufheben.
Entnommen aus den NdsVBl. Heft 7/2025.


