Aktuelle Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs zum Bau- und Denkmalschutzrecht
Von Einheimischenmodellen bis zur „erdrückenden Wirkung"
Aktuelle Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs zum Bau- und Denkmalschutzrecht
Von Einheimischenmodellen bis zur „erdrückenden Wirkung"
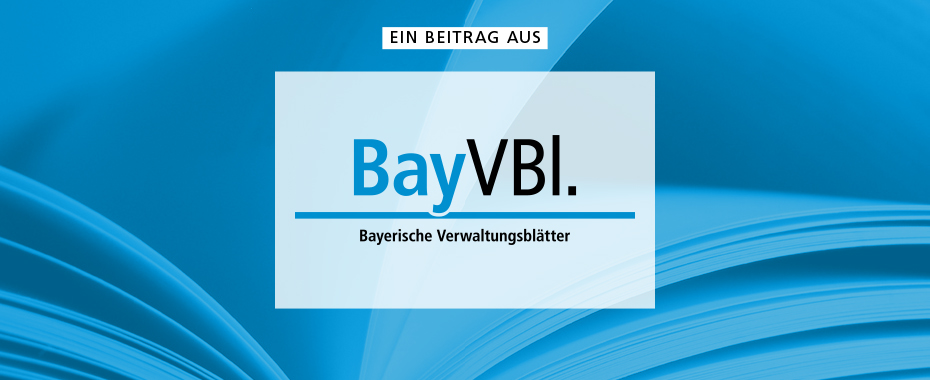
Bau- und Denkmalschutzrecht zählt im Rahmen der sogenannten klassischen Rechtsgebiete des Verwaltungsrechts zu denjenigen, die in der Praxis den größten Raum einnehmen, was sich bereits daraus ablesen lässt, dass sich am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) vier Senate mit dieser Thematik befassen. Besonders bemerkenswerte Rechtsprechung des Gerichtshofs aus jüngerer Zeit wird im folgenden Beitrag (in Fortsetzung von BayVBl. 2023, 397) auszugsweise nachskizziert, wobei die Auswahl selbstverständlich subjektiv ist und keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.
I. Bauleitplanung
1. Bebauungsplan zur Deckung des Wohnbedarfs der örtlichen Bevölkerung
Bauleitpläne sind erforderlich im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB, soweit sie nach der planerischen Konzeption der Gemeinde erforderlich sind1. Hieraus ergibt sich ohne Weiteres, dass es an der gemeindlichen Planungsbefugnis fehlt, wenn die fragliche Bauleitplanung im Einzelfall offensichtlich nicht geeignet ist, das gemeindliche Planungsziel sicherzustellen. Die Sicherstellung der Erreichung der Planungsziele eines Bebauungsplans kann sich unter Umständen auch aus einem städtebaulichen Vertrag ergeben, der diesen ergänzen soll2. Voraussetzung hierfür ist die Wirksamkeit des städtebaulichen Vertrages.
In diesem Zusammenhang hat der BayVGH3 den folgenden Fall entschieden: Der Antragsteller wendet sich gegen einen Bebauungsplan der Antragsgegnerin. Festgesetzt werden ein allgemeines Wohngebiet mit über 50 Bauparzellen für Einzel- und Doppelhäuser sowie eine Umgehungsstraße. Das überplante Gebiet liegt weitgehend im bisherigen Außenbereich. Die Aufstellung des Bebauungsplanes dient laut seiner Begründung der Ausweisung von Wohnbauflächen zur Deckung des Wohnbedarfs der ortsansässigen Bevölkerung. Bereits vor der Beschlussfassung über den Bebauungsplan schloss die Antragsgegnerin, die Eigentümerin einiger weniger Flächen im Plangebiet ist, mit den beiden Eigentümern der restlichen als Bauland ausgewiesenen, deutlich überwiegenden Flächen im Plangebiet einen städtebaulichen Vertrag, in dem auf den streitgegenständlichen Bebauungsplan und dessen Planungsziele Bezug genommen wird. Damit Wohnbauland tatsächlich dem Wohnbedarf der Bevölkerung zur Verfügung gestellt werde, bedürfe es eines städtebaulichen Vertrags. In diesem wird im Einzelnen geregelt, dass und wie die ortsansässige Bevölkerung für einen bestimmten Zeitraum bei der Vergabe von Wohngrundstücken zu bevorzugen ist. Eine Bevorzugung von sozial schwachen Personen wird nicht geregelt.
Der Bebauungsplan selbst enthält keine Regelungen, die die Bevorzugung der ortsansässigen Bevölkerung bei der Vergabe von Wohnungsbaugrundstücken sicherstellen. Deshalb kam es auf den städtebaulichen Vertrag an. § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BauGB weist auf die Möglichkeit hin, dass Gemeinden städtebauliche Verträge zum Erwerb angemessenen Wohnraums durch einkommensschwächere oder weniger begüterte Personen der örtlichen Bevölkerung abschließen können. Zwar regelt § 11 BauGB den Inhalt von städtebaulichen Verträgen nicht abschließend. Ausweislich der Begründung des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt (vgl. BR-Drs. 18/11439 S. 20), mit dem § 11 BauGB seine aktuelle Fassung, die bei Inkrafttreten des streitgegenständlichen Bebauungsplans bereits galt, erhalten hat, sollte zur Vermeidung einer europarechtswidrigen Diskriminierung auch im Wortlaut der Vorschrift hervorgehoben werden, dass Einheimischenmodelle bei europarechtskonformer Ausgestaltung dem Erwerb angemessenen Wohnraums durch einkommensschwächere und weniger begüterte Personen der örtlichen Bevölkerung dienen. Hieraus ergibt sich ohne Weiteres der Wille des Gesetzgebers, dass die Regelungen betreffend die Bevorzugung der örtlichen Bevölkerung im Rahmen von städtebaulichen Verträgen stets auch der Berücksichtigung der genannten sozialen Komponente bedürfen, nachdem andernfalls europarechtliche Vorschriften entgegenstehen könnten. Auch mag es sich bei dem hier in Rede stehenden städtebaulichen Vertrag um einen solchen des Zivilrechts handeln. Jedoch muss er sich, nachdem eine Kommune Vertragspartner ist und er der Erfüllung von bauleitplanerischen Zielsetzungen dient, am Vorrang des Gesetzes messen lassen, sodass er aufgrund des Verstoßes gegen § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 letzte Alt. BauGB in entsprechender Anwendung von Art. 59 Abs. 1 BayVwVfG jedenfalls in der Frage der Bevorzugung von Einheimischen nichtig ist4.
Da somit weder durch den Bebauungsplan selbst noch durch den städtebaulichen Vertrag die Erreichung der genannten Planungsziele sichergestellt ist, fehlte es der Planung an der notwendigen Erforderlichkeit im Sinn von § 1 Abs. 3 BauGB. Folge einer fehlenden Erforderlichkeit und damit Planungsbefugnis im Sinne des § 1 Abs. 3 Satz 1 ist auch unter Berücksichtigung der Vorschriften der §§ 214 f. BauGB die Unwirksamkeit des Bauleitplans5. Deshalb konnte die Frage offenbleiben, ob eine zulässige Regelung der Bevorzugung von Einheimischen im städtebaulichen Vertrag ausgereicht hätte, um das Planungsziel des Bebauungsplans sicherzustellen6.
2. Besonderheiten des Abwägungsgebots und der städtebaulichen Erforderlichkeit beim vorhabenbezogenen Bebauungsplan
Die Abwägung ist das Kernstück eines jeden Bauleitplans und lässt sich der Begründung und den Aufstellungsunterlagen – insbesondere den Beschlussvorlagen bei der Entscheidung über die eingegangenen Stellungnahmen – entnehmen. Mängel im Abwägungsvorgang sind nur erheblich, wenn sie offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen sind7. Die Grundsätze der Abwägungsfehlerlehre gelten auch beim vorhabenbezogenen Bebauungsplan8. Die durch § 12 Abs. 3a BauGB eröffnete Möglichkeit, für das den Gegenstand des Vorhaben- und Erschließungsplans bildende Vorhaben einen größeren rechtlichen Rahmen zu schaffen, ist ein Einfallstor für leicht zu übersehende Abwägungsfehler9.
Der BayVGH10 hat in diesem Zusammenhang einen Bebauungsplan gemäß § 47 Abs. 6 VwGO außer Vollzug gesetzt, der für das Plangebiet unter anderem ein allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO festsetzte. Ausgeschlossen wurden in den textlichen Festsetzungen nur die nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO allgemein zulässigen Nutzungen, so dass der Rechtsplan die allgemeine Zweckbestimmung eines allgemeinen Wohngebiets wahrte11. Gleichzeitig setzte der Bebauungsplan allerdings gemäß § 12 Abs. 3a Satz 1 BauGB unter Bezugnahme auf § 9 Abs. 2 BauGB fest, dass im Rahmen der festgesetzten Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig sind, zu deren Durchführung der Vorhabenträger sich verpflichtet hat. Im Durchführungsvertrag wird die in dem relevanten Planbereich zulässige Nutzung ausschließlich auf Wohngebäude beschränkt, was mit den Darstellungen im Vorhaben- und Erschließungsplan korrespondierte.
Der Senat nahm in diesem Zusammenhang einen „Etikettenschwindel” mit der Folge der fehlenden Erforderlichkeit der Planung gemäß § 1 Abs. 3 BauGB an. Denn nach der Systematik des vorhabenbezogenen Bebauungsplans sind Vorhaben, die vom vorhabenbezogenen Bebauungsplan, nicht aber vom Durchführungsvertrag erfasst werden, unzulässig12, was unter Berücksichtigung des Durchführungsvertrags dazu führe, dass auch Vorhaben nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauGB ausgeschlossen seien. Wenn der Plangeber die Realisierung von im allgemeinen Wohngebiet neben dem Wohnen allgemein zulässigen Nutzungen gar nicht anstrebe oder wenn eine solche Entwicklung wegen der vorhandenen Bebauung oder aufgrund sonstiger Festsetzungen im Bebauungsplan faktisch nicht zu erreichen sei, stelle die Festsetzung des allgemeinen Wohngebiets einen städtebaulich nicht gerechtfertigten „Etikettenschwindel” dar13.
II. Bauplanungsrecht
1. Rücksichtnahmegebot
a) Unzulässigkeit einer Asylbewerberunterkunft im allgemeinen Wohngebiet im Einzelfall
Liegt ein Vorhaben im Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplans, ist es zulässig, wenn es den Festsetzungen nicht widerspricht (§ 30 Abs. 1 BauGB). Ausnahmsweise kann sich aufgrund von § 15 BauNVO (Gebot der Rücksichtnahme) eine Unzulässigkeit im Einzelfall ergeben. Nach Satz 1 der Vorschrift sind an sich zulässige Anlagen im Einzelfall unzulässig, wenn sie nach Anzahl, Lage, Umfang oder Zweckbestimmung der Eigenart des Baugebiets widersprechen. Diese Voraussetzungen liegen etwa vor, wenn ein nach Art und Maß der baulichen Nutzung grundsätzlich zulässiger Gewerbebetrieb wegen seiner Betriebsgröße der Eigenart des Baugebiets widerspricht, eine besondere große Vergnügungsstätte den Charakter des Gebiets verändert oder wenn ein Warenhaus wegen seiner Größe die Verkehrsverhältnisse des Baugebiets nachhaltig beeinflusst14. Die Vorschrift wurde jetzt auch vom BayVGH15 bemüht, um in einem Eilverfahren die Unzulässigkeit einer Asylbewerberunterkunft im allgemeinen Wohngebiet im Einzelfall zu begründen.
Die Gemeinschaftsunterkunft soll auf zwei Grundstücken des beigeladenen Landkreises errichtet werden. Als Bestand befindet sich dort ein größeres Wohngebäude, das bereits als Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge genutzt wird. Diese soll mit dem Bauvorhaben in Modulbauweise für 96 Bewohner erweitert werden. Der etwa 49 m lange Baukörper ist entlang der südlichen Grundstücksgrenze situiert. Die Antragsteller sind Miteigentümer des unmittelbar daran angrenzenden Grundstückes, das mit einem Einfamilienhaus bebaut ist. Der Vorhabenstandort liegt im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, der für das Plangebiet ein allgemeines Wohngebiet festsetzt; die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sind ausgeschlossen.
Im Unterschied zur ersten Instanz ging der Senat von einer Verletzung des Rücksichtnahmegebots aus: „Die genehmigte Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge für 96 Personen übt eine dominierende, den Charakter des Gebietes verändernde Wirkung aus (vgl. BVerwG, B.v. 29.07.1991 – 4 B 40.91 – NVwZ 1991, 1078). Das kleine Baugebiet weist neben den Grundstücken der Beigeladenen zu 1 eine aufgelockerte Bebauung mit Einfamilienhäusern und Doppelhäusern auf, auch im Hinblick auf das festgesetzte zulässige Maß der baulichen Nutzung sind hier größere Veränderungen auf den Wohngrundstücken nicht zu erwarten, gegebenenfalls kann auf dem Grundstück Flur-Nr. 2 ein zusätzliches Gebäude errichtet werden. Bei der genehmigten Gemeinschaftsunterkunft handelt es sich hingegen sowohl nach der Kubatur als auch nach der Belegungszahl um eine größere Anlage. Zudem dürfte das nach den Angaben der Beteiligten bereits als Gemeinschaftsunterkunft genutzte Gebäude auf dem Grundstück Flur-Nr. 2 mit zu berücksichtigen sein, gegen eine Mitberücksichtigung werden im Beschwerdeverfahren keine Einwände geltend gemacht. Konkretere Angaben hierzu werden im Klageverfahren zu ermitteln sein. Mit der Größe der Unterkunft beziehungsweise deren Belegungszahl erhöhen sich erfahrungsgemäß die Lärmimmissionen. So wird auch in der immissionsschutzfachlichen Stellungnahme zum Bauvorhaben darauf hingewiesen, dass es bei Bauvorhaben dieser Größenordnung zu Lärmkonflikten mit der Nachbarschaft kommen kann. Die bestehende räumliche Enge in der Flüchtlingsunterkunft (sehr kleine Zimmer und begrenzte Aufenthaltsmöglichkeiten in den Gemeinschaftsräumen) wird dazu führen, dass sich die Bewohner in größerer Zahl im Freien vor der Unterkunft aufhalten, sei es noch auf den Vorhabengrundstücken, die bereits relativ dicht bebaut sind, oder den benachbarten Straßen- oder Grünflächen im Plangebiet. Dies ist ebenfalls geeignet, eine Unruhe in das Gebiet zu bringen (vgl. OVG Hamburg, B.v. 28.05.2015 – 2 Bs 23/15 – ZfBR 2016, 61), die mit dem Wohncharakter in dem kleinen Gebiet nicht mehr vereinbar ist. Da es auf das Maß der baulichen Nutzung nicht ankommt (vgl. BVerwG, U.v. 16.03.1995 – 4 C 3.94 – NVwZ 1995, 899), weist der Senat hier nur darauf hin, dass das Landratsamt bei der Genehmigung der Gemeinschaftsunterkunft zu Unrecht von einem zulässigen Maß der baulichen Nutzung ausgegangen ist. Die auf dem Grundstück Flur-Nr. 2 festgesetzte private Grünfläche stellt kein Bauland dar und kann bei der Ermittlung der zulässigen Grundfläche nicht berücksichtigt werden, weiter kann nur die innerhalb des Plangebiets liegende Grundstücksfläche berücksichtigt werden. Soweit der Antragsgegner geltend macht, dass die Unterbringung von Asylbewerbern zu den Nutzungen gehört, die dem Wohnen ähnlich sind, ist dies zwar grundsätzlich richtig, es gibt aber auch hier unterschiedliche Unterbringungsformen (vgl. BVerwG, U.v. 17.12.1998 – 4 C 16.97 – BVerwGE 108, 190). Es handelt sich bei der genehmigten Gemeinschaftsunterkunft nicht um eine Unterbringung in einem bestehenden Wohngebäude oder in einzelnen, kleineren Wohncontainern, sondern um eine Unterbringung in einem größeren, lang gestreckten Gebäude in Modulbauweise, bei der die Unterbringung einer möglichst großen Zahl von Flüchtlingen im Vordergrund steht. Eine einzelfallbezogene Prüfung im Rahmen des § 15 Abs. 1 Satz 1 BauGB wird auch durch die gesetzgeberische Wertung in § 246 Abs. 11 BauGB, auf die sich der Antragsgegner bezogen hat, nicht obsolet. Ob eine Befristung der Nutzung im Rahmen des § 15 Abs. 1 Satz 1 BauGB berücksichtigt werden kann, kann vorliegend dahingestellt bleiben, da jedenfalls eine Befristung auf zwölf Jahre nicht geeignet ist, die Schutzwürdigkeit des Wohngebiets zu relativieren.”
b) Erdrückende Wirkung eines Bauvorhabens
Nachbarschutz aus dem Gebot der Rücksichtnahme setzt stets einen Verstoß gegen das objektive Recht voraus. Das Gebot der Rücksichtnahme beschränkt sich nicht auf den Schutz vor Immissionen, sondern erfasst auch andere Formen der Beeinträchtigung von Nachbargrundstücken, soweit sie städtebauliche Relevanz haben. Es setzt aber voraus, dass der Konflikt im Bebauungsplan nicht bereits abschließend (in rechtlich zulässiger Weise) abgewogen und bewältigt worden ist. Da sich im Bereich der Immissionen Abwehrrechte des Nachbarn ohnehin aus dem Fachrecht ergeben, sind die anderweitigen Formen von Beeinträchtigungen praktisch wichtiger. Dabei geht es in der Praxis auch um erdrückende Wirkungen von baulichen Anlagen, auch Einmauerungseffekte genannt16. Für diese Fallkonstellation kommt es stets darauf an, ob die tatsächlichen Auswirkungen das Maß des im Baugebiet Zumutbaren überschreiten. Allerdings hat das häufige Vorbringen, Nachbar-Bauvorhaben hätten eine „erdrückende” Wirkung, im Klageverfahren meist keinen Erfolg. Bei Einhaltung der landesrechtlichen Abstandsvorschriften ist die Annahme einer „erdrückenden Wirkung” nur in Ausnahmefällen möglich. Eine erdrückende Wirkung und damit zugleich ein Verstoß gegen das Gebot der Rücksichtnahme ist nur dann anzunehmen, wenn eine bauliche Anlage wegen ihrer Ausmaße, ihrer Baumasse oder ihrer massiven Gestaltung ein benachbartes Grundstück unangemessen benachteiligt, indem es diesem förmlich „die Luft nimmt”, weil für den Nachbarn das Gefühl „des Eingemauertseins” entsteht. Für die Annahme der „erdrückenden Wirkung” eines Nachbargebäudes ist in der Regel kein Raum, wenn dessen Baukörper nicht erheblich höher ist als das betroffene Gebäude. Die „Masse” eines Vorhabens als solche entfaltet keine erdrückende Wirkung. Etwas anderes gilt, wenn die genehmigte Anlage das Nachbargrundstück regelrecht abriegelt, also dort ein Gefühl des Eingemauertseins oder eine Gefängnishofsituation hervorruft. Hierauf hat der BayVGH17 in folgendem Fall letztlich abgehoben:
Die Klägerin wendet sich als Nachbarin gegen die der Beigeladenen erteilte Baugenehmigung zur Errichtung eines Wohngebäudes in einer engen Hinterhoflage. Erstinstanzlich obsiegte sie. Der Antrag der Beigeladenen auf Zulassung der Berufung blieb ohne Erfolg. In seinem Beschluss führt der Senat auszugsweise Folgendes aus: „Grundsätzlich kann als Gradmesser für die Intensität der Beeinträchtigung des Nachbarn herangezogen werden, ob die bauliche Anlage dadurch dem klägerischen Wohngebäude buchstäblich die letzte Luft zum Atmen nimmt, dass sie auch die letzte noch freie Seite verschließt (vgl. BayVGH, B.v. 16.10.2007 – 1 CS 07.1848 – juris Rn. 40). Bei der Abwägung, wann eine solche abriegelnde Wirkung anzunehmen ist, und dessen, was dem Nachbarn oder dem Bauherrn billigerweise zugemutet werden kann, erscheint der Nachbar, der von allen Seiten durch heranrückende Bebauung betroffen ist, schutzwürdiger als ein Nachbar, dessen Grundstück noch in zwei Himmelsrichtungen nicht durch weiter herangerückte Bebauung beeinträchtigt ist (vgl. BayVGH, B.v. 25.05.2021 – 15 ZB 20.2128 – juris Rn. 16; Troidl, Erdrückende Wirkung im öffentlichen Baurecht, BauR 2008, 1843). Hier würde das Bauvorhaben dazu führen, dass der klägerische Innenhof von allen Seiten umschlossen wäre, da der bislang freie Durchgang zwischen dem bestehenden Querbau und dem Rückgebäude wegfallen soll. Zudem hat das Verwaltungsgericht zu Recht in seine Erwägung miteinbezogen, dass die östliche Außenwand des geplanten Rückgebäudes nach Osten versetzt wird, weil diese Verschiebung der Ostwand des Rückgebäudes, gerade auch im Zusammenspiel mit der deutlichen Erhöhung dieser Wand von circa 10 m auf 17,10 m und dem bis zum Rückgebäude durchgezogenen Querbau – wie auf dem als ‚Vogelperspektive Süd’ bezeichneten Plan gut zu erkennen ist –, zu einer deutlichen Verengung der Innenhofsituation zulasten des Klägers führt. Hier – wie seitens der Beigeladenen erfolgt – nur auf die Situierung der östlichen Außenwand des Rückgebäudes abzustellen, greift zu kurz.”
Den vollständigen Beitrag finden Sie in unseren BayVBl. Heft 12/2025.



