Abstandsflächen und Grundstücksteilungen
Rechtliche Bruchlinien zwischen Theorie und Praxis im öffentlichen Baurecht
Abstandsflächen und Grundstücksteilungen
Rechtliche Bruchlinien zwischen Theorie und Praxis im öffentlichen Baurecht
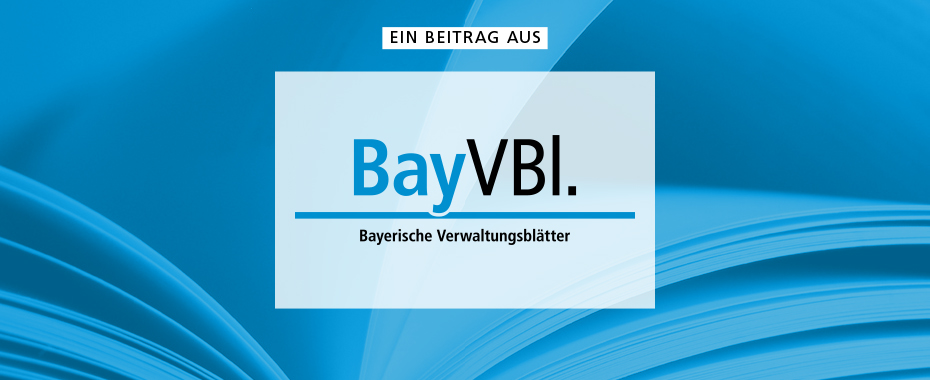
Das Auseinanderklaffen zwischen dem, was sein soll, und dem, was ist, ist in wenigen Bereichen so ausgeprägt wie im öffentlichen Baurecht. Bauherren halten sich nicht immer mit den rechtlichen Folgen ihres tatsächlichen Handelns auf, was die rechtliche Bewertung von Fehlentwicklungen umso schwerer macht.
Paradebeispiel sind Veränderungen von Grundstückszuschnitten und deren Folgen auf das Abstandsflächenrecht. Die rechtlichen Folgen einer Grundstücksteilung, die zu abstandsflächenrechtswidrigen Zuständen führt, sind umstritten und werden in Rechtsprechung und Literatur nicht einheitlich bewertet.
Aktuelle Entscheidungen des Verwaltungsgerichts München1 und des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs2 geben speziell vor dem Hintergrund uneinheitlicher Kommentarliteratur Anlass, das Problem darzustellen und Lösungswege, insbesondere Möglichkeiten behördlicher Reaktionen, aufzuzeigen.
1. Abstandsflächenrechtliche Probleme im Zusammenhang mit Grundstücksteilungen
1.1 Gesetzliche Regelung
Besitzt ein Vorhaben (Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung einer baulichen Anlage) Abstandsflächenrelevanz, so gilt nach Art. 6 Abs. 2 Satz 1 BayBO der Grundsatz, dass Abstandsflächen auf dem Grundstück selbst liegen müssen. Ausnahmen von diesem Grundsatz sieht die Bayerische Bauordnung in Art. 6 Abs. 2 Satz 2 (Abstandsflächen dürfen auch auf öffentlichen Verkehrs-, Grün- und Wasserflächen liegen, jedoch nur bis zu deren Mitte) und in Art. 6 Abs. 2 Satz 3 vor, wonach sich Abstandsflächen ganz oder teilweise auf andere Grundstücke erstrecken dürfen, wenn rechtlich oder tatsächlich gesichert ist, dass sie nicht überbaut werden, oder wenn der Nachbar gegenüber der Bauaufsichtsbehörde schriftlich zustimmt (sog. Abstandsflächenübernahme, gemäß § 3 Satz 1 DBauV genügt nunmehr die Abgabe eines elektronischen Abbilds bei der Bauaufsichtsbehörde). Die Abstandsflächenübernahme des Nachbarn gilt auch für und gegen seinen Rechtsnachfolger.
1.2 Nachträgliche Grundstücksteilungen
Ausgangssituation ist ein Vorhaben, das abstandsflächenpflichtig ist und diese Abstandsflächen zunächst ausschließlich auf dem eigenen Grundstück anfallen. Probleme treten dann auf, wenn eine nachträgliche (das heißt nach Erteilung der Baugenehmigung vorgenommene) Grundstücksteilung dazu führt, dass Teile der Abstandsflächen auf dem neu entstandenen Nachbargrundstück zum Liegen kommen. Dabei muss im Wesentlichen zwischen Vorhaben unterschieden werden, für die im Rahmen einer Baugenehmigung ausdrücklich zur Übereinstimmung mit dem Abstandsflächenrecht entschieden wurde (Fallgruppe 1, vergleiche hierzu Teilziffer 1.2.1), und Vorhaben, die ohne Baugenehmigung errichtet wurden oder deren Baugenehmigung sich zur Vereinbarkeit mit den Vorgaben des Abstandsflächenrechts nicht verhält (Fallgruppe 2, vergleiche hierzu Teilziffer 1.2.2).
1.2.1Fallgruppe 1:
Für das Vorhaben ist eine Baugenehmigung erteilt, welche die Übereinstimmung mit dem geltenden Abstandsflächenrecht, insbesondere die Lage der Abstandsflächen auf dem eigenen Grundstück, ausdrücklich feststellt (gegebenenfalls unter Erteilung von Abweichungen). Werden diese Abstandsflächen durch Grundstücksteilung vom Baugrundstück abgetrennt, existieren zwei konträre Auffassungen über das Schicksal der angefallenen Abstandsflächen. Nach einer Ansicht erstrecken sich die Abstandsflächen auf das abgetrennte, neu entstandene Nachbargrundstück, bleiben also in ihrem vollen Umfang unverändert bestehen (vergleiche hierzu Teilziffer a.). Nach einer anderen Auffassung führt eine nachträglich vorgenommene Grundstücksteilung dazu, dass die Abstandsflächen an der neu entstandenen Grundstücksgrenze enden und sich nicht auf das neue Nachbargrundstück erstrecken (vergleiche hierzu Teilziffer b.). Letztere Auffassung erscheint vorzugswürdig (vergleiche hierzu Teilziffer c.).
a) Es wird die Auffassung vertreten, dass genehmigte Abstandsflächen die Bebaubarkeit von Grundstücksteilen fortdauernd beschränken, auch wenn Grundstücksteilungen vorgenommen werden. Eine Abtrennung von Grundstücksteilen führe daher nicht dazu, dass auf dem abgeteilten Grundstück die Abstandsflächen entfallen.
In diese Richtung positioniert sich beispielsweise Hahn3 ausdrücklich unter Berufung auf eine Entscheidung der 8. Kammer des VG München4, ohne sich näher mit weiterer Rechtsprechung auseinanderzusetzen.
Da seit dem Wegfall der Teilungsgenehmigung (Art. 11 BayBO a. F.) baurechtswidrige Zustände nicht mehr vermieden werden könnten und die Teilung auch nicht wegen eines Verstoßes gegen ein Verbot im Sinn von § 134 BGB nichtig sei, wäre diese Rechtsfolge die einzige Möglichkeit, dem Abstandsflächenrecht zur Geltung zu verhelfen. Härtefälle könnten durch die Erteilung von Abweichungen gelöst werden.
Nicht konkret bezogen auf Grundstücksteilungen, aber dem Grunde nach für möglich hält auch Dirnberger5 die Erstreckung von Abstandsflächen auf Nachbargrundstücke ohne konkrete Abstandsflächenübernahme.
Die 8. Kammer des VG München hatte im Urteil vom 15. Dezember 2014 betreffend ein Bauvorhaben auf dem Nachbargrundstück des Landratsamts am Mariahilfplatz in München entschieden, dass bei einer Grundstücksteilung, welche die auf dem Gesamtgrundstück liegenden Abstandsflächen nicht berücksichtigt, diese (nicht berücksichtigten Abstandsflächen) mit einer entsprechenden Resttiefe auf dem abgeteilten Grundstück zu liegen kämen6. Anderenfalls könne durch eine Teilung das Abstandsflächenrecht nach Belieben außer Kraft gesetzt werden, ohne dass hierfür eine eigentumsrechtliche Notwendigkeit bestehe. Die Wertung des 1. Senats des BayVGH in einem Beschluss vom 14. Januar 20097, wonach der Eigentumsschutz die Erstreckung auf andere Grundstücke verbiete, sei im Fall der nachträglichen Grundstücksteilung nicht einschlägig, da der Eigentümer des abgeteilten Grundstücks an der Abteilung mitwirke, mithin den baurechtswidrigen Zustand selbst mitverantworte. Die 8. Kammer argumentiert dahingehend, dass die Erstreckung der Abstandsflächen auf das Nachbargrundstück den Regelfall darstelle und die Entscheidung des BayVGH vom 14. Januar 2009 lediglich einen Ausnahmefall betreffe, der mit dem Eigentumsschutz gerechtfertigt wird. Etwas anderes gelte allenfalls dann, wenn eine Teilungsgenehmigung erteilt wurde, da diese Genehmigung planungsrechtliche Bindungswirkung entfalte, was wiederum das bauordnungsrechtliche Abstandsflächenrecht verdränge.
b) Nach der widerstreitenden Auffassung ist Folge einer Grundstücksteilung, dass auf dem abgeteilten Grundstücksteil keine Abstandsflächen des auf dem benachbarten Grundstück gelegenen Gebäudes verbleiben und das abgetrennte Grundstück vollständig für dort belegene Gebäude nebst Abstandsflächen genutzt werden kann.
Verschiedene Entscheidungen des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs wurden in diese Richtung interpretiert. Im Beschluss vom 14. Januar 20098 vergleicht der 1. Senat den Fall mit einer fehlerhaften Abstandsflächenberechnung oder einer rechtswidrig erteilten Abweichung. In diesen Fällen bestehe zwar ein rechtswidriger Zustand. Die Rechtswidrigkeit liege aber nur darin, dass das Gebäude zu Unrecht an der Grenze steht beziehungsweise einen zu geringen Grenzabstand einhält. Der Rechtsverstoß habe hingegen nicht zur Folge, dass sich die Abstandsfläche auf das Nachbargrundstück erstreckt.
Eine solche Rechtsfolge käme nach Ansicht des Senats nur bei einer Abstandsflächenübernahme im Sinn von Art. 6 Abs. 2 Satz 3 BayBO n. F. in Betracht. Nur diese Auslegung vermeide eine unverhältnismäßige Belastung des Eigentumsrechts des Nachbarn.
In einer aktuellen Entscheidung des BayVGH9, bekräftigt der 1. Senat, wenn auch ohne vertiefte Begründung, dass ein durch (nachträgliche) Grundstücksteilung entstandener rechtswidriger Zustand nur dazu führt, dass das Gebäude auf dem verbleibenden Hauptgrundstück einen zu geringen Grenzabstand einhält, nicht aber dazu, dass sich die Abstandsfläche (teilweise) auf das abgeteilte Nachbargrundstück erstreckt und (auch) dort von einer in den Abstandsflächen nicht zulässigen Bebauung freigehalten werden muss beziehungsweise dass die Abstandsflächen nicht auf die auf diesem Grundstück erforderlichen Abstandsflächen angerechnet werden dürfen.
Auch das VG München hatte sich in seinem Beschluss vom 19. Oktober 2023 mit der Frage zu befassen10.
Die 9. Kammer entschied mit deutlich ausführlicherer Begründung, dass die Grundstücksteilung nicht zur Folge hat, dass die Abstandsflächen des Gebäudes des Antragstellers teilweise auf das heutige Nachbargrundstück fallen und diese Flächen damit der Inanspruchnahme für Gebäude auf dem (heutigen) Nachbargrundstück der Antragsgegnerin entzogen wären.
Es sei der Grundsatz zu berücksichtigen, dass Abstandsflächen an der Grundstücksgrenze enden, es sei denn, es gibt abweichende Regelungen. Derartige Regelungen fehlten aber. Wortlaut und Systematik des Art. 6 BayBO sprächen daher gegen eine Erstreckung. Wie bereits die 11. Kammer des VG München in ihrem Beschluss vom 30. Juni 2020 berücksichtigt die 9. Kammer historische Erwägungen: Die Teilungsgenehmigungspflicht in Art. 11 BayBO a. F., die vor allem wegen abstandsflächenrechtswidriger Teilungen von Grundstücken existieren sollte, zeige, dass der Gesetzgeber selbst davon ausging, dass im Fall einer Teilung sich die Abstandsflächen nicht auf das Nachbargrundstück erstrecken11. Da das Abstandsflächenrecht nach der Aufhebung der Teilungsgenehmigungspflicht nicht geändert oder angepasst wurde, sei weiterhin von dieser Wertung auszugehen. Bei einer Grundstücksteilung kämen daher keine Abstandsflächen auf abgeteilten Grundstücken zu liegen. Ebenfalls zum gleichen Ergebnis mit etwas anderer historischer Argumentation kommt das VG Würzburg in seinem Beschluss vom 20. September 201612.
Diese Erkenntnisse stehen im Einklang mit der überwiegenden Auffassung in der Literatur. Nach Molodovsky/Famers/Waldmann13 kommt eine Erstreckung von Abstandsflächen nur in den gesetzlich geregelten Fällen, also insbesondere nur bei einer schriftlichen Abstandsflächenübernahme, in Betracht. Das gelte auch bei abstandsflächenrechtswidrigen Grundstücksteilungen. Nicht ausdrücklich zu Grundstücksteilungen, aber mit entsprechenden Erwägungen wird von Schwarzer/König14 argumentiert. Auch Schönfeld15 verweist darauf, dass sich andernfalls eine unverhältnismäßige Belastung des betroffenen Eigentümers ergebe, denn er dürfte zumindest die von der Abstandsflächenerstreckung erfasste Fläche seines Grundstücks aufgrund des Überlappungsverbots nicht mehr für eigene Abstandsflächen in Anspruch nehmen. Weil sich selbst bei Eigentümeridentität die Abstandsflächen nicht ohne Weiteres auf das angrenzende Buchgrundstück desselben Eigentümers erstrecken, führe auch eine „einvernehmliche” spätere Grundstücksteilung unter Missachtung der abstandsflächenrechtlichen Vorgaben nicht zu einem anderen Ergebnis. Auch Hauth16 gelangt mit einer in der Sache gleichen, aber tiefgreifenderen systematischen und historischen Auslegung zu diesem Ergebnis.
c) Im Ergebnis sprechen überwiegend Gründe dafür, eine Erstreckung der Abstandsflächen auf das Nachbargrundstück abzulehnen.
So steht die Systematik des Art. 6 BayBO einer anderen Beurteilung entgegen: Die Fälle, in denen die Abstandsflächen auf fremden Grundstücken zu liegen kommen, sind in Art. 6 Abs. 2 BayBO ausdrücklich und somit abschließend aufgezählt.
Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Belastung von Grundstücken mit fremden Abstandsflächen bereits im Fall der schriftlichen Abstandsflächenübernahme erheblicher Kritik im Hinblick auf Eigentumsschutz und Rechtssicherheit ausgesetzt ist17. Das Grundeigentum ist in diesem Fall mit erheblichen Baurechtsbeschränkungen belastet, die allerdings nirgends katastermäßig und daher publizitätswirksam erfasst sind. Es genügt, wenn sich die Beschränkung aus einem Schriftstück ergibt, das sich an irgendeiner Stelle in vorhandenen Bauakten findet. Diese massive Einschränkung des sonst im Grundstücksverkehr hochgehaltenen Publizitätsgrundsatzes ergibt sich aus dem eindeutigen Gesetzeswortlaut. Eine Erweiterung derartiger Einschränkungen ohne konkrete Regelung entbehrt einer gesetzlichen Grundlage. Erwerber künftiger Grundstücke müssten letztlich nicht nur die Bauakten des Kaufgrundstücks durchsehen, um das Vorliegen einer Abstandsflächenübernahme auszuschließen, sondern auch sämtliche Nachbarbauakten prüfen, ob nicht zu früheren Zeiten eine abstandsflächenrechtswidrige Abteilung von Grundstücksflächen durchgeführt wurde, wegen der das Kaufgrundstück mit fremden Abstandsflächen belastet ist.
1.2.2 Fallgruppe 2:
Das Abstandsflächenrecht wurde nicht durch die Genehmigungsbehörde geprüft.
Den bisher zitierten Entscheidungen lag der Sachverhalt zugrunde, dass für ein genehmigungspflichtiges Vorhaben im Rahmen der Baugenehmigung das Abstandsflächenrecht geprüft wurde und zeitlich danach die Teilung des Grundstücks erfolgte.
Anzusprechen sind aber auch solche Fälle, in denen es für das Vorhaben keiner Entscheidung über das Abstandsflächenrecht bedurfte. In Betracht kommt dies etwa bei einer Genehmigungsfreistellung oder bei einer Baugenehmigung, die zwischen 2008 und 2018 erteilt wurde, als das Abstandsflächenrecht nicht Bestandteil des Prüfprogramms für das vereinfachte Genehmigungsverfahren war18.
Gerade in letzterem Fall oblag es den am Bau Beteiligten, auch die Einhaltung der materiellrechtlichen Voraussetzungen, die nicht Gegenstand der Feststellungswirkung der Baugenehmigung waren, zu beachten (Art. 55 Abs. 2 BayBO).
Letztlich darf sich aus der Selbstverantwortlichkeit der am Bau Beteiligten aber kein anderes Ergebnis ergeben als für die Fallgruppe 1 geschildert. Denn die Abstandsflächen fallen in der gesetzlich vorgesehenen Tiefe in jedem Fall an, unabhängig davon, ob sie in einem genehmigten Bauplan dargestellt wurden. Ebenso gelten in diesen Fällen die ausdrücklichen und abschließend geregelten Ausnahmen, in denen sich Abstandsflächen auf andere Grundstücke erstrecken. Gerade weil noch nicht einmal eine Feststellungswirkung einer die Abstandsflächen prüfenden Baugenehmigung existiert, stellen sich im Hinblick auf die Publizität der Grundstücksbeschränkung die gleichen Schwierigkeiten wie in Fallgruppe 1 dargelegt.
Den vollständigen Beitrag finden Sie in unseren BayVBl. Heft 11/2025.



