Bundeswehr und Innere Sicherheit
Neuorientierung in der Zeitenwende
Bundeswehr und Innere Sicherheit
Neuorientierung in der Zeitenwende
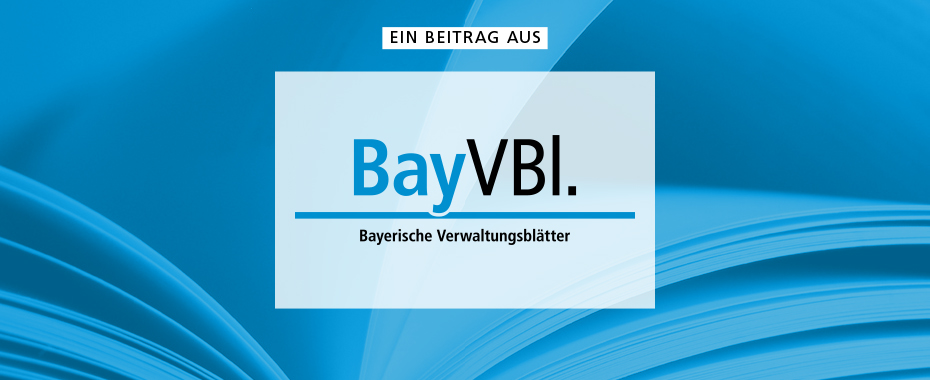
Angesichts der bereits beginnenden Erosion der Grenzen zwischen Innerer und Äußerer Sicherheit, der wachsenden Bedrohung durch den internationalen Terrorismus und der zunehmenden Bedrohung der kritischen Infrastruktur und des Cyberraums durch hybride Einsatzmittel gewinnt die seit Jahren festgefahrene und kontroverse Diskussion um den Einsatz der Streitkräfte zur Unterstützung der Polizei bei der hoheitlichen Gefahrenabwehr im Innern einen neuen Impetus. Im Beitrag soll aufgezeigt werden, dass sich bisher lediglich die unionsgeführten Länder und die Fraktion der CDU/CSU bemüht haben, in den durch ideologische Vorfestlegungen und unbelegte Stereotypen bestimmten politischen Entscheidungsprozessen Verfassungstheorie und Verfassungswirklichkeit zur Deckung zu bringen und neue Akzente zu setzen.
I.Zeitenwende – auch in der Inneren Sicherheit
Es gehört zu den Paradoxien der deutschen Sicherheitspolitik, dass auf zutreffende Beurteilungen der Lage selten entsprechende Konsequenzen folgen. Allerdings scheint zunehmend deutlicher zu werden, dass angesichts der zunehmenden Verschärfung der Lage die föderale Sicherheitsstruktur neu justiert werden muss. So plädiert der vormalige Generalleutnant und nunmehrige Bundesbeauftragte für Krisenresilienz bei den Maltesern, Martin Schelleis, für eine umfassende Sicherheitsvorsorge und ganzheitliche Krisenresilienz1. In einem Beitrag in einem Nachrichtenmagazin forderte der Präsident des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, eine Zeitenwende der Inneren Sicherheit und bei den Sicherheitsbehörden. Internationale Krisen und Konflikte sowie hybride Aktionen aus dem Cyberraum hätten die Lage in Deutschland so weit verschärft, dass Innere und Äußere Sicherheit nicht mehr separiert gedacht werden können2. Auch die neue Bundesregierung verspricht im Koalitionsvertrag, den multiplen Bedrohungen von außen und im Innern mit einer Zeitenwende in der Inneren Sicherheit zu begegnen3.
Spätestens seit den hybriden Anschlägen auf die kritische Infrastruktur (Krisis) im Küstenvorfeld und der zunehmenden Beobachtung illegaler Drohnen über sensiblen Anlagen im Inland wird erstmalig seit Langem wieder der Einsatz der Streitkräfte zur Unterstützung der Polizei diskutiert, da sowohl die Bundespolizei als auch die Länderpolizeien nicht über die materiellen und personellen Ressourcen verfügen, insbesondere den Schutz der besonders gefährdeten, maritimen kritischen Infrastrukturen im Küstenvorfeld und die Abwehr hochfliegender Drohnen wahrzunehmen. Zu den damit verbundenen Problemen stellte der Marineinspekteur, Vizeadmiral Jan Christian Kaack, in einem Interview angesichts der zunehmenden hybriden Attacken auf die Unterwasser-Infrastruktur in der Ostsee fest, dass Kabelbetreiber, private Unternehmen und Sicherheitsbehörden die Sicherheit in der Ostsee als gemeinsames Anliegen sehen und schnell eine gemeinsame Datenbasis aufbauen müssten. Allerdings benötigten die Beteiligen Klarheit, wer in welchen Situationen wie und wo eingreifen darf, sowie einen Regelungsrahmen, der zur Bedrohungslage passt4.
Gleichwohl steht die Bundesregierung auch aktuell unverändert auf dem Standpunkt, dass eine Bereitstellung von militärischen Fähigkeiten nur in den im Grundgesetz genannten Fällen zulässig sei. Subsidiäre Hilfeleistungen im Sinne einer Amtshilfe seien nicht bedarfsbegründend und daher gebe es keine Analyse militärischer Fähigkeiten und keine Abbildung im Verteidigungsetat5. Im Rahmen der Beantwortung einer Kleinen Anfrage stellte sie ausdrücklich fest: Auf Grund der grundgesetzlich festgelegten Kompetenzverteilung hat die Bundeswehr keine unmittelbare Zuständigkeit für die Sicherung unterseeischer Infrastruktur6.
Im Gegensatz zu diesen Aussagen steht der überraschende Kabinettsbeschluss der vormaligen Ampelkoalition, die im Januar 2025 die Fachwelt mit der Ankündigung von Rechtsgrundlagen überraschte, mit denen der Bundeswehr künftig der Abschuss illegaler Drohnen ermöglicht werden soll7. Dieser Beschluss ist umso bemerkenswerter, als bisher gerade die Ampelkoalitionäre es strikt ablehnten, die Bundeswehr zur Gefahrenabwehr im Innern einzusetzen. So ist aktuell die Überwachung des Drohneneinsatzes und die Abwehr illegaler Drohnen Aufgabe der zivilen Gefahrenabwehrbehörden. Allerdings stellte sich schnell heraus, dass nicht nur Zuständigkeiten ungeklärt sind, sondern dass auch die Eingriffsmöglichkeiten fehlen. Bei der Bedrohung von Bundeswehreinrichtungen wären die Streitkräfte im Rahmen ihrer Selbstschutzrechte zuständig. Bei Angriffen auf die Sicherheit des Luftverkehrs auf 13 Flugplätzen, auf Bahnanlagen und beim Schutz von Verfassungsorganen des Bundes und der Bundesministerien wird die Bundespolizei in die Pflicht genommen. Die Rechtslage bei Angriffen auf maritime kritische Infrastruktur im Küstenvorfeld ist unklar. In allen anderen Fällen sind die Landespolizeien für die Abwehr von Gefahren zuständig, die von illegalen Drohnen ausgehen. Neben den Zuständigkeiten und der Klärung von Zweifelsfragen bei überschneidenden Zuständigkeiten müssten aber auch die Befugnisse sowie die Haftung bei abstürzenden Trümmerteilen geklärt werden. Soweit erkennbar, hat lediglich ein Gesetzentwurf zur Reform des Bundespolizeigesetzes auf diese Herausforderungen reagiert. Er enthält eine spezielle Befugnisnorm zur Drohnenabwehr durch die Bundespolizei mit modernsten technischen Mitteln, zum Beispiel durch elektromagnetische Impulse, die Störung von Funkverbindungen oder durch physische Einwirkung auf Drohnen8.
Mit der Gesetzesinitiative der vormaligen Ampel soll die Bundeswehr bei einem drohenden, besonders schweren Unglücksfall eine Befugnis erhalten, illegal fliegende Drohnen abzuwehren. Voraussetzung ist, dass die für die Gefahrenabwehr grundsätzlich zuständigen Polizeien des Bundes und der Länder technisch dazu nicht in der Lage sind und entsprechende Unterstützung anfordern. Der Gesetzentwurf soll eine Änderung des Luftsicherheitsgesetzes vorsehen, welches bereits jetzt im dritten Abschnitt die Amtshilfe und Unterstützung durch die Streitkräfte vorsieht. Gesetzestechnisch soll § 14 Abs. 1 LuftSiG als neue Befugnis die Anwendung von Waffengewalt gegen unbemannte Luftfahrzeuge ergänzen. Aktuell dürfen die Streitkräfte Luftfahrzeuge abdrängen, zur Landung zwingen, den Einsatz von Waffengewalt androhen oder Warnschüsse abgeben, Maßnahmen gegen unbemannte Luftfahrzeuge sind nicht berücksichtigt. Die neue Befugnis soll nur dann gelten, wenn nach den Umständen davon auszugehen ist, dass ein unbemanntes Luftfahrzeug gegen das Leben von Menschen oder gegen eine kritische Anlage eingesetzt werden soll, und sie das einzige Mittel zur Abwehr dieser gegenwärtigen Gefahr ist.
Auch wenn die Zeit drängt und hochrangige Sicherheitskreise mehr Abstimmung und eine bessere Koordination zwischen Landespolizeien, BKA, Bundespolizei und Bundeswehr fordern, während der Abgeordnete der Grünen, Konstantin von Notz, ein gemeinsames Zentrum zur Abwehr und Erkennung hybrider Angriffe in Anlehnung an gemeinsame Terrorabwehrzentren vorschlägt9, ist das Vorhaben mit einer Fülle offener Fragen verknüpft. Da es sich meistens um Eilfälle handelt, müssen Wege gefunden werden, wie Unterstützungsersuchen verzugslos umgesetzt werden können. Ebenso muss geklärt werden, unter wessen Verantwortung, nach welchen Rechtsgrundlagen und mit welchen Abwehrmitteln die Einsatzführung erfolgt. Auch darf man gespannt sein, wie die neue Bundesregierung ihr Versprechen im Koalitionsvertrag umsetzt, dass der Bund die rechtlichen, technischen und finanziellen Voraussetzungen für eine wirksame Drohnendetektion und -abwehr auch durch die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern schafft10.
II.Die Fesseln des Verfassungsrechts
Alle bisherigen Versuche der Fachliteratur, eine Einsatzmöglichkeit der Bundeswehr außerhalb des derzeitigen Wortlauts der Verfassung zu konstruieren11, scheiterten an ihrem strikten Wortlaut. Nach Art. 87a Abs. 2 des Grundgesetzes dürfen die Streitkräfte nur eingesetzt werden, soweit das Grundgesetz es ausdrücklich zulässt. Damit soll verhindert werden, dass für die Verwendung der Streitkräfte als Mittel der vollziehenden Gewalt „ungeschriebene Zuständigkeiten aus der Natur der Sache” abgeleitet werden12. Ein Einsatz im Sinne des Art. 87a Abs. 2 GG liegt vor, wenn die Ressourcen der Streitkräfte als Mittel der vollziehenden Gewalt in einem Eingriffszusammenhang verwendet werden13. Bei den Regelungen, durch welche im Sinn des Art. 87a Abs. 2 GG der Einsatz der Streitkräfte im Grundgesetz außer zur Verteidigung (Art. 87a Abs. 1 Satz 1 GG) ausdrücklich zugelassen wird, handelt es sich um Art. 87a Abs. 3 GG (äußerer Notstand), Art. 87a Abs. 4 GG (innerer Notstand) sowie Art. 35 Abs. 2 Satz 2 GG (regionaler Katastrophennotstand) und Art. 35 Abs. 3 GG (überregionaler Katastrophennotstand). Für die Anwendung dieser Alternativen eines Einsatzes der Bundeswehr im Innern gilt das Gebot strikter Texttreue14.
Der strenge Verfassungsvorbehalt, wonach jeder nicht der Verteidigung dienende Einsatz durch das Grundgesetz ausdrücklich zugelassen sein muss, hat als Trennungsgebot Eingang in die Fachdiskussion gefunden und meint die grundsätzliche Trennung von äußerem und innerem Gewaltmonopol, ist jedoch keineswegs mehr politischer Konsens15. Ungeachtet dieser Vorgaben ist es in der Fachliteratur zu einer Fülle der Ratio des Art. 87a GG widersprechenden Interpretationen gekommen, nach denen beispielweise auch die Abwehr terroristischer Angriffe im Innern dem Verteidigungsbegriff unterfallen16.
III.Die ablehnenden Argumente – viel Behauptung, wenig Beweis
Das in der Fachliteratur häufig unter Berufung auf historische Hypotheken strapazierte und an keiner Stelle verfassungsgerichtlich ausbuchstabierte Trennungsprinzip der Aufgabenwahrnehmung von Polizei und Militär wird in aller Regel nicht weiter begründet17. Nach Richter Gaier gehört diese Trennung sogar zum genetischen Code der Bundesrepublik18. Tatsächlich spielte im Parlamentarischen Rat der Einsatz der Streitkräfte allerdings keine Rolle, da die Bundesrepublik als Staat ohne eigene Armee entstand19. Zur Rolle der Polizei und zur Gewährleistung der Inneren Sicherheit finden sich nur rudimentäre Materialien, da es sich hierbei von vornherein um eine undiskutierte Ländermaterie handelte. Und auch bei der Verabschiedung der Wehr- und Notstandsverfassung waren die sich ständig verschärfenden Krisen-, Gefährdungs- und Katastrophenlagen neuer Zeitrechnung nicht bekannt und wurden somit auch erst gar nicht in die legislatorischen Überlegungen einbezogen. Folglich lässt sich aus der Verfassung ein explizites Trennungsprinzip nicht herauslesen. Vielmehr signalisiert eine Zusammenschau der Art. 35, 87a und 91 GG, dass der Verfassungsgeber bei gegebenem Anlass bewusst die Verwaltungsgrenzen zeitlich, sachlich und örtlich begrenzt durchbrechen wollte, um die zur Verfügung stehenden personellen und materiellen Ressourcen effizient einzusetzen.
Nach anderer Lesart ist die Bundeswehr für polizeiliche Aufgaben nicht ausgebildet und nicht ausgerüstet20. Der Gesetzgeber sieht das anders. Nach dem Gesetz über die Anwendung unmittelbaren Zwanges und der Ausübung besonderer Befugnisse durch Soldaten der Bundeswehr und verbündeter Streitkräfte sowie zivile Wachpersonen sind Bundeswehrsoldaten bei der Ausübung ihres Wachdienstes unter anderem berechtigt, Personen anzuhalten und zu überprüfen (§ 4), vorläufig festzunehmen (§ 6), bei Personenüberprüfungen zu durchsuchen und zu beschlagnahmen (§ 7), Personen zu fesseln (§ 14) und die Schusswaffe gegen Personen zu gebrauchen (§ 15). So ist es nach Auffassung der Bundesregierung sogar möglich, bei bestimmten Anlässen eine begrenzte Anzahl von Soldaten zur Bundespolizei abzustellen und sie nach § 63 Abs. 2 BPolG zu Hilfspolizeibeamten der Bundespolizei zu bestellen21.
Zu den Ungereimtheiten bei der rechtlichen Bewertung des Zusammenwirkens von Polizei und Streitkräften gehört auch die Tatsache, dass das hierbei bemühte innerstaatliche Trennungsgebot offensichtlich bei Auslandseinsätzen keine Gültigkeit hat. So beteiligten sich deutsche Streitkräfte an der EU-Operation EUNAVFOR MED als Teil der Gesamtinitiative der EU zur Unterbindung des Geschäftsmodells der Menschenschmuggel- und Menschenhandelsnetzwerke im südlichen und zentralen Mittelmeer, die zudem der Unterbindung der irregulären Migrationsströme dienen sollte. Als Eingriffsmaßnahmen waren das Anhalten, die Durchsuchung, das Umleiten und letztendlich die Zerstörung von etwaigen Schmuggelschiffen vorgesehen. Dabei konnten bei verdächtigen Personen personenbezogene Daten erhoben und erkennungsdienstliche Maßnahmen durchgeführt und Daten mit den Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten und/oder den zuständigen Stellen der Union ausgetauscht werden. Als Rechtsgrundlage wurden neben dem Völkerrecht die Zusatzprotokolle zum Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen gegen die Schleusung von Migranten auf dem Land-, See- und Luftweg aus dem Jahr 2000 und zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels sowie das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität bemüht22.
Ein weiteres Argument für die prinzipielle Aufgabentrennung sind die dunklen Traditionslinien deutscher Militärgeschichte sowie unheilvolle Verstrickungen der Streitkräfte in innenpolitische Auseinandersetzungen23 und der Einsatz der bewaffneten Macht in der Weimarer Republik als praktisch anerkanntes Repertoire staatlicher Reaktionen auf Demonstrationen und sozialen Aufruhr24. Auch wenn ausnahmsweise der Reichspräsident nach Art. 48 Abs. 2 der Weimarer Reichsverfassung die bewaffnete Macht bei erheblichen Störungen „erforderlichenfalls” einsetzen konnte, waren die Maßnahmen auf Verlangen des Reichstages aufzuheben. Selbst unter diesen Vorzeichen lag aber die vollziehende Gewalt nicht bei der Reichswehr, sondern bei den Polizeien der Länder, deren Einsatz dem der Reichswehr vorging25. Gleichwohl wurde vom möglichen Einsatz der Reichswehr im Innern nur wenig Gebrauch gemacht. Dies kam auch in den 1921 vom Reichswehrministerium erlassenen Richtlinien für das Verhältnis zwischen Polizei und Reichswehr zum Ausdruck. Danach kam der Einsatz der Reichswehr nur infrage, wenn die Kräfte der kasernierten Polizei nicht ausreichten oder zur Lagebewältigung nicht in der Lage waren. Selbst dann erfolgte der Einsatz stets unter Führung der Polizei. Insbesondere der preußische Ministerpräsident Otto Braun und der preußische Innenminister Carl Severing ließen seit 1920 beginnend keinen Zweifel daran, dass bei einem Ausnahmezustand die vollziehende Gewalt bei den zivilen Reichskommissaren und nicht bei den Militärbefehlshabern lag26. Dies kam letztlich auch der Reichswehr entgegen. In einem Schreiben vom 10. Juni 192227 wandte sich der Chef der Heeresleitung von Seeckt dezidiert gegen eine Dauerübertragung polizeilicher Aufgaben an die Reichswehr und bezeichnete diese Möglichkeit als „Ende der Reichswehr”, da diese aus allen innenpolitischen Auseinandersetzungen herauszuhalten sei.
Im Nationalsozialsozialismus enthielt das Wehrgesetz vom 21. Mai 1935 keine Regelung zum Einsatz der Wehrmacht im Innern, wie es noch im Wehrgesetz 1921 der Weimarer Republik vorgesehen war28. Dies war bei der Struktur des Regimes auch gar nicht erforderlich.
Der Verweis auf angebliche historische Hypotheken kann für das heutige Verhältnis von Polizei und Streitkräften – genauso wie für andere staatliche Institutionen, die zwischen 1919 und 1945 demokratischen Ansprüchen nicht gerecht wurden – nicht Maßstab sein. Vielmehr ist jeder Verdacht in diese Richtung ein Misstrauensbeweis gegen Polizei und Bundeswehr, deren demokratische Dignität, Verfassungstreue und Zuverlässigkeit ernsthaft nicht bezweifelt werden können29. Dass die Bundeswehr als fest in die Gesellschaft integrierte Parlamentsarmee bei einem Einsatz im Innern gar einen „Machtmissbrauch durch den Bund” ermöglichen könnte, ist angesichts der heutigen öffentlichen Kontrollmechanismen irrational. Im Gegensatz zum Militär früherer Zeiten hat sie keinerlei institutionellen und gesellschaftlichen Schonraum mehr. Selbst die Befürchtung einer „Militarisierung der Polizei” ist absurd, da allfällige Einsätze grundsätzlich unter polizeilicher Führung erfolgen und die starken Polizeigewerkschaften jegliche „Militarisierung” im Ansatz unterbinden würden. Beweise hierfür gibt es zur Genüge. Darüber hinaus ist bis dato sozialwissenschaftlich überhaupt nicht untersucht, was unter Militarisierung überhaupt zu verstehen ist30, zumal in der aktuellen Diskussion um Herstellung von Kriegstüchtigkeit eine ganz andere Konnotation dieses Phänomens eingetreten ist.
Entnommen aus den BayVBl. Heft 18/2025.



