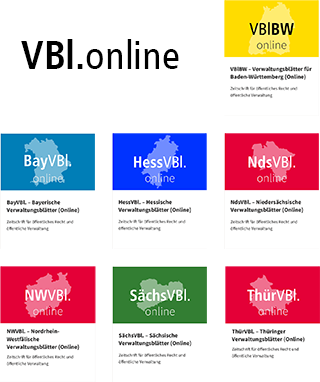Biodiversität und Recht im Kontext der Nachhaltigkeitsdebatte
Warum die (juristische) Welt lieber über den Klimawandel redet
Biodiversität und Recht im Kontext der Nachhaltigkeitsdebatte
Warum die (juristische) Welt lieber über den Klimawandel redet

Der Erhalt der biologischen Vielfalt spielt unstreitig eine absolut zentrale und unersetzliche Rolle im Rahmen der Nachhaltigkeitsbetrachtung. Sie ist nicht nur ein Ziel nachhaltiger Entwicklung, sondern auch eine wesentliche Voraussetzung dafür.
Biodiversität ist die Basis für alle „Dienstleistungen“, die uns die Natur kostenlos zur Verfügung stellt und die für unser Überleben und Wohlbefinden unerlässlich sind. Eine hohe Biodiversität macht Ökosysteme widerstandsfähiger gegenüber Störungen wie Klimawandel, Naturkatastrophen, Krankheiten und Schädlingen. Viele Wirtschaftszweige, wie Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft, Tourismus und Pharmaindustrie, sind direkt oder indirekt von der Biodiversität abhängig. Der Verlust der Artenvielfalt kann global immense wirtschaftliche Schäden verursachen und die langfristige ökonomische, gesellschaftliche und geopolitische Stabilität gefährden.
Dominanz der Klimaschutzdebatte
Daher stellt sich die Frage, warum der Klimawandel in der öffentlichen und politischen Debatte eine so viel größere Rolle spielt als der Biodiversitätsverlust, obwohl beide Krisen untrennbar miteinander verbunden sind und der Verlust der biologischen Vielfalt mindestens ebenso existenzbedrohend ist. Dies hat wohl verschiedene Gründe.
· Die Auswirkungen des Klimawandels (z.B. extreme Wetterereignisse wie Hitzewellen, Dürren, Überschwemmungen, Waldbrände) sind oft dramatisch, direkt spürbar und medial sehr präsent. Sie betreffen Menschen unmittelbar in ihrem Alltag und verursachen sichtbare Schäden. Der Rückgang der Biodiversität ist dagegen oft ein schleichender Prozess, der weniger direkt wahrnehmbar ist.
· Hinter dem Verlust der Artenvielfalt steht ein wesentlich abstrakteres Konzept. Der Begriff „Biodiversität“ selbst ist umfassend und beschreibt eine Vielzahl von Phänomenen (genetische Vielfalt, Artenvielfalt, Ökosystemvielfalt). Zwar sind auch die Zusammenhänge des Klimawandels komplex. Sie lassen sich aber häufig in einfachen Metriken ausdrücken, z.B. „die Globaltemperatur steigt“, „CO₂-Emissionen“, „Meeresspiegelanstieg“.
· Studien zeigen, dass die Medien dem Klimawandel eine deutlich höhere Berichterstattung widmen als der Biodiversität (z.B. MaLisa Stiftung/LMU München/ FU Berlin, Klimawandel und Biodiversität: Was zeigt das Fernsehen? Was wollen die Zuschauer*innen?, 2023/2024). Beispielsweise die entscheidenden globalen Zusammenkünfte wie die Klima-Gipfel (COPs), z.B. wie COP27 in Ägypten, erhalten wesentlich mehr mediale Aufmerksamkeit als Biodiversitäts-Gipfel (z.B. COP15 in Montreal).
· Die Ursachen des Klimawandels scheinen klar zuzuordnen zu sein (z.B. Emissionen durch fossile Brennstoffe, Industrie, Verkehr), deren denkbare Lösungsansätze (z.B. Energiewende, E-Mobilität, Effizienzsteigerung) konkreter scheinen. Mögliche Gegenmaßnahmen lassen sich auf die Ebene individuellen Handelns projizieren. Der Biodiversitätsverlust hat oft diffusere Ursachen (z.B. Landnutzungsänderungen, intensive Landwirtschaft, Zerschneidung von Lebensräumen, Umweltverschmutzung, invasive Arten). Die Lösungsansätze sind ebenfalls breiter gefächert und erfordern oft komplexe, lokale Maßnahmen.
· Die Transformation hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft wird oft als große Chance für Innovation und neue Technologien dargestellt, auch wenn sie mit enormen Aufwendungen verbunden ist. Die ökonomischen Kosten des Biodiversitätsverlusts sind schwieriger zu quantifizieren, da es um den Wert von „Ökosystemleistungen“ geht. Die Schutzmaßnahmen betreffen oft die Landnutzung und damit direkt traditionelle Wirtschaftszweige wie Landwirtschaft und Forstwirtschaft, was sehr konfliktträchtig ist.
· Der Klimawandel hat durch Institutionen wie den IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) und die UN-Klimarahmenkonvention (UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate Change) eine sehr starke internationale politische Rahmung erhalten, die regelmäßig Gipfeltreffen und Verhandlungen hervorbringt. Für Biodiversität gibt es zwar die UN-Konvention über die biologische Vielfalt (CBD) und IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services), diese haben aber (bisher) nicht die gleiche politische Durchschlagskraft wie die Klimapolitik.
Folgen für den rechtspolitischen Diskurs und Handeln
Vor diesem Hintergrund ist es sicherlich keine gewagte These, dass die geringere öffentliche Wahrnehmung und Aufmerksamkeit für die fatalen Folgen des Artensterbens Auswirkungen auf die legislativen Initiativen hat. So könnte der Schluss naheliegen, dass im Schatten der Klimaschutzregulierung einem gesetzgeberischen Angehen gegen den Biodiversitätsverlust das Tor geöffnet wird. Dem ist aber nicht so.
Zumindest auf bundesdeutscher Ebene lässt sich feststellen, dass der Bekämpfung des Klimawandels – ohne Zweifel mit positiven Absichten – qualitativ deutlich mehr gesetzgeberische Aktivitäten gewidmet werden. Beispielhaft steht hierfür das Gesetz zum erneuerbaren Heizen und die damit einhergehenden politischen, aber auch grundsätzlich gesellschaftlichen und sozialen Diskussionen. Grundlegende Reformen des Umweltrechts lassen aber auf sich warten. Nach wie vor sind die ökologisch bewahrenden Rechtsgrundlagen über zahlreiche Gesetze verstreut. Hinzu kommt, dass die föderalistischen Verästelungen viele regionale und landespolitische Spielräume lassen. So ist mit der letzten großen Reform der umweltrechtlichen Kompetenzaufteilung die Bundesebene zugunsten der Länder geschwächt worden, zuallererst im Naturschutz- und Wasserrecht.
In der Folge der Föderalismusreform 2006 hat sich alleine der Übergang von der Rahmengesetzgebung des Wasserrechts beispielhaft bis zum neuen Wasserhaushaltsgesetz vier Jahre hingezogen. Das letzte Anpassungsgesetz hat 2019 der Freistaat Thüringen erlassen. Die wesentlichen gesetzgeberischen Vorgaben waren auch hier Ergebnis eines politischen Kompromisses zu Lasten der Flora und Fauna, was beispielhaft an der Festlegung von Gewässerrandstreifen illustriert werden kann, wo zehn Meter im Außen- und fünf Meter im Innenbereich dem nachhaltigen Gewässerschutz in nur sehr überschaubarem Maße dienlich sind.
Viel besser sieht es nicht auf dem Gebiet der Naturschutzgesetzgebung aus. Hier sind die Reformbemühungen auf allen Ebenen in den Kinderschuhen stecken geblieben. Dies gilt für die Ausweisung von geschützten Naturflächen ebenso wie für artenschutzrechtliche Vorgaben. Die Anpassung an die „neue“ Gesetzgebungsverteilung durch die Länder hat auch hier bis zum ThürNatSchG 2019 angedauert. Die bundesdeutschen Defizite beim Gebietsnaturschutz trotz eindeutiger Vereinbarungen wurden im internationalen Vergleich gerügt (vgl. Cazzolla Gatti, R., Zannini, P., Piovesan, G. et al., Analysing the distribution of strictly protected areas toward the EU2030 target, Biodivers Conserv 32, 3157 ff., 2023). Vielerorts wird gegen die Festsetzung ökologisch hochwertiger Flächen lokal hart gekämpft. Aktuell-beispielhaft seien die Widerstände gegen einen Nationalpark Steigerwald oder ein Biosphärenreservat Spessart in Unterfranken als potenzielle Großschutzgebiete genannt.
Verschärft wurde die regulatorische Diversifikation durch die Aufnahme von Abweichungsmöglichkeiten nach Art. 72 Abs. 3 GG, so dass die Länder auf bestimmten Feldern vom Bundesrecht unterschiedliche Festsetzungen treffen können. Darüber hilft auch nicht die Festlegung abweichungsfester Kerne hinweg, zumal diese ein interpretationsbedürftiges Regel-Abweichungs-Prinzip gerade für zwei wesentliche Bereiche im Kontext der Biodiversität konstituieren.
Einen Lichtblick stellt die Europäische Union dar, die im Zuge des mittlerweile erheblich ausgedünnten Green Deals als Megaprojekt der ersten Kommission „von der Leyen“ zahlreiche Vorhaben auf den Weg gebracht hat. Zu nennen sind die EU-Renaturierungsverordnung (Nature Restoration Law) wie auch die EU-Entwaldungsverordnung (EU Deforestation Regulation). Beide Gesetzeswerke bedürfen einer wesentlichen Umsetzung auf nationaler Ebene zur Erfassung, Evaluation und Entwicklung der relevanten Flächen. Von Kritikern als Bürokratieaufbau verschrien, versuchen sie, über Lobbygruppen hinweg einen Weg zur nachhaltigen Bewirtschaftung und Erholung von zerstörten oder in Mitleidenschaft gezogenen Ökosystemen in der EU zu ebnen. Inwieweit offensichtliche nationale Bemühungen zur Abschwächung oder Umgehung von Pflichten aus den EU-Legislativakten Erfolg haben könnten, bleibt abzuwarten.
Wissenschaftliche Berichte, wie des IPBES, weisen immer wieder auf das dramatische Ausmaß des Artensterbens hin und betonen die Notwendigkeit sofortigen Handelns. Solche Warnungen mögen der Mehrung der Erkenntnisse von Entscheidungsträgern dienen, mit dem Ziel, dem Verlust an Biodiversität mit dem erforderlichen rechtlichen Rahmen nachhaltig entgegenzuwirken.