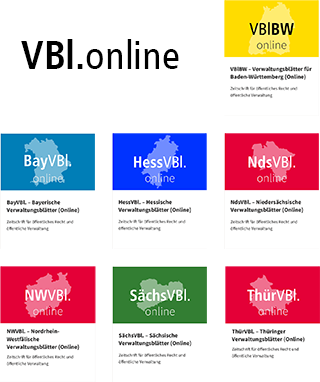Barrierefreiheit im Rechtsrahmen von L-BGG und BFSG
Orientierung für kommunale Unternehmen
Barrierefreiheit im Rechtsrahmen von L-BGG und BFSG
Orientierung für kommunale Unternehmen

Dem Landes-Behindertengleichstellungsgesetz Baden-Württemberg (L-BGG) auf Landesebene stehen auf Bundesebene das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) und das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) gegenüber. Für kommunale Unternehmen besteht häufig Unsicherheit darüber, ob das L-BGG oder das BFSG Anwendung findet. Das L-BGG schützt die Interessen von Menschen mit Behinderungen, bezieht hierbei Kommunen ein und erleichtert die Rechtsdurchsetzung durch die Möglichkeit zur Verbandsklage. Das BFSG zielt darauf ab, Produkte und Dienstleistungen so zu gestalten, dass sie für alle Menschen zugänglich und barrierefrei nutzbar sind. Die Verpflichtungen aus dem BFSG und dem L-BGG können grundsätzlich nebeneinander bestehen und schließen sich nicht gegenseitig aus. Da beide Gesetze teilweise unterschiedliche Anforderungen vorsehen, ist in der Praxis jedoch eine genaue Prüfung wichtig, welche Regelungen Anwendung finden.
Welche Einrichtungen und Unternehmen sind vom L-BGG erfasst?
Das L-BGG gilt für Dienststellen und andere Einrichtungen der Landesverwaltung, einschließlich der landesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen. Auch Gemeinden, Gemeindeverbände sowie sonstige juristische Personen des öffentlichen Rechts unter Landesaufsicht fallen unter das Gesetz.
Darüber hinaus gilt das L-BGG für bestimmte juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts, die zu dem besonderen Zweck gegründet wurden, Aufgaben von allgemeinem Interesse nicht gewerblicher Art zu erfüllen. Weitere Voraussetzung ist, dass sie überwiegend von öffentlichen Stellen finanziert werden oder der Leitung oder Aufsicht durch öffentliche Stellen unterliegen oder mehr als die Hälfte der Mitglieder ihrer Organe von öffentlichen Stellen bestimmt wird. Während die drei letztgenannten Kriterien meist klar beantwortet werden können, stellt sich bei kommunalen Unternehmen oft die Frage, ob ihr Gründungszweck der Erfüllung von „Aufgaben von allgemeinem Interesse nicht gewerblicher Art“ dient.
Allgemeininteresse und nichtgewerbliche Tätigkeiten
Aus europarechtlichen Gründen gilt das L‑BGG für juristische Personen, sofern sie öffentliche Auftraggeber im Sinne des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) sind. Die hierzu entwickelten Abgrenzungskriterien sind übertragbar, ihre Anwendung im Einzelfall jedoch komplex.
Die Prüfung, ob eine juristische Person Aufgaben im Allgemeininteresse wahrnimmt und nichtgewerbliche Tätigkeiten ausführt, erfolgt in zwei Schritten. Aufgaben, die dem Allgemeininteresse dienen, überschneiden sich weitgehend mit Aufgaben im öffentlichen Interesse, sind aber nicht identisch damit. Indizien sind die Erfüllung gesetzlicher Pflichten, Tätigkeiten im Bereich der Daseinsvorsorge, Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung oder Aktivitäten, die das Gemeinwohl indirekt stärken. Ob eine Tätigkeit als nichtgewerblich einzustufen ist, hängt von den konkreten Umständen des Einzelfalls ab. Dabei ist insbesondere relevant, ob ein Wettbewerb auf dem betreffenden Markt besteht und ob die juristische Person mit Gewinnerzielungsabsicht handelt. Abzustellen ist weiter auf die Übernahme der mit der Tätigkeit verbundenen Risiken sowie ob die Finanzierung ganz oder überwiegend durch öffentliche Mittel erfolgt.
Und welche Einrichtungen und Unternehmen fallen in den Anwendungsbereich des BFSG?
Das BFSG gilt rechtsformunabhängig für alle Wirtschaftsakteure, also Hersteller oder Händler der vom BFSG umfassten Produkte sowie für Erbringer der genannten Dienstleistungen. Die Regelungen können auch kommunale Unternehmen betreffen, wenn diese als Wirtschaftsakteure agieren.
Im Zentrum stehen die sogenannten „Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr“, also vor allem klassische Online-Shops. Maßgeblich ist, dass ausschließlich solche Angebote in den Anwendungsbereich des BFSG fallen, die sich unmittelbar an Endverbraucher richten. Angebote, die ausschließlich im Rahmen von Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen (B2B) erfolgen, sind hingegen ausgenommen, sofern sichergestellt ist, dass über diese keine Vertragsschlüsse durch Privatpersonen erfolgen können.
Vom Anwendungsbereich des BFSG ausgenommen sind außerdem Kleinstunternehmen mit weniger als zehn Beschäftigten und einem Jahresumsatz oder einer Bilanzsumme von höchstens zwei Millionen Euro. Weitere Ausnahmen kommen in Betracht, wenn die Umsetzung der Anforderungen des BFSG wesentliche Änderungen an einem Produkt oder einer Dienstleistung erfordern würde – etwa, wenn hierdurch der beabsichtigte Zweck nicht mehr erreicht werden könnte – oder wenn die Einhaltung der Vorgaben eine unverhältnismäßige finanzielle Belastung für das Unternehmen darstellen würde.
Welche Pflichten regeln das L-BGG und das BFSG?
Das L-BGG legt öffentliche Pflichten im Bereich Gleichstellung und Barrierefreiheit fest. Konkret bedeutet das: Barrierefreiheit ist im Bauwesen und im Verkehr nach Maßgabe der einschlägigen Rechtsvorschriften, insbesondere der Landesbauordnung Baden-Württemberg herzustellen. Außerdem müssen Websites sowie mobile Anwendungen so gestaltet sein, dass sie für alle zugänglich sind. Erforderlich ist, dass Menschen mit Behinderung Websites, ggf. unter Verwendung von Hilfsmitteln wie beispielsweise einem Screenreader in gleicher Weise wie Menschen ohne Beeinträchtigungen nutzen können. Hierzu müssen Inhalte, die keine Texte sind, wie bspw. Bilder mit Untertiteln versehen sein, welche diese aussagekräftig beschreiben. Außerdem müssen Texte über ausreichende Helligkeitskontraste verfügen. Für Websites und Apps ist eine Erklärung zur Barrierefreiheit abzugeben.
Auch das BFSG enthält Vorgaben zur digitalen Barrierefreiheit. Die hierzu erlassene Barrierefreiheitsverordnung (BFSGV) verweist auf konkrete Kriterien, die alternative Bedienmöglichkeiten sowie Anforderungen an die Wahrnehmbarkeit von Inhalten festlegen. Es sind jedoch Bereichsausnahmen möglich, etwa für rein informatorische Teile oder Drittinhalte einer Website. Wirtschaftsakteure sind nach dem BFSG ebenfalls zur Veröffentlichung einer Barrierefreiheitserklärung verpflichtet. Diese kann jedoch im Vergleich zur Erklärung nach dem L-BGG inhaltlich weniger umfangreich ausgestaltet sein.
Was passiert, wenn die gesetzlichen Anforderungen nicht umgesetzt werden?
Die zuständige Überwachungsstelle (Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg) überprüft inzwischen stichpunktartig, ob die Anforderungen des L-BGG eingehalten werden. Hierbei wird ein ausführlicher Prüfbericht erstellt und eine Frist zur Behebung von festgestellten Mängeln gesetzt. Ein Bußgeld bei Verstößen sieht das Gesetz nicht vor. Gleichwohl können die Verpflichtungen zwangsweise durchgesetzt werden. Außerdem haben anerkannte Verbände das Recht, bei Verstößen Klage zu erheben und die Einhaltung der Regelungen überprüfen zu lassen.
Die Missachtung der Vorgaben des BFSG kann dagegen eine Ordnungswidrigkeit darstellen und bei schwerwiegenden Verstößen mit Bußgeldern von bis zu 100.000 Euro geahndet werden. Die Einhaltung der Vorschriften wird durch eine zentrale Überwachungsbehörde sowohl stichprobenartig als auch anlassbezogen überprüft. Zudem ist davon auszugehen, dass die Bestimmungen des BFSG wettbewerbsrechtlich als Marktverhaltensregeln einzustufen sind. Verstöße können daher auch durch Mitbewerber oder Verbraucherverbände mittels Abmahnung oder Unterlassungsklage verfolgt werden.
In der Praxis bedeutet das: Prüfen Sie zunächst, ob Ihre Einrichtung unter den Anwendungsbereich des L-BGG oder des BFSG fällt. Wenn das der Fall ist, kontrollieren Sie regelmäßig, ob Ihre Angebote barrierefrei sind und dokumentieren Sie Ihre Maßnahmen.