Die Zulassung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien auf Baudenkmalen
Rechtliche Rahmenbedingungen für Solaranlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden
Die Zulassung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien auf Baudenkmalen
Rechtliche Rahmenbedingungen für Solaranlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden
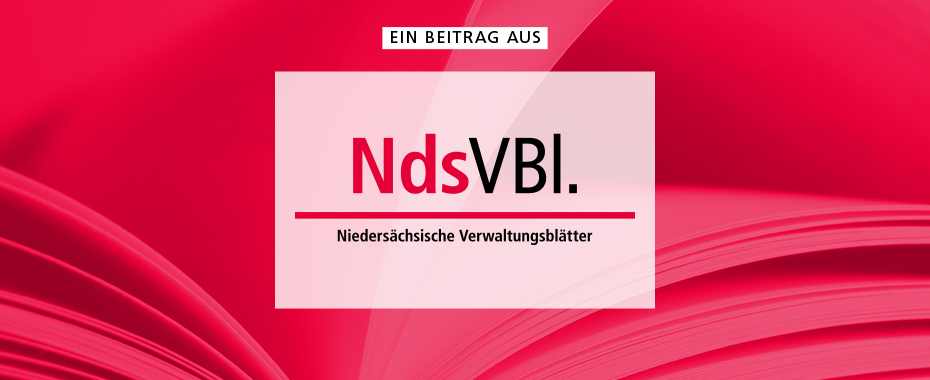
1. Die Ausgangslage
Die Genehmigung für Eingriffe in ein Kulturdenkmal, wozu ein Baudenkmal gehört (§ 3 Abs. 1 NDSchG), ist nach § 10 Abs. 3 Satz 1 NDSchG zu versagen, wenn eine Maßnahme gegen das Gesetz verstoßen würde. § 6 Abs. 2 NDSchG verbietet Maßnahmen, die den Denkmalwert beeinträchtigen. Seit dem 06.07.2022 bestimmt § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 NDSchG, dass ein Eingriff in ein Baudenkmal zu genehmigen ist, soweit das öffentliche Interesse an der Errichtung von Anlagen zur Nutzung von erneuerbaren Energien (künftig: „Anlagen”) – das sind in der Praxis meist Windenergie- und Solaranlagen – das Interesse an der unveränderten Erhaltung des Baudenkmals überwiegt. Seit dem 20.12.2023 gilt dieselbe Rechtslage nach § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 NDSchG für Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels.
In beiden Fällen bestimmt das Gesetz, dass das öffentliche Interesse in der Regel überwiegt, wenn der Eingriff in das äußere Erscheinungsbild reversibel ist und in die denkmalwerte Substanz nur geringfügig eingegriffen wird (§ 7 Abs. 2 Satz 2 NDSchG). § 3 Abs. 3 Satz 1 Niedersächsisches Klimagesetz (NKlimaG) gibt vor, dass die Durchführung von Vorhaben, die der Erreichung der Klimaziele dienen, im überragenden öffentlichen Interesse des Landes liegt und dieses Interesse in einem nach Landesrecht durchzuführenden Genehmigungsverfahren entsprechend zu gewichten ist.
Die Prüfung der Zulässigkeit von Anlagen steuern sollen der im November 2022 vom Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege (NLD) entwickelte „Leitfaden zur Prüfung der Vereinbarkeit von Anlagen zur Gewinnung von erneuerbaren Energien auf oder in der Umgebung von Bau- und Kunstdenkmalen” und der Runderlass des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst vom 15.08.2024.1
Im Rahmen der Genehmigung nach § 10 Abs. 3 NDSchG regelt zum „Ob” § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 NDSchG die Errichtung von Anlagen auf Baudenkmalen (s. 2 und 3) und zum „Wie” die Vorschrift sonst das Genehmigungsverfahren (s. 4). Dazu tritt seit 01.01.2025 scheinbar die Verpflichtung des § 32 a Abs. 2 NBauO. Danach ist die bereits für Neubauten bestehende Solarpflicht ausgeweitet worden u. a. bei der Erneuerung der Dachhaut eines bestehenden Gebäudes mit einer Dachfläche von mindestens 50 m², von dieser Fläche mindestens 50 Prozent mit einer Solarenergieanlage zur Stromerzeugung auszustatten, falls die Pflicht nicht nach § 32 a Abs. 4 Satz 1 NBauO entfällt (s. 5 a). Hinzu kommt seit 01.07.2024 eine Änderung des § 66 NBauO (s. 5 b).
Auf Bundesebene regelt seit dem 18.12.2019 § 13 Abs. 1 Satz 1 Klimaschutzgesetz (KSG), dass Träger öffentlicher Aufgaben die nationalen Klimaziele zu berücksichtigen haben. Nach der am 20.07.2022 geschaffenen Direktive des § 2 Satz 1 und 2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) liegen die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien sowie den dazugehörigen Nebenanlagen im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit. Bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sollen die erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht werden. Die Gesetzgebungsmaterialen klären dann, dass auch Belange des Denkmalschutzes nachrangig seien.
2. § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 i. V. m. Satz 2 NDSchG als Ausgangspunkt
Die Genehmigung von Anlagen nach § 10 Abs. 3 Satz 1 NDSchG hängt von der Abwägung nach § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 NDSchG ab. Die Regelvermutung des § 7 Abs. 2 Satz 2 NDSchG greift dabei nicht, wenn kumulativ die Voraussetzungen eines reversiblen Eingriffs in das äußere Erscheinungsbild und ein nicht nur geringfügiger Eingriff in die denkmalwerte Substanz vorliegen.2
Ist der Weg zu der Vermutung eröffnet, wie bei jedem Substanzerhalt der Dachhaut, ordnete das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht (NdsOVG) mit Beschluss vom 08.06.2023 die Kriterien zur Zulassung von Anlagen nach § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 2 Satz 2 NDSchG:3 Nach der Gesetzgebungsgeschichte sollen auch denkmalgeschützte Gebäude ihren Beitrag zum Erreichen der ambitionierten Klimaziele leisten, Anlagen seien aber bei Schutzbedürftigkeit eines Baudenkmals nicht in jedem Fall zuzulassen. Vielmehr sollen relevante Faktoren geprüft und mit den Belangen des Klimaschutzes abgewogen werden, wie die Störung des Erscheinungsbildes und der öffentlichen Sichtbarkeit, Statik des Daches, Materialgerechtigkeit, Umfang und Angemessenheit konstruktiver Eingriffe in die authentische Denkmalsubstanz, Klärung der Erreichbarkeit der Frei- oder Abschaltstellen und die Durchführung wirksamer Löscharbeiten.4 Das Gericht entnimmt § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 i. V. m. Satz 2 NDSchG ein zweistufiges Vorgehen:
- – Zunächst eine Entscheidung über das „Ob” der Genehmigung der Anlage, wobei das öffentliche Interesse bei Vorliegen der Voraussetzungen (reversibler Eingriff in das äußere Erscheinungsbild und nur geringfügiger Eingriff in die denkmalwerte Substanz) „in der Regel” überwiege (§ 7 Abs. 2 Satz 2 NDSchG). Die gesetzgeberische Konstruktion zeige, dass in einem Großteil der Fälle die Frage des „Ob” der Genehmigung positiv zu beantworten, die Errichtung von Anlagen grundsätzlich zu genehmigen sei. Die Vorschrift bedinge eine Prüfung atypischer Fälle, die sich durch besondere Umstände von den Regelfällen abheben (s. 3). Sei die Ausnahme von der Regel festgestellt (a.), bedürfe es noch einer Gewichtung der Interessen nach § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 NDSchG (b.).
- – Ist auf der Stufe des „Ob” der Regelfall bejaht, schließe sich die Frage nach der konkreten Ausgestaltung der Anlage an. Nach den Gesetzesmaterialien beantworte diese Frage nicht die Regelung des § 7 Abs. 2 Satz 2 NDSchG. Für die Stufe des „Wie” der Genehmigung gelte vielmehr nur § 10 Abs. 3 NDSchG (s. 4).
3. Die Entscheidung über das „Ob” der Genehmigung
a) Der atypische Fall
Was als „atypisch” die Regel des § 7 Abs. 2 Satz 2 NDSchG verlässt, regelt das Gesetz nicht. Der Gesetzgeber, der vornehmlich Windenergieanlagen im Blick hatte, versteht darunter „erhebliche Beeinträchtigungen … bei besonders bedeutsamen Kulturdenkmälern” und wollte dem verfassungsrechtlichen Gebot des Art. 14 Abs. 2 GG entsprechen.5
aa) besonders bedeutsame Baudenkmale
Der OVG-Beschluss vom 08.06.2023 versucht eine Konkretisierung und stellt besonders wertvolle Baudenkmale außerhalb des Regelfalls, wenn mit der Errichtung von Anlagen bzw. Maßnahmen eine ernstliche Beeinträchtigung ihres Denkmalwertes verbunden ist. Er schlägt auch hier eine zweistufige Prüfung vor.
- – Ermittlung der besonderen Wertigkeit des Baudenkmals
- Den Wert von Baudenkmalen kann z. B. begründen, dass sie
-
- – … „eine außergewöhnliche architektonische Qualität aufweisen”6
- – … „die Landschaft oder das Stadtbild in ganz besonderer Weise prägen”,
- – … „für die Architekturgeschichte epochenbestimmend (sind)”,
- – … „im Rahmen ihrer nationalen Bedeutung identitätsstiftend (sind)” oder
- – … „einer UNESCO-Welterbestätte zugehörig sind”. Das bejaht der Beschluss vom 08.06.2023 für die Altstadt von Goslar7.
- – Ermittelt die Prüfung den besonderen Wert des Baudenkmals, ist es ein atypischer Fall, wenn mit der Errichtung von Anlagen eine ernstliche Beeinträchtigung seines Denkmalwertes verbunden ist.
Für die Denkmalschutzbehörden bedeutet es Aufwand, die besondere Wertigkeit im Einzelfall zu ermitteln. Hierzu bedarf es denkmalfachlichen Rats auch des NLD. Die an den Umständen des Einzelfalls orientierte Argumentation fördert, wenn sich aus den Gründen der Unterschutzstellung die Bedeutsamkeit ergibt.8
bb) starker Eingriff in ein Baudenkmal
Der OVG-Beschluss vom 08.06.2023 erkennt einen atypischen Fall auch, wenn zwar kein besonders wertvolles Denkmal betroffen ist, „aber die mit der Errichtung von Anlagen … einhergehende Beeinträchtigung gravierend ausfällt und erheblich über das hinausgeht, was mit der Errichtung derartiger Anlagen typischerweise verbunden ist. Das ist insbesondere der Fall, wenn durch die Errichtung konstituierende Merkmale des Denkmals selbst verloren gehen oder sogar sein Denkmalwert insgesamt in Frage gestellt wird.”9
cc) Eingriff in von Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG geschützte Interessen
Denkbar ist, dass das Eigentumsrecht von Denkmaleigentümern gegenüber (benachbarten) Anlagen eine abwägende Betrachtung im Einzelfall erzwingt.10
b) Die Abwägung in der Genehmigung über das „Ob”
Stellt das Baudenkmal einen Fall außerhalb der „Regel” des § 7 Abs. 2 Satz 2 NDSchG dar oder greift angesichts des physischen Eingriffs in das Denkmal die Regel nicht, muss die – im Ausgangspunkt ergebnisoffene – Interessenabwägung nach § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 NDSchG zwar nicht zugunsten der Anlage ausfallen,11 in diese muss aber das gesetzgeberische Ziel des Klimaschutzes mit erheblichem Gewicht einfließen.
Die bundesrechtlich angeordneten Gewichtungsvorgaben im KSG und EEG prüfte jüngst das Verwaltungsgericht (VG) Göttingen. Das NdsOVG hatte bereits die Frage aufgeworfen, ob der Bund auf dem Gebiet des landesrechtlichen Denkmalschutzes über Rechtssetzungsbefugnisse verfügt,12 dann aber erwogen, dass § 2 EEG „eine das Mindestmaß an bundesrechtlich eigenständigem, von landesrechtlicher Regelung unabhängigem Denkmalschutz konkretisierende (und seinerseits relativierende) Wirkung” im Sinne eines „Optimierungsgebot” zukommt. Mittlerweile haben wenigstens 6 Obergerichte im Bundesgebiet die Rechtsprechung gebildet, dass § 2 EEG Vorgaben für im Landesrecht fachgesetzlich vorgesehene Abwägungs- und Ermessensentscheidungen in Bezug auf Anlagen enthält und den erneuerbaren Energien ein regelmäßiges Übergewicht zukommt. Das überragende öffentliche Interesse an der Errichtung von Einrichtungen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien in § 2 Satz 1 EEG könne nur ausnahmsweise überwunden werden.13
Weil § 2 Satz 2 EEG eine Soll-Vorschrift ist, kann auch hier eine Atypik bestehen. Die Regelung begründet keinen absoluten oder pauschalen Vorrang der erneuerbaren Energien in dem Sinne, dass sich die Stromversorgung durch erneuerbare Energien zwingend in der Abwägung mit anderen öffentlichen Interessen durchsetzen muss.14
In der Praxis wird das nicht als Regelfall im Sinne des § 7 NDSchG anzusehende Baudenkmal auch einen atypischen Fall im Sinne des § 2 EEG darstellen.
Die Gewichtungsvorgabe des § 13 Abs. 1 Satz 1 KSG hat keine Wirkung. Nach § 13 Abs. 1 Satz 2 KSG bleiben Kompetenzen der Länder, das Berücksichtigungsgebot innerhalb ihrer Verantwortungsbereiche auszugestalten, unberührt. Dies ist mit der Neuregelung in § 7 Abs. 2 NDSchG aber geschehen.15
4. Das Ermessen nach § 10 Abs. 3 NDSchG auf der Stufe des „Wie”
Ist das „Ob” der Genehmigung bejaht, hat nach § 10 Abs. 3 NDSchG die Behörde darauf hinzuwirken, dass die zur Genehmigung gestellte Anlage dem Denkmalschutz so weit wie möglich Rechnung trägt. Der OVG-Beschluss vom 08.06.2023 hält fest, dass hierbei „die Größe und Position, aber vor allem auch die optische Ausgestaltung der Anlage (z. B. monochrome und an die Dacheindeckung angeglichene Farbgebung der sichtbaren Elemente) eine entscheidende Rolle” spielen. Deshalb „kann und muss die Genehmigung unter Auflagen erteilt werden, um den Zielen des Denkmalschutzes gerecht zu werden”. Wenn Photovoltaik-Module „polychrom erscheinen und insbesondere einen metallischen Rand sowie ein metallisches Muster aufweisen”, verleihe das der Anlage „eine besondere optische Störintensität, deren Hinnahme nur in Frage kommen dürfte, wenn gestalterisch bessere Varianten aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen nachweislich mit gravierenden Nachteilen verbunden sind. Die weit überstehenden Befestigungsschienen begründen ebenfalls eine vermeidbare Störwirkung, soweit sie nicht konstruktiv erforderlich sind.”16
a) Achtung der gesetzgeberischen Entscheidung
Im Rahmen des Ermessens, welche Auflagen mit einer Genehmigung zu verbinden sind, ist die grundlegende Entscheidung des Gesetzgebers zugunsten der Anlagen zu achten, dass sie keine für den Anlagenbetreiber unzumutbaren Auflagen enthalten.17 Solche führen faktisch zur Verneinung der Zulässigkeit auf der „Ob”-Ebene.
b) wirtschaftliche Zumutbarkeit von Auflagen
Ob die Schwelle der Unzumutbarkeit überschritten ist, setzt eine „abwägende Betrachtung der Vorteile für das Denkmal einerseits und der Nachteile für den Denkmaleigentümer und – mit besonderem Gewicht – etwaiger Ertragseinbußen andererseits (voraus). Aufwändige und mit hohen Kosten verbundene technische Sonderlösungen können daher ebenso wie eine Installation in ertragsschwacher Lage – bei Photovoltaikanlagen bspw. auf der Nordseite eines Gebäudes – in aller Regel nicht verlangt werden.”18
Unzumutbar ist nicht, wenn die zur Genehmigung gestellte Anlage weniger Kosten verursacht und/oder einen höheren Ertrag verspricht als eine dem Denkmaleigentümer angesonnene. Entscheidend für die Wirtschaftlichkeitsberechnung ist nicht der isolierte Vergleich der beantragten und der von der Behörde favorisierten Lösung. Wie bei allen denkmalrechtlichen Auflagen fiele der immer zu Lasten der denkmalfreundlichen Lösung aus. Bei Mehrkosten für denkmalrechtlich gebotene Maßnahmen sind in der Wirtschaftlichkeitsberechnung die Erträge aus dem gesamten Gebäude (nebst Nebengebäuden) zusammenzurechnen.19 Die Kosten des Zustands mit der beantragten Anlage sind in ein Verhältnis mit der von der Behörde gewünschten zu setzen. Der Denkmaleigentümer kann keinen maximalen Ertrag beanspruchen; zureichend ist der Ertrag, der größer als die sprichwörtliche „schwarze Null” ist.20
c) einzelne Anordnungen
aa) Standortalternativen
Der Leitfaden des NLD und der Runderlass21 sehen vor, Alternativstandorte in Betracht zu ziehen. Der Erlass sieht in Ziffer 3 diese Prüfung auf die Fälle beschränkt, in denen das Baudenkmal als atypischer Fall nicht in Betracht kommt, während mit den in Ziffer 4.2 des Erlasses einbezogenen Vorschlägen der Niedersächsischen Landeskommission für Denkmalpflege (wie dem Leitfaden des NLD) eine solche Prüfung in jedem Fall stattfinden soll.
bb) gestalterische Anforderungen
Das VG Göttingen hat mit Urteil vom 21.01.2025 die Entscheidung einer Denkmalschutzbehörde bestätigt, die auf einem mit roten Ziegeln gedeckten Dach eines Baudenkmals inmitten einer auch sonst mit roten Ziegeln gedeckten Umgebungsbebauung die Anbringung schwarzer Solarpaneele nicht genehmigte, sondern dem Denkmaleigentümer nur rote Paneele zubilligte.22
d) § 13 KSG und § 3 NKlimaG
Dem Beachtungsgebot des § 13 Abs. 1 Satz 1 KSG ist auf der „Ob”-Ebene zu entsprechen (s. 3 b). Ist dies der Fall, kommt ihm beim „Wie” der Genehmigung keine weitere Wirkung mehr zu, da die grundsätzliche Entscheidung, die Nutzung regenerativer Energien zu ermöglichen, nicht in Frage gestellt ist.23
e) § 2 EEG
Die Gewichtungsdirektive des § 2 EEG findet keinen Eingang mehr in die Abwägung des § 10 Abs. 3 NDSchG, wenn bei der Entscheidung über das „Ob” der Genehmigung dem öffentlichen Interesse an der Nutzung regenerativer Energien bereits entsprochen ist.24 Die konkrete Ausgestaltung der Anlage berührt dieses öffentliche Interesse nicht, sondern nur das private Interesse des Betroffenen, die Anlage in einer bestimmten Weise zu nutzen, die Wirtschaftlichkeit der Anlage (Kosten, Minderertrag der denkmalgerechten Anlage) oder gestalterische Wünsche.
[…]
Den vollständigen Beitrag lesen Sie in NdsVBl 9/2025.


