Ausnahmesituationen meistern
Großschadensereignisse und das SGB XIV
Ausnahmesituationen meistern
Großschadensereignisse und das SGB XIV

I. Abstract
Der nachfolgende Aufsatz berichtet über eine Fachveranstaltung, die im November 2025 zu den vielfachen Herausforderungen von Großschadensereignissen für Verfahren nach dem Sozialen Entschädigungsrecht stattfand. Versucht werden soll, die gewählten Inhalte von wissenschaftlichem Vortrag, moderierter Gesprächsrunde und Workshops zu beschreiben und erste Ergebnisse, aber auch identifizierte Handlungsbedarfe zusammenzufassen.
Vorab kann festgestellt werden, dass die Veranstaltung einen sehr wertvollen Einblick in bestehende Strukturen und bereits Erreichtes gegeben hat, aber auch deutlich gezeigt hat, dass in einer großen Anzahl tatsächlichen und rechtlichen Aspekten noch viel zu tun ist.
II. Allgemeines
Am 12. und 13. November 2025 fand in Berlin auf Einladung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und der Bundesstellte für Soziale Entschädigung1Die Bundesstelle für Soziale Entschädigung ist eine beim Bundesamt für Soziale Sicherung angesiedelte und der Aufsicht des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales unterstehende Behörde in deren Geschäftsbereich, die eine Reihe v.a. operativer Aufgaben beim Vollzug des SGB XIV hat. eine Fachveranstaltung zu den Herausforderungen sogenannter Großschadensereignisse mit Blick auf das Soziale Entschädigungsrecht bzw. das SGB XIV statt2Hierzu auch Pressemitteilung des BMAS ‚Opferentschädigung bei Großschadensereignissen‘ vom 14.11.2025.. Die Veranstaltung war prominent besetzt, u.a. mit Richterinnen und Richtern der Sozialgerichtsbarkeit bis hin zum Bundessozialgericht, Wissenschaftlern, staatlichen Opferschutzbeauftragten, Rechtsanwälten, Vertretern von Opferschutzorganisationen, aber auch Vertretern anderer Rechtsbereiche wie der gesetzlichen Unfallversicherung und der Verkehrsopferhilfe.
Die Leitfrage der Veranstaltung war ‚Was braucht es, um als Verwaltung bei Großschadensereignissen möglichst zielorientiert agieren zu können?‘. Der Anlass war neben mehreren Ereignissen der letzten Jahre der verheerende Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt im Dezember 2024 und die hierdurch noch einmal mehr in den Fokus gerückten vielfachen Herausforderungen, die durch solche furchtbaren Ereignisse entstehen. Hierdurch sehen sich – nur bezogen auf den Bereich des Sozialen Entschädigungsrechts3Der freilich nur einen Aspekt staatlicher und gesellschaftlicher Herausforderungen solcher Ereignisse darstellt. – die in den Bundesländern tätigen durchführungsverantwortlichen Verwaltungsbehörden mit einer Reihe von Herausforderungen konfrontiert, deren Dringlichkeit das große und breite Interesse an der Veranstaltung veranschaulicht.
III. Um welche Ereignisse geht es?
Als Großschadensereignisse im Sinne der Regelungen und aus Sicht des Sozialen Entschädigungsrechts sind beispielhaft der Absturz des Germanwings-Fluges 9525 im Jahr 2015, der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz 2016, die Amokfahrt in Münster 2017, der Anschlag in Hanau 2020, das Messeratentat von Solingen im August 2024 und der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt im Dezember 20244Die Aufzählung ist wie ausgeführt beispielhaft und beinhaltet vor allem keine Bewertung von Schwere und Ausmaß der Ereignisse. zu nennen.
Abzugrenzen davon sind Gewalttaten, die keine größere Anzahl an Opfern gefordert haben, aber auch Tatgeschehen, die sich über einen längeren Zeitraum erstreckt haben, wie z.B. Geschehnisse sexuellen Missbrauchs im institutionellen oder privaten Bereich.5Zu denken ist hier an Vorkommnisse in kirchlichem Kontext oder Missbrauchskomplexen wie dem in Lügde in den Jahren 2008 bis 2018. Zwar werden diese Tatgeschehen gerade aus Sicht von Opferschützern teilweise auch als Großschadensereignisse bewertet, was auch mit Blick auf die Auswirkungen auf die Opfer nachvollziehbar ist. Da aber solche Ereignisse jedenfalls kein ad-hoc-Tätigwerden der Akteure der Sozialen Entschädigung auslösen, wie sie z.B. bei Großeinsätzen von Polizei und Rettungskräften mit unter Umständen vielen Verletzen und Getöteten charakterisierend sind, stehen sie hier nicht im Fokus der Betrachtung.
IV. Rechtlicher Hintergrund
Menschen, die ab dem 1. Januar 2024 in Deutschland6Oder auf einem deutschen Schiff oder Luftfahrzeug. Opfer eines vorsätzlichen, rechtwidrigen unmittelbar gegen ihre Personen gerichteten Angriffs geworden sind, haben nach § 13 Absatz 1 Nr. 1 SGB XIV Anspruch auf Leistungen der Sozialen Entschädigung7Daneben bezieht das SGB XIV nach § 13 Absatz 1 Nr. 2 und § 14 weitere Gewaltbetroffene, wie Opfer bestimmter psychischer Gewalt, Opfer von Angriffen mit Gift und erheblich vernachlässigte Kinder in den Schutzbereich des SGB XI ein. des SGB XIV.
Betroffene, die in der Zeit bis zum 31. Dezember 2023 zu Schaden gekommen sind, haben einen Anspruch, wenn sie infolge eines vorsätzlichen, rechtswidrigen tätlichen Angriffs8Gegen seine oder eine andere Person oder durch dessen rechtmäßige Abwehr. eine gesundheitliche Schädigung erlitten haben, nach § 1 Absatz 1 Opferentschädigungsgesetz9Außer Kraft getreten am 1.1.2024 aufgrund des Gesetzes vom 12.12.2019 (BGBl. I S. 2652). einen Anspruch auf Versorgung. Wenn diese Betroffenen ihren Antrag nach dem 1. Januar 2024 stellen, gründet sich deren Anspruch auf § 138 SGB XIV. Dieser regelt im Kern, dass für die Betroffenen die (Zugangs)Voraussetzungen des Opferentschädigungsgesetzes für die Anerkennung eines Anspruchs nach dem Sozialen Entschädigungsrecht gelten. Diese rechtliche Konstruktion bedeutet konkret, dass Betroffene, die vor dem 1. Januar 2024 geschädigt worden sind, von den teils erleichterten Zugangsvoraussetzungen des SGB XIV10Namentlich denen der Einbeziehung psychischer Gewalt in den Schutzbereich des SGB XIV. nicht profitieren können.
V. Aktuelle (fach)öffentliche Diskussion
Das Thema Großschadensereignisse als Herausforderung im Sozialen Entschädigungsrecht war in jüngerer Zeit mehrfach Gegenstand von Publikationen, die gerade vor dem Hintergrund und den Erfahrungen der jüngeren Ereignisse entstanden sind11z.B. Kerner WzS 2025, 146ff und Weber, Die Sozialverwaltung 2/2025, 30ff. und die die wesentlichen Aspekte, wie sie auch Inhalt der Veranstaltung waren, thematisiert und teils problematisiert haben. Gerade akuell wurden insbesondere die Aspekte der notwendigen Koordination der Hilfsangebote und der gleichermaßen notwendigen Abstimmung der Leistungsträger untereinander in den Fokus gerückt.
Allen Veröffentlichungen ist im Wesentlichen gemein, dass hierin festgestellt wird, dass nicht etwa ein Mangel an Hilfsangeboten für Betroffene vorhanden ist, sondern tatsächlich eine Vielzahl12vgl. Kerner a.a.O. mit einer beispielhaften Aufzählung solcher – teils wenig bekannter – Angebote. solcher Hilfen. Allerdings werden diesen Leistungen eben auch von einer großen Anzahl an zuständigen, teils staatlichen, teils privaten Träger erbracht, so dass hierdurch für Betroffenen ein schwer bis gar nicht durchdringbares Dickicht entsteht. Vor diesem Hintergrund fordern Autoren vereinzelt schon länger auch durchaus gesetzliche Klarstellungen, um zumindest die Leistungszuständigkeit der Sozialleistungs- bzw. -versicherungsträger klar und – auch für den Betroffenen – erkennbar voneinander abgrenzen zu können.13z.B. Kranig, ‚Subsidiarität der Inanspruchnahme des Entschädigungsfonds gegenüber Versorgungsbezügen nach dem Opferentschädigungsgesetz‘, NZV 2024, 387.
VI. Inhalte der Veranstaltung
Neben den Grußworten von Frau Staatssekretärin Leonie Gebers vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales und der Vizepräsidentin des Bundesamtes für Soziale Sicherung, Frau Heike Höhe, die die politische und vor allem die gesamtgesellschaftliche Bedeutung des Themas und der Veranstaltung hervorhob, gab es mehrere fachliche Beiträge.
a) Fachvortrag ‚Krisenresilienz bei Großschadensereignissen – Verfassungs- und sozialrechtliche Aspekte
Prof. Dr. Stephan Rixen, der als namhafter und in einer Vielzahl von Gremien von nationaler Bedeutung tätiger Rechtswissenschaftlicher auch über eine breite Expertise im Sozialrecht verfügt14Aktuell ist Prof. Rixen auch Vorsitzender des Fachbeirats Soziale Entschädigung., hat in seinem Vortrag einerseits eine hilfreiche definitorische verfassungs- und gesamtrechtliche Einordnung von Großschadensereignissen vorgenommen und andererseits Fragen der Verbindlichkeit bestehender Systeme der Zusammenarbeit aufgeworfen. Hierbei wurde deutlich, dass zur Frage, ob und in welcher Weise es Regeln für die Zusammenarbeit und Koordinierung15§§ 86ff. SGB X sehen eine ausdrückliche Verpflichtung zur Zusammenarbeit der verantwortlichen Stellen vor. der unterschiedlichen Akteure braucht, durchaus unterschiedliche Sichtweisen vorhanden sind. Während z.B. die Opferschutzbeauftragten der Länder auf ein gut funktionierendes Zusammenwirken verwiesen, gab es aus der Sicht von Vertretern der SER-Träger deutliche Hinweise, dass es hier ein Mehr an ggfls. auf der Ebene von schriftlichen Übereinkommen braucht, um sicher zu stellen, dass Strukturen im Bedarfsfall vorhanden sind und funktionieren sowie dass dies nicht von wenig kalkulierbaren Effekten oder gar Zufällen abhängig ist. Ob es hierfür Regelungen auf der Ebene gesetzlicher – unter Umständen gar grundgesetzlicher16Artikel 30 GG regelt, dass Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung staatlicher Aufgaben grundsätzlich Sache der Länder ist. – Normen oder in Form von Staatsverträgen braucht, wurde insgesamt und auch vom Referenten mindestens zurückhaltend bewertet, ist aber angesichts der Tragweiten von Großschadensereignissen eine keineswegs von der Hand zu weisende Überlegung.
Das Mittel der Wahl könnten hier beispielsweise vertragliche Übereinkünfte und Verbünde zwischen den Akteuren sein, die einerseits genügend Spielräume lassen, um auf unterschiedliche Großschadensereignisse zielgerichtet reagieren zu können, die aber andererseits mehr als ein nicht geregeltes Zusammenwirken darstellt.17Ein durchaus interessanter Gedanke ist die vom Referenten aufgeworfene denkbare Analogie zum ‚Gemeinsamen Lagezentrum See‘, das eine flexible Zusammenarbeitsstruktur für die Seeraumüberwachung, zur Verbesserung der Gefahrenabwehr und des Unfallmanagements in deutschen Küstengewässern bilden soll und hier über jahrelange Erfahrung verfügt.
b) Gesprächsrunde
An der moderierten Paneldiskussion nahmen der Bundesopferbeauftragte, Roland Weber, Barbara Richstein vom WEISSEN RING, Jutta Welle vom Sozialministerium Sachsen-Anhalt, Stephan Kiss vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe18Neben dem Landschaftsverband Rheinland einer von zwei in Nordrhein-Westfalen für das SER durchführungsverantwortlichen Behörden. und Katrin Süsmuth von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung teil.
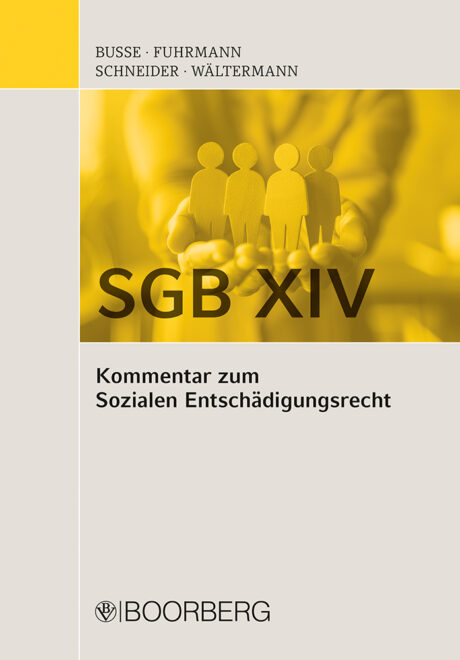 Die Beteiligten wiesen darauf hin, dass die bestehenden Strukturen und Hilfesysteme bei den jüngsten Großschadensereignissen, namentlich bei dem Anschlag in Magdeburg im Wesentlichen gut funktioniert haben. Die Diskussion zeigte aber auch, dass bei allen nach Großschadensereignissen einzuleitenden Maßnahmen die Perspektive der Betroffenen besonders wichtig und gerade ein abgestimmtes und niederschwelliges Vorgehen der Behörden Priorität besitzen muss. Dies gilt bei dem Zugang zu den Betroffenen, aber auch bei der Erbringung von Leistungen. Eine besondere Herausforderung stellt hierbei die Tatsache dar, dass nach der gesetzlichen Konstruktion des SGB XIV die Primär- bzw. Erstzuständigkeit für die Gewährung von Leistungen der Krankenbehandlung bei den gesetzlichen Krankenkassen liegt19Nach Kapitel 5 SGB XIV.. Da der Leistungskatalog, der den Krankenkassen in Anwendung des SGB V zur Verfügung steht, teils nicht die Bedarfe abdecken, die Betroffene in der Akutsituation haben und zudem teils deutlich hinter dem zurückbleibt, was die ergänzenden Leistungen des SGB XIV20Geregelt in § 43 SGB XIV. vorsehen, können sich hier bereits Schnittstellenprobleme ergeben, weil zwei Träger – die Krankenkassen und die Sozialen Entschädigung – zuständig sind. Dies kann einer zielgerichteten und vor allem schnellen Versorgung der Betroffenen entgegenstehen. Hier könnte eine Lösung darin liegen, die im SGB XIV erfolgte Zuständigkeitszuweisung an die Krankenkassen21Entsprechend BT-Drs. 19/1382, S. 188. zu überdenken und beispielsweise eine entsprechende Zuweisung an die Unfallkassen22Wie sie in § 57 Absatz 5 SGB XIV für die Hilfsmittelversorgung nach § 46 SGB XIV geregelt ist. in Betracht zu ziehen23Die ggfls. auch nur für Großschadensereignisse Anwendung finden könnten.. Ob ein solcher politischer Paradigmenwechsel realistisch ist, ist schwer einzuschätzen, Sachgründe hierfür ließen sich aber finden, was unter Umständen nicht nur für Betroffene von Großschadensereignissen gelten könnte.
Die Beteiligten wiesen darauf hin, dass die bestehenden Strukturen und Hilfesysteme bei den jüngsten Großschadensereignissen, namentlich bei dem Anschlag in Magdeburg im Wesentlichen gut funktioniert haben. Die Diskussion zeigte aber auch, dass bei allen nach Großschadensereignissen einzuleitenden Maßnahmen die Perspektive der Betroffenen besonders wichtig und gerade ein abgestimmtes und niederschwelliges Vorgehen der Behörden Priorität besitzen muss. Dies gilt bei dem Zugang zu den Betroffenen, aber auch bei der Erbringung von Leistungen. Eine besondere Herausforderung stellt hierbei die Tatsache dar, dass nach der gesetzlichen Konstruktion des SGB XIV die Primär- bzw. Erstzuständigkeit für die Gewährung von Leistungen der Krankenbehandlung bei den gesetzlichen Krankenkassen liegt19Nach Kapitel 5 SGB XIV.. Da der Leistungskatalog, der den Krankenkassen in Anwendung des SGB V zur Verfügung steht, teils nicht die Bedarfe abdecken, die Betroffene in der Akutsituation haben und zudem teils deutlich hinter dem zurückbleibt, was die ergänzenden Leistungen des SGB XIV20Geregelt in § 43 SGB XIV. vorsehen, können sich hier bereits Schnittstellenprobleme ergeben, weil zwei Träger – die Krankenkassen und die Sozialen Entschädigung – zuständig sind. Dies kann einer zielgerichteten und vor allem schnellen Versorgung der Betroffenen entgegenstehen. Hier könnte eine Lösung darin liegen, die im SGB XIV erfolgte Zuständigkeitszuweisung an die Krankenkassen21Entsprechend BT-Drs. 19/1382, S. 188. zu überdenken und beispielsweise eine entsprechende Zuweisung an die Unfallkassen22Wie sie in § 57 Absatz 5 SGB XIV für die Hilfsmittelversorgung nach § 46 SGB XIV geregelt ist. in Betracht zu ziehen23Die ggfls. auch nur für Großschadensereignisse Anwendung finden könnten.. Ob ein solcher politischer Paradigmenwechsel realistisch ist, ist schwer einzuschätzen, Sachgründe hierfür ließen sich aber finden, was unter Umständen nicht nur für Betroffene von Großschadensereignissen gelten könnte.
Einigkeit bestand unter den Teilnehmenden der Paneldiskussion darin, dass ein abgestimmtes Handeln aller relevanter Akteure nach einem Großschadensereignis eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür ist, die Folgen solcher Ereignisse für die Opfer so gering wie möglich zu halten.
c) Arbeitsgruppen
Im Rahmen der Arbeitsgruppendiskussionen wurden Aspekte des Datenschutzes, Herausforderungen aus rechtlicher Sicht und der Umgang mit den Betroffenen vertieft in den Blick genommen.
In Bezug auf das besonders herausfordernde Thema des Datenschutzes ist ein wesentliches Ergebnis, dass die bestehenden Regelungen zum Schutz personenbezogener Daten nach Möglichkeit so ausgestaltet sein sollten, dass eine möglichst unbürokratische Hilfe der Betroffenen gelingen kann, ohne Gefahr zu laufen, besonders schutzwürdige Aspekte preis zu geben. Ob das insoweit bestehende Spannungsfeld allein auf der Grundlage der bereits umfangreich vorhandenen gesetzlichen und untergesetzlichen Regelungen aufzulösen ist, oder ob es spezielle Lösungen braucht, wird im Weiteren zu betrachten sein.
Im Rahmen der Diskussion um rechtliche Herausforderungen wurde ein vertiefter Blick auf die bestehenden Rechtsgrundlagen des SGB XIV geworfen und hierbei die Frage in den Blick genommen, wie diese Normen im Hinblick auf Großschadensereignisse möglichst sachgerecht im Sinne der Betroffenen genutzt werden können. Diskutiert wurde zum Beispiel die Schaffung von untergesetzlichen Regelungen, namentlich von Verwaltungsvorschriften24Wie diese unter Geltung des Vorgängerrechts im Bundesversorgungsgesetz und den Gesetzen, die das BVG für entsprechend anwendbar erklärten umfangreich vorhanden waren., die spezielle Ausführungen zu großen Schadenslagen enthalten könnten. Ebenfalls unter dem rechtlichen Blickwinkel wurde – erneut – die Rolle der Kranken- und Unfallkassen betrachtet, wobei der wesentlich umfassendere Leistungskatalog des SGB VII im Vergleich SGB V ein Argument für eine Stärkung der Rolle der Unfallkassen sein könnte, um Schnittstellenprobleme zu verkleinern.
Der Workshop zum Umgang mit Betroffenen brachte als wesentliches Ergebnis, dass die Opfer neben den unmittelbar aus der Tat resultierenden gesundheitlichen Problemen, der Angst um Angehörige und möglicherweise existenziellen Sorgen vor allem unter einer Überforderung mit Anträgen unterschiedlicher Leistungsträger, einer Orientierungslosigkeit aufgrund unklarer Zuständigkeiten und ggfls. langen Wartezeiten für Hilfsleistungen leiden. Lösungen können dabei im Wesentlichen in einer besseren Vernetzung der Akteure, aber auch zum Beispiel darin liegen, Antragsvordrucke anzupassen, konkret zu vereinfachen, und die vielfachen Erkenntnisse der Opferschutzbeauftragten im Bund und den Ländern sowie der Opferschutz- und -hilfeorganisationen für staatliche Stellen so gut wie möglich nutzbar zu machen.
VII. Ergebnisse
Ein wesentliches Ergebnis des Treffens ist, dass es gelingen muss, die bereits an vielen Stellen in unserem gegliederten System vorhandenen guten und im besten Sinne hilfreichen Ansätze so mit miteinander zu verknüpfen, dass aufseiten der zuständigen Stellen Informationen dazu vorhanden sind, welche Schritte durch andere Stellen bereits eingeleitet wurden, um abgestimmt und nicht mehrfach mit identischen Anliegen auf die Betroffenen zuzugehen. Dies ist aus Opferschutzgründen von besonderer Bedeutung, weil immer bedacht werden muss, dass Menschen, die von einer Gewalttat, zumal von einer mit der Ausprägung eines Großschadensereignisses, betroffen sind, sich häufig in einer psychischen Ausnahmesituation befinden, die es erfordert, dass sie nicht mit einem Übermaß an Bürokratie konfrontiert werden und beispielsweise von unterschiedlichen Stellen aufgefordert werden, verschiedene Antragsvordrucke auszufüllen, die wesentlich gleiche Informationen enthalten. Dies stellt eine große Herausforderung in einem System dar, dass von einer Vielzahl unterschiedliche Lebenssachverhalte zuständiger Stellen gekennzeichnet ist und in dem datenschutzrechtliche Hürden oft hoch sind. Wünschenswert im Sinne der Opfer ist, dass diese systemischen Gegebenheiten vor dem Hintergrund von Ausnahmeereignissen wie großen Schadenslagen einer kritischen Betrachtung unterzogen werden, um nicht Gefahr zu laufen, dass eben diese Gegebenheiten das Gegenteil von dem erreichen, wozu sie gedacht sind und damit zum Selbstzweck werden. Dies ist Betroffenen nicht vermittel- und zumutbar.
VIII. Fazit
In der Gesamtschau der Veranstaltung kann festgestellt werden, dass die Initiative der Bundesebene, allen näheren und auch ferneren Akteuren dieses Thema eine Austausch-, Diskussion- und nicht zuletzt Vernetzungsplattform zu bieten, absolut dankenswert ist und auch zum richtigen Zeitpunkt kam. Einzig die Tatsache der deutlichen zeitlichen Begrenzung des Treffens – die aber angesichts der naturgemäß beschränkten Zeitressourcen vielbeschäftigter Teilnehmender in der Natur der Sache liegen kann – mag Manchen angesichts der enormen Anzahl und Bedeutung an Herausforderungen, die in den Blick zu nehmen sind, ein wenig enttäuscht haben. Ein Folgeformat ist deshalb wünschenswert, ja beinah zwingend.
In der Sache zeigen die Ergebnisse, dass in der vergangenen Zeit schon viel erreicht und Strukturen geschaffen wurden, die bereits hilfreich wirken, was ohne Zweifel der hohen und oft intrinsischen Motivation maßgeblicher Akteure zu verdanken ist. Sie zeigen aber auch, dass gerade bei den Themen struktureller Verbindlichkeit, Datenschutz und vor allem der notwendigen Zuwendung zu den Betroffenen von Großschadensereignissen Ausbaupotenzial und -notwendigkeit besteht.
Sehr ernst zu nehmen ist aber auch der Hinweis einiger Teilnehmender, dass die bessere Ausformung von Regelungen für Opfer solcher Großschadensereignissen nicht dazu führen darf, dass andere Gewaltbetroffene25Hier ist nicht zuletzt an die Belange der Opfer sexuellen Missbrauchs zu denken, die bei der Schaffung des SGB XIV –vollkommen zu Recht – an vielen Stellen wichtige gesetzgeberische Regelungen hervorbringen konnten. aus dem Blick geraten und hierdurch ‚Opfer erster und zweiter Klasse‘ geschaffen werden. Die Aufgabe der verantwortlichen Akteure auf Bundes- und Landesebene wird vielmehr nun darin liegen, die guten und bereits in vielerlei Hinsicht opferzentriert ausgestalteten Strukturen des SGB XIV darauf zu untersuchen, wo sie Lücken für Betroffene von Großschadensereignissen haben und diese Lücken im Sinne der Opfer zu schließen. Hierfür hat die Veranstaltung viele wertvolle und – man kann es nur wünschen – gewinnbringende Impulse liefern können.
----------
- 1Die Bundesstelle für Soziale Entschädigung ist eine beim Bundesamt für Soziale Sicherung angesiedelte und der Aufsicht des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales unterstehende Behörde in deren Geschäftsbereich, die eine Reihe v.a. operativer Aufgaben beim Vollzug des SGB XIV hat.
- 2Hierzu auch Pressemitteilung des BMAS ‚Opferentschädigung bei Großschadensereignissen‘ vom 14.11.2025.
- 3Der freilich nur einen Aspekt staatlicher und gesellschaftlicher Herausforderungen solcher Ereignisse darstellt.
- 4Die Aufzählung ist wie ausgeführt beispielhaft und beinhaltet vor allem keine Bewertung von Schwere und Ausmaß der Ereignisse.
- 5Zu denken ist hier an Vorkommnisse in kirchlichem Kontext oder Missbrauchskomplexen wie dem in Lügde in den Jahren 2008 bis 2018.
- 6Oder auf einem deutschen Schiff oder Luftfahrzeug.
- 7Daneben bezieht das SGB XIV nach § 13 Absatz 1 Nr. 2 und § 14 weitere Gewaltbetroffene, wie Opfer bestimmter psychischer Gewalt, Opfer von Angriffen mit Gift und erheblich vernachlässigte Kinder in den Schutzbereich des SGB XI ein.
- 8Gegen seine oder eine andere Person oder durch dessen rechtmäßige Abwehr.
- 9Außer Kraft getreten am 1.1.2024 aufgrund des Gesetzes vom 12.12.2019 (BGBl. I S. 2652).
- 10Namentlich denen der Einbeziehung psychischer Gewalt in den Schutzbereich des SGB XIV.
- 11z.B. Kerner WzS 2025, 146ff und Weber, Die Sozialverwaltung 2/2025, 30ff.
- 12vgl. Kerner a.a.O. mit einer beispielhaften Aufzählung solcher – teils wenig bekannter – Angebote.
- 13z.B. Kranig, ‚Subsidiarität der Inanspruchnahme des Entschädigungsfonds gegenüber Versorgungsbezügen nach dem Opferentschädigungsgesetz‘, NZV 2024, 387.
- 14Aktuell ist Prof. Rixen auch Vorsitzender des Fachbeirats Soziale Entschädigung.
- 15§§ 86ff. SGB X sehen eine ausdrückliche Verpflichtung zur Zusammenarbeit der verantwortlichen Stellen vor.
- 16Artikel 30 GG regelt, dass Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung staatlicher Aufgaben grundsätzlich Sache der Länder ist.
- 17Ein durchaus interessanter Gedanke ist die vom Referenten aufgeworfene denkbare Analogie zum ‚Gemeinsamen Lagezentrum See‘, das eine flexible Zusammenarbeitsstruktur für die Seeraumüberwachung, zur Verbesserung der Gefahrenabwehr und des Unfallmanagements in deutschen Küstengewässern bilden soll und hier über jahrelange Erfahrung verfügt.
- 18Neben dem Landschaftsverband Rheinland einer von zwei in Nordrhein-Westfalen für das SER durchführungsverantwortlichen Behörden.
- 19Nach Kapitel 5 SGB XIV.
- 20Geregelt in § 43 SGB XIV.
- 21Entsprechend BT-Drs. 19/1382, S. 188.
- 22Wie sie in § 57 Absatz 5 SGB XIV für die Hilfsmittelversorgung nach § 46 SGB XIV geregelt ist.
- 23Die ggfls. auch nur für Großschadensereignisse Anwendung finden könnten.
- 24Wie diese unter Geltung des Vorgängerrechts im Bundesversorgungsgesetz und den Gesetzen, die das BVG für entsprechend anwendbar erklärten umfangreich vorhanden waren.
- 25Hier ist nicht zuletzt an die Belange der Opfer sexuellen Missbrauchs zu denken, die bei der Schaffung des SGB XIV –vollkommen zu Recht – an vielen Stellen wichtige gesetzgeberische Regelungen hervorbringen konnten.



