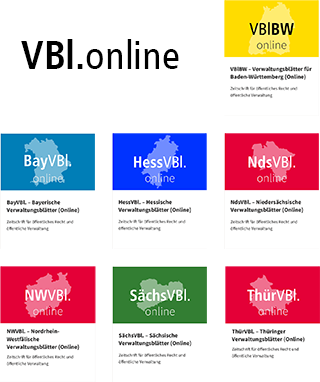Aktuelle Rechtsprechung zum elektronischen Verwaltungsverfahren
Elektronischer Rechtsverkehr im Verwaltungsverfahren
Aktuelle Rechtsprechung zum elektronischen Verwaltungsverfahren
Elektronischer Rechtsverkehr im Verwaltungsverfahren
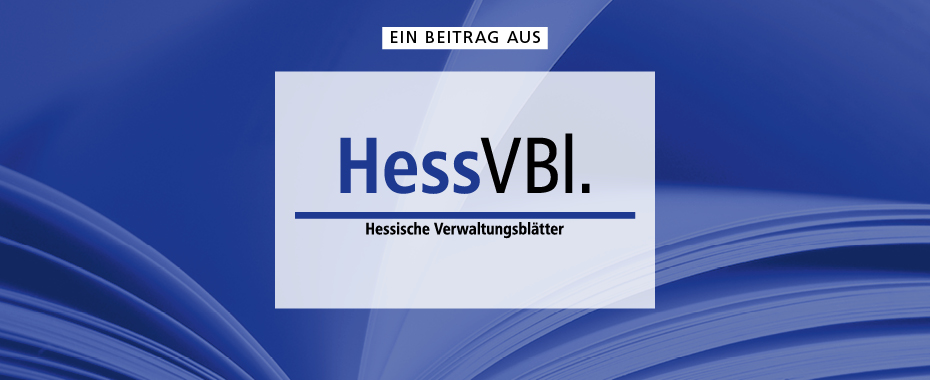
Die öffentliche Verwaltung beginnt nicht mit der Digitalisierung, sondern diese ist seit Langem gelebte Realität. Der elektronische Rechtsverkehr ist mittlerweile nicht nur Zwang im Prozessrecht, sondern auch im Verwaltungsverfahren eine selbstverständliche Möglichkeit. Bürgerinnen und Bürger kontaktieren Behörden elektronisch fast ausschließlich mittels E-Mail, nur zögerlich zunehmend aber auch über eigens eingerichtete Verwaltungsportale. Die Rechtsgrundlagen sind dennoch oft auch in der Behörde selbst unbekannt, erst recht aufseiten des Bürgers. Rechtsstreitigkeiten zu Form- und Fristfragen des elektronischen Verwaltungsverfahrens nehmen daher zu. Dieser Beitrag liefert eine Übersicht über die aktuellsten Entscheidungen.
I. Grundsätze des elektronischen Rechtsverkehrs im Verwaltungsverfahren
Der elektronische Rechtsverkehr im Verwaltungsverfahren ist sowohl für den Posteingang als auch für den Postausgang der Behörde in § 3 a VwVfG bzw. für Landesbehörden in dessen landesrechtlichem Pendant – in Hessen im HVwVfG – geregelt. Der elektronische Rechtsverkehr mit Sozialbehörden ist im Anwendungsbereich des SGB I sowie des SGB X in § 36 a SGB I normiert; beide Regelungen sind nahezu wortgleich, auch wenn die Absatznummerierung in § 36 a SGB I seit dem 01.01.2024 von § 3 a VwVfG abweicht. Die landesrechtlichen Normen haben die Änderungen im Bundesrecht zum 01.01.2024 dagegen teilweise noch nicht nachvollzogen – so zum Zeitpunkt der Drucklegung auch noch in Hessen – und sind deshalb auf dem Stand des Bundesrechts vom 31.12.2023.
1. Zulässigkeit der elektronischen Kommunikation im Verwaltungsverfahren
Gemäß § 3 a Abs. 1 VwVfG bzw. HVwVfG, § 36 a Abs. 1 SGB I ist die Übermittlung elektronischer Dokumente zulässig, wenn der Empfänger – die Behörde in gleicher Weise wie auf dem umgekehrten Weg der Bürger – hierfür einen Zugang eröffnet hat. Die Zugangseröffnung setzt sich, wie das SG Darmstadt1 in mehreren Entscheidungen herausstellt, zusammen aus der technischen Bereitstellung des Zugangs als Vorbereitungsakt und der Widmung dieses Zugangs für die Nutzung im (rechtsverbindlichen) elektronischen Rechtsverkehr.2
Die Elektronische-Rechtsverkehr-Verordnung (ERVV) gilt anders als im elektronischen Rechtsverkehr mit den Gerichten nicht. Die zulässigen elektronischen Übermittlungswege sind deshalb im Verwaltungsverfahren im Gegensatz zum Prozessrecht nicht auf bestimmte, gesetzlich zugelassene Verfahren beschränkt, sondern sie liegen in der freien Auswahl der eröffnenden Person. Ferner gibt es auch keine dezidierten Anforderungen an die zugelassenen Dateiformate.
2. Technische Bereitstellung des elektronischen Übermittlungswegs
Die technische Bereitstellung des Zugangs ist ausschließlich im Hinblick auf dessen Außenwirkung zu bewerten. Tatsächlich bereitgestellt ist der Zugang, wenn ein elektronisches Postfach oder ein digitales Portal/Formular durch eine andere Person außerhalb des eigenen Netzwerks erreichbar oder adressierbar ist. Ob dessen (interne) Funktionalität im Übrigen gegeben ist, spielt dagegen keine Rolle, weil dies für den Absender nicht erkennbar ist.
Da gesetzlich keine bestimmten, zugelassenen Übermittlungswege vorgegeben sind, kommen sämtliche Möglichkeiten der elektronischen Kommunikation in Betracht. Denkbar sind deshalb alle Benachrichtigungsarten, die einen Transport von digitalen Dateien erlauben. Dies müssen nicht zwingend Dateianhänge sein, sondern auch reine Textnachrichten kommen in Betracht. Auch unverschlüsselte E-Mails sind daher – trotz Bedenken im Hinblick auf den Datenschutz und die IT-Sicherheit – im Verwaltungsverfahren als Übermittlungsweg nicht ausgeschlossen.3 Bedenken hinsichtlich der Nutzung „einfacher” E-Mails äußert indes das VG Berlin4, denn ihnen fehle grundsätzlich der Nachweis, ob sie vollständig und richtig seien und ob sie tatsächlich von dem in ihr angegebenen Urheber stammten. Ähnlich hatten sich bereits früher das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG)5 und der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH)6 geäußert.
Gleiches gilt letztlich für alle denkbaren Formen elektronischer Kommunikation (WhatsApp, Facebook-Messenger etc.) bis hin zu Social-Media-Auftritten der Behörden und dort vorhandenen Möglichkeiten der Direktkommunikation (Twitter/X-DM, Instagram-Direct-Nachrichtenfunktion usw.).7
Vor allem im sozialrechtlichen Leistungserbringerrecht kann auch die „Kommunikation im Medizinwesen” (KIM) der Telematikinfrastruktur (TI) für den elektronischen Rechtsverkehr im Verwaltungsverfahren Anwendung finden. Die Telematikinfrastruktur ist eine technische Infrastruktur zur Vernetzung von Ärzten, Zahnärzten, Psychotherapeuten, Krankenhäusern, Apotheken und Krankenkassen. Zugriff auf die Telematikinfrastruktur haben ferner weitere Institutionen im Gesundheitssektor wie bspw. die Kassenärztlichen Vereinigungen, die Prüfungsstellen etc. Rechtliche Grundlage für die Aufzeichnung und Übermittlung von Diagnosen und Angaben über erbrachte Leistungen an die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Krankenkassen ist § 295 SGB V. Keinen Zugriff haben die Gerichte; die Kommunikationsinfrastruktur des Elektronischen Gerichts- und Verwaltungspostfachs (EGVP) ist nicht mit dem KIM verbunden. Durch das Digitalgesetz vom 23.03.2024 wurde mit Wirkung zum 26.03.2024 und mit Verpflichtung ab 30.06.2024 der neue § 295 Abs. 1 c SGB V eingeführt. Der Gesetzgeber bezweckte hiermit die Etablierung der Nutzung des KIM als Nachrichtendienst. KIM darf deshalb auch im Verwaltungsverfahren für die rechtsverbindliche elektronische Kommunikation zwischen den TI-Teilnehmern genutzt werden.

3. Widmung des elektronischen Übermittlungswegs
Die Eröffnung eines eingerichteten elektronischen Zugangs erfolgt durch Widmung. Die Widmung wiederum ist die Signalisierung der Bereitschaft und Fähigkeit zur elektronischen Kommunikation gegenüber dem (potenziellen) Kommunikationspartner – ausdrücklich oder konkludent.8
a. Ausdrückliche Eröffnung des elektronischen Übermittlungswegs
Ausdrücklich wird der Zugang dadurch eröffnet, dass die Behörde explizit auf die Möglichkeit der rechtsverbindlichen Nutzung eines Kommunikationswegs verweist. Eine Widmung des Zugangs unter Beschränkung auf einen bestimmten Zweck oder bestimmte Personenkreise (bspw. in einem Verfahren des LSG Schleswig9 betreffend Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte) lässt das Gesetz nicht zu.
b. Konkludente Eröffnung des elektronischen Übermittlungswegs
Besondere Herausforderungen vor allem für Behörden entstehen aber durch eine konkludente – letztlich „versehentliche” – Eröffnung eines Zugangs. Dies ist dann anzunehmen, wenn die Behörde nach außen die Empfangsbereitschaft für einen tatsächlich eingerichteten technischen Zugang jedenfalls schlüssig signalisiert. Von besonderer praktischer Relevanz sind insoweit Angaben – insbesondere von E-Mail-Adressen – auf Internetpräsenzen, Flyern oder in Briefköpfen der Behörde.
Das VG Köln10 betont diesbezüglich, die Widmung sei unter Berücksichtigung der Verkehrsanschauung zu ermitteln. Verwende ein Kommunikationspartner einen zwar faktisch verfügbaren, nicht aber gewidmeten Zugang zur elektronischen Kommunikation, gehe das Dokument auch dann nicht zu, wenn es tatsächlich zur Kenntnis genommen wird.
c. Umstrittene Zugangseröffnung über den Behördenbriefkopf
Nach einer vor allem in der Sozialgerichtsbarkeit verbreiteten Auffassung, setzt die Behörde den für die Eröffnung eines elektronischen Zuganges ausreichenden Rechtsschein dann, wenn sie oberhalb der Betreffzeile im Briefkopf des Bescheides neben Namen und Telefonnummer des Sachbearbeiters für Kommunikationszwecke eine E-Mail-Adresse angibt (sog. „Kontaktblock”). Ausgangspunkt dieser Rechtsprechung war ein Verfahren des SG Hildesheim.11 Das Gericht leitet schlüssig her, durch die Angabe der Mail-Adresse erwecke die Behörde den Eindruck, dass der Bürger gegen den Bescheid auch per E-Mail Widerspruch einlegen könne. Dies dürfte insbesondere dann anzunehmen sein, wenn sogar in der Rechtsbehelfsbelehrung angeführt ist, dass der Widerspruch bei der „im Briefkopf genannten Stelle” einzulegen ist, denn dann könne ein rechtlich unerfahrener Adressat des Bescheides annehmen, dass eben auch die im Briefkopf genannte E-Mail-Adresse zur Widerspruchseinlegung genutzt werden könne.12 Ein rechtlich unerfahrener Adressat dürfte zudem die rechtlichen Unterschiede zwischen einer Schriftform, einer Textform und einer elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen zumeist gar nicht kennen und im Zweifel davon ausgehen, dass auch die Einlegung durch E-Mail der in der Rechtsbehelfsbelehrung erwähnten „Schriftform” genügt.13
Auch die Bundesgerichte hatten mittlerweile Gelegenheit, sich mit der Zugangseröffnung zu beschäftigen. Jedenfalls für den Fall, dass auch die Rechtsbehelfsbelehrung auf die Einlegung eines Rechtsbehelfs mittels E-Mail hinweist, lässt auch das BVerwG14 eine E-Mail-Adresse im Briefkopf ausreichen. Das BSG15 geht hier allerdings weiter und meint, die Angabe im Briefkopf reiche bereits dann aus, wenn der Bescheid ansonsten keine Hinweise darauf enthalte, dass die Möglichkeit einer Übermittlung per E-Mail nicht ausreiche. Das BSG verlangt also explizit einen sog. „Disclaimer”.16
d. Vermeidung der konkludenten Eröffnung durch einen „Disclaimer”Soll eine rechtsverbindliche Kommunikation auf einem bestimmten, technisch bereitgehaltenen, Übermittlungsweg – bspw. mittels E-Mail – gänzlich nicht stattfinden, wofür im Übrigen ja auch gute Gründe des Datenschutzes und der IT-Sicherheit sprechen können, lässt sich die Zugangseröffnung also (nur) durch einen ausdrücklichen, einfach verständlichen „Disclaimer” verhindern.17
Es ist hierfür zu empfehlen, unmittelbar in räumlicher Nähe zu der E-Mail-Adresse auf dem Briefkopf zu formulieren, dass diese für Rechtsbehelfe oder allgemein für eine rechtsverbindliche Kommunikation nicht zugelassen wird. („Eine rechtsverbindliche Kommunikation mittels E-Mail ist nicht zugelassen.”)18 Ein „Disclaimer” bspw. (nur) auf der Homepage der Behörde, dass eine (bestimmte Form der) elektronischen Widerspruchseinlegung nicht möglich ist, genügt insbesondere dann nicht, wenn die (konkludente) Widmung des elektronischen Zugangs in einem konkreten Einzelfall erfolgt ist (bspw. durch initiative Ansprache des Bürgers auf elektronischem Wege durch die Behörde oder die Angabe einer E-Mail-Adresse im Briefkopf der Behörde).
Gleiches gilt für Social-Media-Auftritte von Behörden (bspw. bei Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn etc.). Hier sollte der „Disclaimer” in der Beschreibung („Biographie”, „Profil”) der Behörde gut sichtbar hervorgehoben und, wenn möglich, nahe der jeweiligen Schaltfläche für eine unmittelbare Kommunikation (Messenger, DM etc.) aufgenommen werden.19 Es muss zur Kenntnis genommen werden, dass für Teile der Bevölkerung selbst Homepages schon „old school” sind und Informationen eher oder ausschließlich Auftritten in sozialen Netzwerken entnommen werden.
Ein nachträglich gegebener individueller Hinweis an den Widerspruchsführer reicht zur Auflösung des Rechtsscheins nicht aus, weil auf eine abstrakte Betrachtungsweise vor Einlegung des Rechtsbehelfs abzustellen ist und es unerheblich ist, ob eine unrichtige Rechtsbehelfsbelehrung konkret ursächlich für eine Fristversäumnis ist.20 Letztlich würde es sich andernfalls um einen Fall des venire contra factum proprium handeln.21
Wohl nur eine Mindermeinung22 geht noch davon aus, dass die Behörde einen durch Angabe einer allgemeinen E-Mail-Adresse oder die Einrichtung eines besonderen elektronischen Behördenpostfachs (beBPo) gesetzten Rechtsschein dadurch beseitigen könne, dass in einer Rechtsbehelfsbelehrung bspw. nur auf eine De-Mail-Adresse verwiesen wird. Diese Meinung überzeugt deshalb nicht, weil hierdurch nicht zu unterscheiden wäre, ob die Rechtsbehelfsbelehrung bloß fehlerhaft (weil unvollständig) ist.
Den vollständigen Beitrag entnehmen Sie den HessVBl. Heft 3/2025.